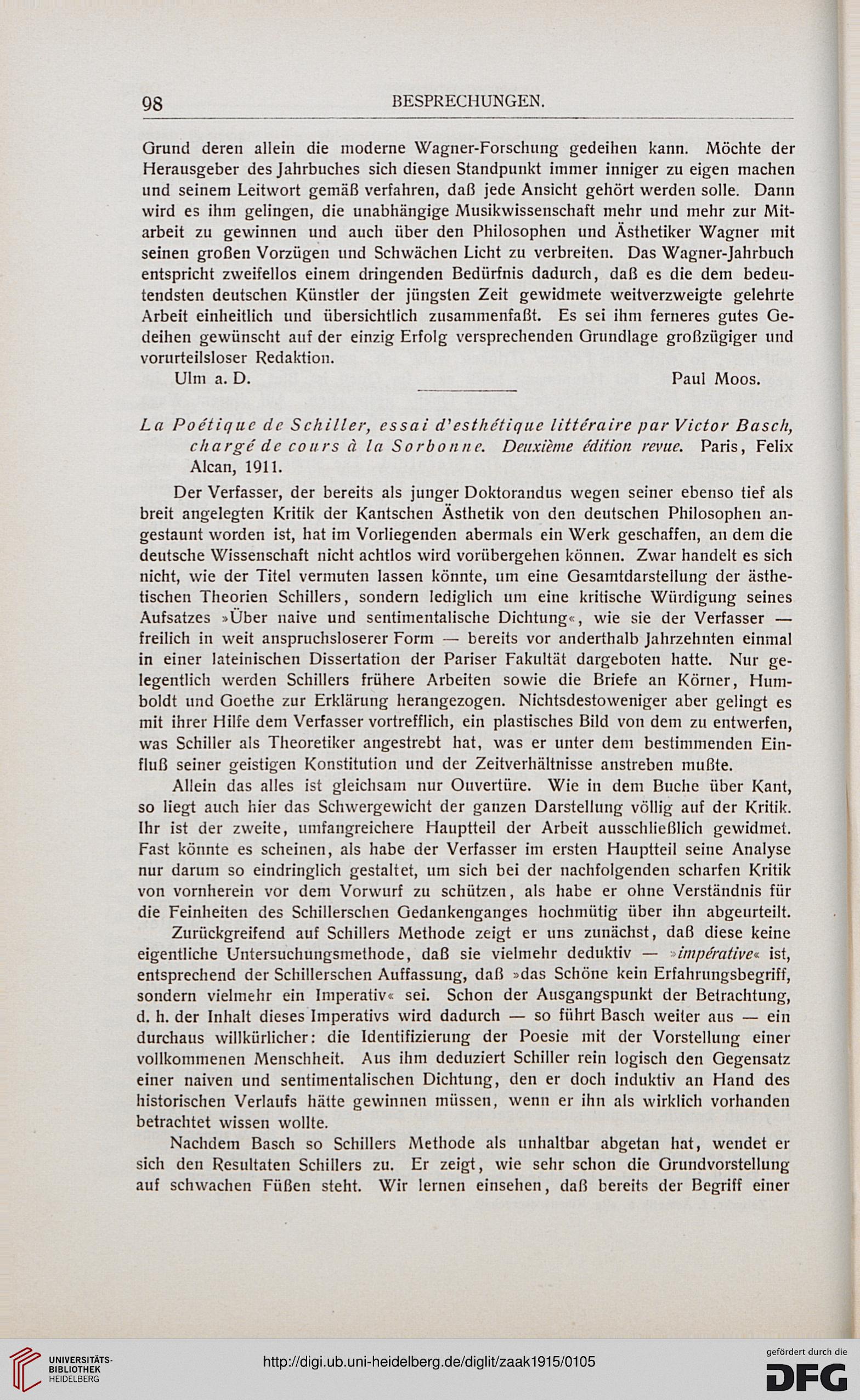98 BESPRECHUNGEN.
Grund deren allein die moderne Wagner-Forschung gedeihen kann. Möchte der
Herausgeber des Jahrbuches sich diesen Standpunkt immer inniger zu eigen machen
und seinem Leitwort gemäß verfahren, daß jede Ansicht gehört werden solle. Dann
wird es ihm gelingen, die unabhängige Musikwissenschaft mehr und mehr zur Mit-
arbeit zu gewinnen und auch über den Philosophen und Ästhetiker Wagner mit
seinen großen Vorzügen und Schwächen Licht zu verbreiten. Das Wagner-Jahrbuch
entspricht zweifellos einem dringenden Bedürfnis dadurch, daß es die dem bedeu-
tendsten deutschen Künstler der jüngsten Zeit gewidmete weitverzweigte gelehrte
Arbeit einheitlich und übersichtlich zusammenfaßt. Es sei ihm ferneres gutes Ge-
deihen gewünscht auf der einzig Erfolg versprechenden Grundlage großzügiger und
vorurteilsloser Redaktion.
Ulm a. D. Paul Moos.
La Poetique de Schiller, essai d'esthe'tiqne litteraire par Victor Bascli,
Charge de cours ä la Sorbonne. Deuxieme Mition revue. Paris, Felix
Alcan, 1911.
Der Verfasser, der bereits als junger Doktorandus wegen seiner ebenso tief als
breit angelegten Kritik der Kantschen Ästhetik von den deutschen Philosophen an-
gestaunt worden ist, hat im Vorliegenden abermals ein Werk geschaffen, an dem die
deutsche Wissenschaft nicht achtlos wird vorübergehen können. Zwar handelt es sich
nicht, wie der Titel vermuten lassen könnte, um eine Gesamtdarstellung der ästhe-
tischen Theorien Schillers, sondern lediglich um eine kritische Würdigung seines
Aufsatzes >Über naive und sentimentalische Dichtung', wie sie der Verfasser —
freilich in weit anspruchsloserer Form — bereits vor anderthalb Jahrzehnten einmal
in einer lateinischen Dissertation der Pariser Fakultät dargeboten hatte. Nur ge-
legentlich weiden Schillers frühere Arbeiten sowie die Briefe an Körner, Hum-
boldt und Goethe zur Erklärung herangezogen. Nichtsdestoweniger aber gelingt es
mit ihrer Hilfe dem Verfasser vortrefflich, ein plastisches Bild von dem zu entwerfen,
was Schiller als Theoretiker angestrebt hat, was er unter dem bestimmenden Ein-
fluß seiner geistigen Konstitution und der Zeitverhältnisse anstreben mußte.
Allein das alles ist gleichsam nur Ouvertüre. Wie in dem Buche über Kant,
so liegt auch hier das Schwergewicht der ganzen Darstellung völlig auf der Kritik.
Ihr ist der zweite, umfangreichere Hauptteil der Arbeit ausschließlich gewidmet.
Fast könnte es scheinen, als habe der Verfasser im ersten Hauptteil seine Analyse
nur darum so eindringlich gestaltet, um sich bei der nachfolgenden scharfen Kritik
von vornherein vor dem Vorwurf zu schützen, als habe er ohne Verständnis für
die Feinheiten des Schillerschen Gedankenganges hochmütig über ihn abgeurteilt.
Zurückgreifend auf Schillers Methode zeigt er uns zunächst, daß diese keine
eigentliche Untersuchungsmethode, daß sie vielmehr deduktiv — »imperative* ist,
entsprechend der Schillerschen Auffassung, daß »das Schöne kein Erfahrungsbegriff,
sondern vielmehr ein Imperativ« sei. Schon der Ausgangspunkt der Betrachtung,
d. h. der Inhalt dieses Imperativs wird dadurch — so führt Basch weiter aus — ein
durchaus willkürlicher: die Identifizierung der Poesie mit der Vorstellung einer
vollkommenen Menschheit. Aus ihm deduziert Schiller rein logisch den Gegensatz
einer naiven und sentimentalischen Dichtung, den er doch induktiv an Hand des
historischen Verlaufs hätte gewinnen müssen, wenn er ihn als wirklich vorhanden
betrachtet wissen wollte.
Nachdem Basch so Schillers Methode als unhaltbar abgetan hat, wendet er
sich den Resultaten Schillers zu. Er zeigt, wie sehr schon die Grundvorstellung
auf schwachen Füßen steht. Wir lernen einsehen, daß bereits der Begriff einer
Grund deren allein die moderne Wagner-Forschung gedeihen kann. Möchte der
Herausgeber des Jahrbuches sich diesen Standpunkt immer inniger zu eigen machen
und seinem Leitwort gemäß verfahren, daß jede Ansicht gehört werden solle. Dann
wird es ihm gelingen, die unabhängige Musikwissenschaft mehr und mehr zur Mit-
arbeit zu gewinnen und auch über den Philosophen und Ästhetiker Wagner mit
seinen großen Vorzügen und Schwächen Licht zu verbreiten. Das Wagner-Jahrbuch
entspricht zweifellos einem dringenden Bedürfnis dadurch, daß es die dem bedeu-
tendsten deutschen Künstler der jüngsten Zeit gewidmete weitverzweigte gelehrte
Arbeit einheitlich und übersichtlich zusammenfaßt. Es sei ihm ferneres gutes Ge-
deihen gewünscht auf der einzig Erfolg versprechenden Grundlage großzügiger und
vorurteilsloser Redaktion.
Ulm a. D. Paul Moos.
La Poetique de Schiller, essai d'esthe'tiqne litteraire par Victor Bascli,
Charge de cours ä la Sorbonne. Deuxieme Mition revue. Paris, Felix
Alcan, 1911.
Der Verfasser, der bereits als junger Doktorandus wegen seiner ebenso tief als
breit angelegten Kritik der Kantschen Ästhetik von den deutschen Philosophen an-
gestaunt worden ist, hat im Vorliegenden abermals ein Werk geschaffen, an dem die
deutsche Wissenschaft nicht achtlos wird vorübergehen können. Zwar handelt es sich
nicht, wie der Titel vermuten lassen könnte, um eine Gesamtdarstellung der ästhe-
tischen Theorien Schillers, sondern lediglich um eine kritische Würdigung seines
Aufsatzes >Über naive und sentimentalische Dichtung', wie sie der Verfasser —
freilich in weit anspruchsloserer Form — bereits vor anderthalb Jahrzehnten einmal
in einer lateinischen Dissertation der Pariser Fakultät dargeboten hatte. Nur ge-
legentlich weiden Schillers frühere Arbeiten sowie die Briefe an Körner, Hum-
boldt und Goethe zur Erklärung herangezogen. Nichtsdestoweniger aber gelingt es
mit ihrer Hilfe dem Verfasser vortrefflich, ein plastisches Bild von dem zu entwerfen,
was Schiller als Theoretiker angestrebt hat, was er unter dem bestimmenden Ein-
fluß seiner geistigen Konstitution und der Zeitverhältnisse anstreben mußte.
Allein das alles ist gleichsam nur Ouvertüre. Wie in dem Buche über Kant,
so liegt auch hier das Schwergewicht der ganzen Darstellung völlig auf der Kritik.
Ihr ist der zweite, umfangreichere Hauptteil der Arbeit ausschließlich gewidmet.
Fast könnte es scheinen, als habe der Verfasser im ersten Hauptteil seine Analyse
nur darum so eindringlich gestaltet, um sich bei der nachfolgenden scharfen Kritik
von vornherein vor dem Vorwurf zu schützen, als habe er ohne Verständnis für
die Feinheiten des Schillerschen Gedankenganges hochmütig über ihn abgeurteilt.
Zurückgreifend auf Schillers Methode zeigt er uns zunächst, daß diese keine
eigentliche Untersuchungsmethode, daß sie vielmehr deduktiv — »imperative* ist,
entsprechend der Schillerschen Auffassung, daß »das Schöne kein Erfahrungsbegriff,
sondern vielmehr ein Imperativ« sei. Schon der Ausgangspunkt der Betrachtung,
d. h. der Inhalt dieses Imperativs wird dadurch — so führt Basch weiter aus — ein
durchaus willkürlicher: die Identifizierung der Poesie mit der Vorstellung einer
vollkommenen Menschheit. Aus ihm deduziert Schiller rein logisch den Gegensatz
einer naiven und sentimentalischen Dichtung, den er doch induktiv an Hand des
historischen Verlaufs hätte gewinnen müssen, wenn er ihn als wirklich vorhanden
betrachtet wissen wollte.
Nachdem Basch so Schillers Methode als unhaltbar abgetan hat, wendet er
sich den Resultaten Schillers zu. Er zeigt, wie sehr schon die Grundvorstellung
auf schwachen Füßen steht. Wir lernen einsehen, daß bereits der Begriff einer