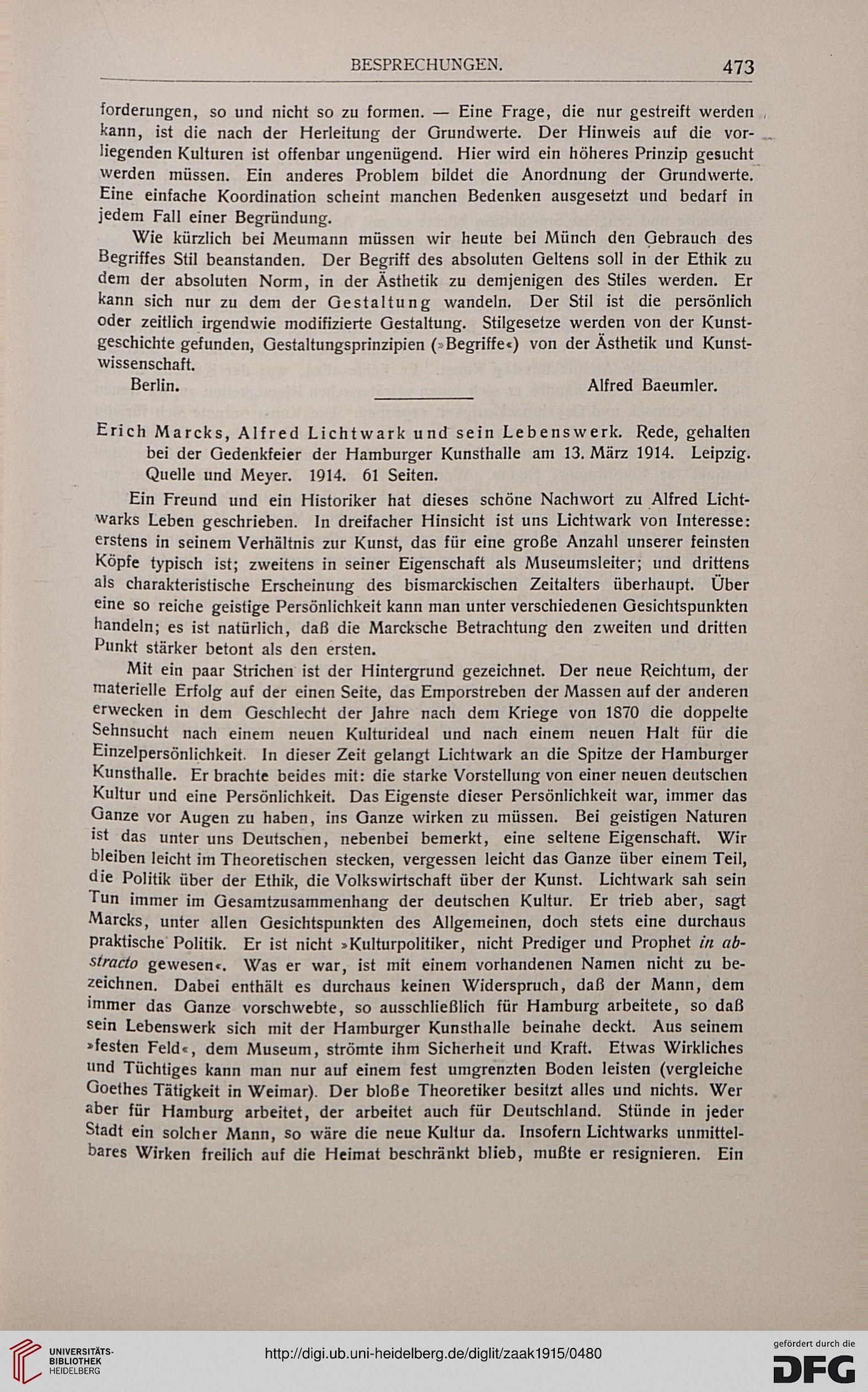BESPRECHUNGEN. 473
forderungen, so und nicht so zu formen. — Eine Frage, die nur gestreift werden
kann, ist die nach der Herleitung der Grundwerte. Der Hinweis auf die vor-
liegenden Kulturen ist offenbar ungenügend. Hier wird ein höheres Prinzip gesucht
werden müssen. Ein anderes Problem bildet die Anordnung der Grundwerte.
Eine einfache Koordination scheint manchen Bedenken ausgesetzt und bedarf in
jedem Fall einer Begründung.
Wie kürzlich bei Meumann müssen wir heute bei Münch den Gebrauch des
Begriffes Stil beanstanden. Der Begriff des absoluten Geltens soll in der Ethik zu
dem der absoluten Norm, in der Ästhetik zu demjenigen des Stiles werden. Er
kann sich nur zu dem der Gestaltung wandeln. Der Stil ist die persönlich
oder zeitlich irgendwie modifizierte Gestaltung. Stilgesetze werden von der Kunst-
geschichte gefunden, Gestaltungsprinzipien (»Begriffe«) von der Ästhetik und Kunst-
wissenschaft.
Berlin. Alfred Baeumler.
Erich Marcks, Alfred Lichtwark und sein Lebenswerk. Rede, gehalten
bei der Gedenkfeier der Hamburger Kunsthalle am 13. März 1914. Leipzig.
Quelle und Meyer. 1914. 61 Seiten.
Ein Freund und ein Historiker hat dieses schöne Nachwort zu Alfred Licht-
warks Leben geschrieben. In dreifacher Hinsicht ist uns Lichtwark von Interesse:
erstens in seinem Verhältnis zur Kunst, das für eine große Anzahl unserer feinsten
Köpfe typisch ist; zweitens in seiner Eigenschaft als Museumsleiter; und drittens
als charakteristische Erscheinung des bismarckischen Zeitalters überhaupt. Über
eine so reiche geistige Persönlichkeit kann man unter verschiedenen Gesichtspunkten
handeln; es ist natürlich, daß die Marcksche Betrachtung den zweiten und dritten
Punkt stärker betont als den ersten.
Mit ein paar Strichen ist der Hintergrund gezeichnet. Der neue Reichtum, der
materielle Erfolg auf der einen Seite, das Emporstreben der Massen auf der anderen
erwecken in dem Geschlecht der Jahre nach dem Kriege von 1870 die doppelte
Sehnsucht nach einem neuen Kulturideal und nach einem neuen Halt für die
Einzelpersönlichkeit. In dieser Zeit gelangt Lichtwark an die Spitze der Hamburger
Kunsthalle. Er brachte beides mit: die starke Vorstellung von einer neuen deutschen
Kultur und eine Persönlichkeit. Das Eigenste dieser Persönlichkeit war, immer das
Ganze vor Augen zu haben, ins Ganze wirken zu müssen. Bei geistigen Naturen
ist das unter uns Deutschen, nebenbei bemerkt, eine seltene Eigenschaft. Wir
bleiben leicht im Theoretischen stecken, vergessen leicht das Ganze über einem Teil,
die Politik über der Ethik, die Volkswirtschaft über der Kunst. Lichtwark sah sein
Tun immer im Gesamtzusammenhang der deutschen Kultur. Er trieb aber, sagt
Marcks, unter allen Gesichtspunkten des Allgemeinen, doch stets eine durchaus
praktische Politik. Er ist nicht »Kulturpolitiker, nicht Prediger und Prophet in ab-
stracto gewesen«. Was er war, ist mit einem vorhandenen Namen nicht zu be-
zeichnen. Dabei enthält es durchaus keinen Widerspruch, daß der Mann, dem
immer das Ganze vorschwebte, so ausschließlich für Hamburg arbeitete, so daß
sein Lebenswerk sich mit der Hamburger Kunsthalle beinahe deckt. Aus seinem
»festen Feld«, dem Museum, strömte ihm Sicherheit und Kraft. Etwas Wirkliches
und Tüchtiges kann man nur auf einem fest umgrenzten Boden leisten (vergleiche
Goethes Tätigkeit in Weimar). Der bloße Theoretiker besitzt alles und nichts. Wer
aber für Hamburg arbeitet, der arbeitet auch für Deutschland. Stünde in jeder
Stadt ein solcher Mann, so wäre die neue Kultur da. Insofern Lichtwarks unmittel-
bares Wirken freilich auf die Heimat beschränkt blieb, mußte er resignieren. Ein
forderungen, so und nicht so zu formen. — Eine Frage, die nur gestreift werden
kann, ist die nach der Herleitung der Grundwerte. Der Hinweis auf die vor-
liegenden Kulturen ist offenbar ungenügend. Hier wird ein höheres Prinzip gesucht
werden müssen. Ein anderes Problem bildet die Anordnung der Grundwerte.
Eine einfache Koordination scheint manchen Bedenken ausgesetzt und bedarf in
jedem Fall einer Begründung.
Wie kürzlich bei Meumann müssen wir heute bei Münch den Gebrauch des
Begriffes Stil beanstanden. Der Begriff des absoluten Geltens soll in der Ethik zu
dem der absoluten Norm, in der Ästhetik zu demjenigen des Stiles werden. Er
kann sich nur zu dem der Gestaltung wandeln. Der Stil ist die persönlich
oder zeitlich irgendwie modifizierte Gestaltung. Stilgesetze werden von der Kunst-
geschichte gefunden, Gestaltungsprinzipien (»Begriffe«) von der Ästhetik und Kunst-
wissenschaft.
Berlin. Alfred Baeumler.
Erich Marcks, Alfred Lichtwark und sein Lebenswerk. Rede, gehalten
bei der Gedenkfeier der Hamburger Kunsthalle am 13. März 1914. Leipzig.
Quelle und Meyer. 1914. 61 Seiten.
Ein Freund und ein Historiker hat dieses schöne Nachwort zu Alfred Licht-
warks Leben geschrieben. In dreifacher Hinsicht ist uns Lichtwark von Interesse:
erstens in seinem Verhältnis zur Kunst, das für eine große Anzahl unserer feinsten
Köpfe typisch ist; zweitens in seiner Eigenschaft als Museumsleiter; und drittens
als charakteristische Erscheinung des bismarckischen Zeitalters überhaupt. Über
eine so reiche geistige Persönlichkeit kann man unter verschiedenen Gesichtspunkten
handeln; es ist natürlich, daß die Marcksche Betrachtung den zweiten und dritten
Punkt stärker betont als den ersten.
Mit ein paar Strichen ist der Hintergrund gezeichnet. Der neue Reichtum, der
materielle Erfolg auf der einen Seite, das Emporstreben der Massen auf der anderen
erwecken in dem Geschlecht der Jahre nach dem Kriege von 1870 die doppelte
Sehnsucht nach einem neuen Kulturideal und nach einem neuen Halt für die
Einzelpersönlichkeit. In dieser Zeit gelangt Lichtwark an die Spitze der Hamburger
Kunsthalle. Er brachte beides mit: die starke Vorstellung von einer neuen deutschen
Kultur und eine Persönlichkeit. Das Eigenste dieser Persönlichkeit war, immer das
Ganze vor Augen zu haben, ins Ganze wirken zu müssen. Bei geistigen Naturen
ist das unter uns Deutschen, nebenbei bemerkt, eine seltene Eigenschaft. Wir
bleiben leicht im Theoretischen stecken, vergessen leicht das Ganze über einem Teil,
die Politik über der Ethik, die Volkswirtschaft über der Kunst. Lichtwark sah sein
Tun immer im Gesamtzusammenhang der deutschen Kultur. Er trieb aber, sagt
Marcks, unter allen Gesichtspunkten des Allgemeinen, doch stets eine durchaus
praktische Politik. Er ist nicht »Kulturpolitiker, nicht Prediger und Prophet in ab-
stracto gewesen«. Was er war, ist mit einem vorhandenen Namen nicht zu be-
zeichnen. Dabei enthält es durchaus keinen Widerspruch, daß der Mann, dem
immer das Ganze vorschwebte, so ausschließlich für Hamburg arbeitete, so daß
sein Lebenswerk sich mit der Hamburger Kunsthalle beinahe deckt. Aus seinem
»festen Feld«, dem Museum, strömte ihm Sicherheit und Kraft. Etwas Wirkliches
und Tüchtiges kann man nur auf einem fest umgrenzten Boden leisten (vergleiche
Goethes Tätigkeit in Weimar). Der bloße Theoretiker besitzt alles und nichts. Wer
aber für Hamburg arbeitet, der arbeitet auch für Deutschland. Stünde in jeder
Stadt ein solcher Mann, so wäre die neue Kultur da. Insofern Lichtwarks unmittel-
bares Wirken freilich auf die Heimat beschränkt blieb, mußte er resignieren. Ein