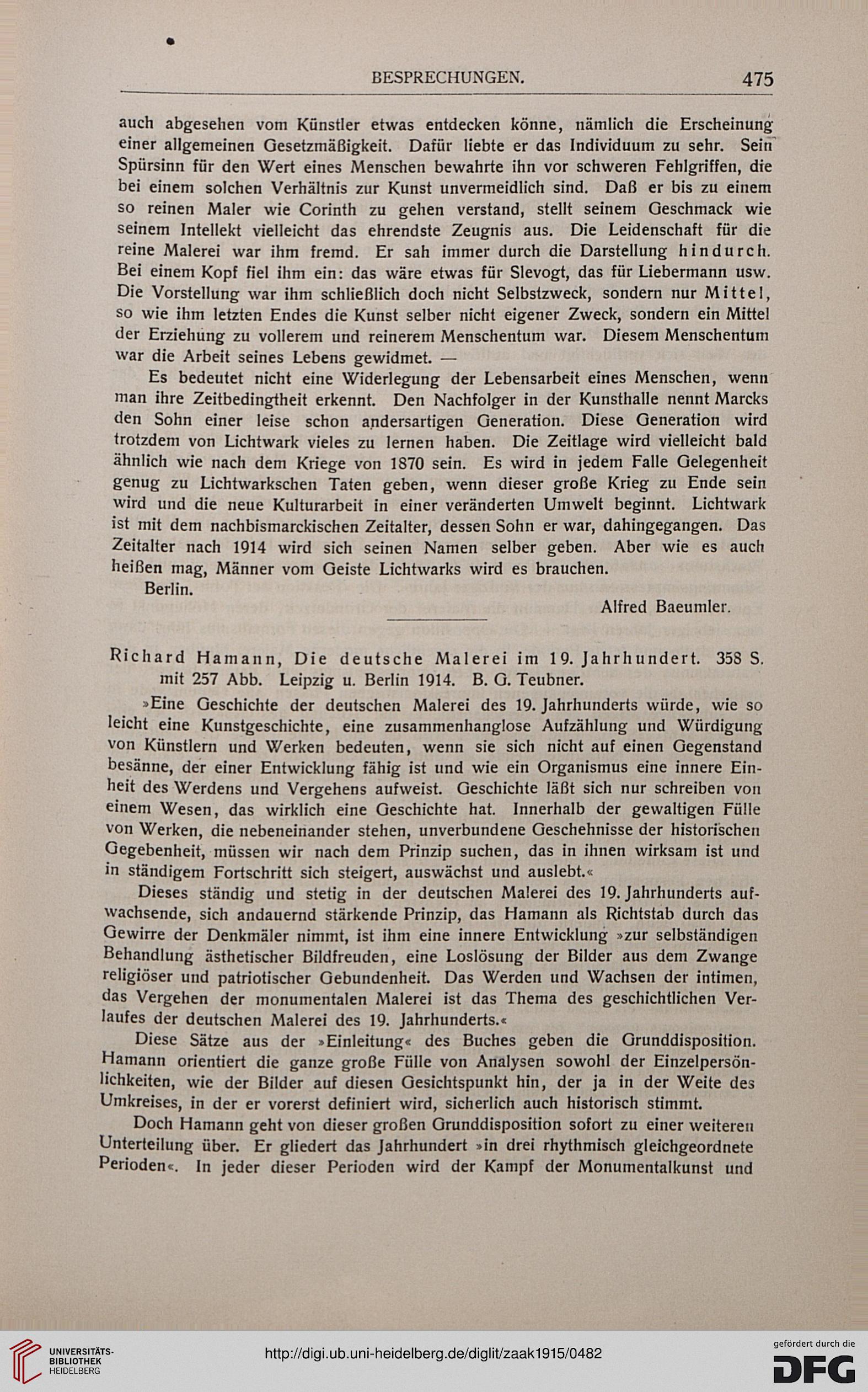BESPRECHUNGEN. 475
auch abgesehen vom Künstler etwas entdecken könne, nämlich die Erscheinung
einer allgemeinen Gesetzmäßigkeit. Dafür liebte er das Individuum zu sehr. Sein
Spürsinn für den Wert eines Menschen bewahrte ihn vor schweren Fehlgriffen, die
bei einem solchen Verhältnis zur Kunst unvermeidlich sind. Daß er bis zu einem
so reinen Maler wie Corinth zu gehen verstand, stellt seinem Geschmack wie
seinem Intellekt vielleicht das ehrendste Zeugnis aus. Die Leidenschaft für die
reine Malerei war ihm fremd. Er sah immer durch die Darstellung hindurch.
Bei einem Kopf fiel ihm ein: das wäre etwas für Slevogt, das für Liebermann usw.
Die Vorstellung war ihm schließlich doch nicht Selbstzweck, sondern nur Mittel,
so wie ihm letzten Endes die Kunst selber nicht eigener Zweck, sondern ein Mittel
der Erziehung zu vollerem und reinerem Menschentum war. Diesem Menschentum
war die Arbeit seines Lebens gewidmet. —
Es bedeutet nicht eine Widerlegung der Lebensarbeit eines Menschen, wenn
man ihre Zeitbedingtheit erkennt. Den Nachfolger in der Kunsthalle nennt Marcks
den Sohn einer leise schon andersartigen Generation. Diese Generation wird
trotzdem von Lichtwark vieles zu lernen haben. Die Zeitlage wird vielleicht bald
ähnlich wie nach dem Kriege von 1870 sein. Es wird in jedem Falle Gelegenheit
genug zu Lichtwarkschen Taten geben, wenn dieser große Krieg zu Ende sein
wird und die neue Kulturarbeit in einer veränderten Umwelt beginnt. Lichtwark
ist mit dem nachbismarckischen Zeitalter, dessen Sohn er war, dahingegangen. Das
Zeitalter nach 1914 wird sich seinen Namen selber geben. Aber wie es auch
heißen mag, Männer vom Geiste Lichtwarks wird es brauchen.
Berlin.
Alfred Baeumler.
Richard Hamann, Die deutsche Malerei im 19. Jahrhundert. 358 S.
mit 257 Abb. Leipzig u. Berlin 1914. B. G. Teubner.
»Eine Geschichte der deutschen Malerei des 19. Jahrhunderts würde, wie so
leicht eine Kunstgeschichte, eine zusammenhanglose Aufzählung und Würdigung
von Künstlern und Werken bedeuten, wenn sie sich nicht auf einen Gegenstand
besänne, der einer Entwicklung fähig ist und wie ein Organismus eine innere Ein-
heit des Werdens und Vergehens aufweist. Geschichte läßt sich nur schreiben von
einem Wesen, das wirklich eine Geschichte hat. Innerhalb der gewaltigen Fülle
von Werken, die nebeneinander stehen, unverbundene Geschehnisse der historischen
Gegebenheit, müssen wir nach dem Prinzip suchen, das in ihnen wirksam ist und
in ständigem Fortschritt sich steigert, auswächst und auslebt.«
Dieses ständig und stetig in der deutschen Malerei des 19. Jahrhunderts auf-
wachsende, sich andauernd stärkende Prinzip, das Hamann als Richtstab durch das
Gewirre der Denkmäler nimmt, ist ihm eine innere Entwicklung »zur selbständigen
Behandlung ästhetischer Bildfreuden, eine Loslösung der Bilder aus dem Zwange
religiöser und patriotischer Gebundenheit. Das Werden und Wachsen der intimen,
das Vergehen der monumentalen Malerei ist das Thema des geschichtlichen Ver-
laufes der deutschen Malerei des 19. Jahrhunderts.«
Diese Sätze aus der »Einleitung« des Buches geben die Grunddisposition.
Hamann orientiert die ganze große Fülle von Analysen sowohl der Einzelpersön-
lichkeiten, wie der Bilder auf diesen Gesichtspunkt hin, der ja in der Weite des
Umkreises, in der er vorerst definiert wird, sicherlich auch historisch stimmt.
Doch Hamann geht von dieser großen Grunddisposition sofort zu einer weiteren
Unterteilung über. Er gliedert das Jahrhundert »in drei rhythmisch gleichgeordnete
Perioden«:. In jeder dieser Perioden wird der Kampf der Monumentalkunst und
auch abgesehen vom Künstler etwas entdecken könne, nämlich die Erscheinung
einer allgemeinen Gesetzmäßigkeit. Dafür liebte er das Individuum zu sehr. Sein
Spürsinn für den Wert eines Menschen bewahrte ihn vor schweren Fehlgriffen, die
bei einem solchen Verhältnis zur Kunst unvermeidlich sind. Daß er bis zu einem
so reinen Maler wie Corinth zu gehen verstand, stellt seinem Geschmack wie
seinem Intellekt vielleicht das ehrendste Zeugnis aus. Die Leidenschaft für die
reine Malerei war ihm fremd. Er sah immer durch die Darstellung hindurch.
Bei einem Kopf fiel ihm ein: das wäre etwas für Slevogt, das für Liebermann usw.
Die Vorstellung war ihm schließlich doch nicht Selbstzweck, sondern nur Mittel,
so wie ihm letzten Endes die Kunst selber nicht eigener Zweck, sondern ein Mittel
der Erziehung zu vollerem und reinerem Menschentum war. Diesem Menschentum
war die Arbeit seines Lebens gewidmet. —
Es bedeutet nicht eine Widerlegung der Lebensarbeit eines Menschen, wenn
man ihre Zeitbedingtheit erkennt. Den Nachfolger in der Kunsthalle nennt Marcks
den Sohn einer leise schon andersartigen Generation. Diese Generation wird
trotzdem von Lichtwark vieles zu lernen haben. Die Zeitlage wird vielleicht bald
ähnlich wie nach dem Kriege von 1870 sein. Es wird in jedem Falle Gelegenheit
genug zu Lichtwarkschen Taten geben, wenn dieser große Krieg zu Ende sein
wird und die neue Kulturarbeit in einer veränderten Umwelt beginnt. Lichtwark
ist mit dem nachbismarckischen Zeitalter, dessen Sohn er war, dahingegangen. Das
Zeitalter nach 1914 wird sich seinen Namen selber geben. Aber wie es auch
heißen mag, Männer vom Geiste Lichtwarks wird es brauchen.
Berlin.
Alfred Baeumler.
Richard Hamann, Die deutsche Malerei im 19. Jahrhundert. 358 S.
mit 257 Abb. Leipzig u. Berlin 1914. B. G. Teubner.
»Eine Geschichte der deutschen Malerei des 19. Jahrhunderts würde, wie so
leicht eine Kunstgeschichte, eine zusammenhanglose Aufzählung und Würdigung
von Künstlern und Werken bedeuten, wenn sie sich nicht auf einen Gegenstand
besänne, der einer Entwicklung fähig ist und wie ein Organismus eine innere Ein-
heit des Werdens und Vergehens aufweist. Geschichte läßt sich nur schreiben von
einem Wesen, das wirklich eine Geschichte hat. Innerhalb der gewaltigen Fülle
von Werken, die nebeneinander stehen, unverbundene Geschehnisse der historischen
Gegebenheit, müssen wir nach dem Prinzip suchen, das in ihnen wirksam ist und
in ständigem Fortschritt sich steigert, auswächst und auslebt.«
Dieses ständig und stetig in der deutschen Malerei des 19. Jahrhunderts auf-
wachsende, sich andauernd stärkende Prinzip, das Hamann als Richtstab durch das
Gewirre der Denkmäler nimmt, ist ihm eine innere Entwicklung »zur selbständigen
Behandlung ästhetischer Bildfreuden, eine Loslösung der Bilder aus dem Zwange
religiöser und patriotischer Gebundenheit. Das Werden und Wachsen der intimen,
das Vergehen der monumentalen Malerei ist das Thema des geschichtlichen Ver-
laufes der deutschen Malerei des 19. Jahrhunderts.«
Diese Sätze aus der »Einleitung« des Buches geben die Grunddisposition.
Hamann orientiert die ganze große Fülle von Analysen sowohl der Einzelpersön-
lichkeiten, wie der Bilder auf diesen Gesichtspunkt hin, der ja in der Weite des
Umkreises, in der er vorerst definiert wird, sicherlich auch historisch stimmt.
Doch Hamann geht von dieser großen Grunddisposition sofort zu einer weiteren
Unterteilung über. Er gliedert das Jahrhundert »in drei rhythmisch gleichgeordnete
Perioden«:. In jeder dieser Perioden wird der Kampf der Monumentalkunst und