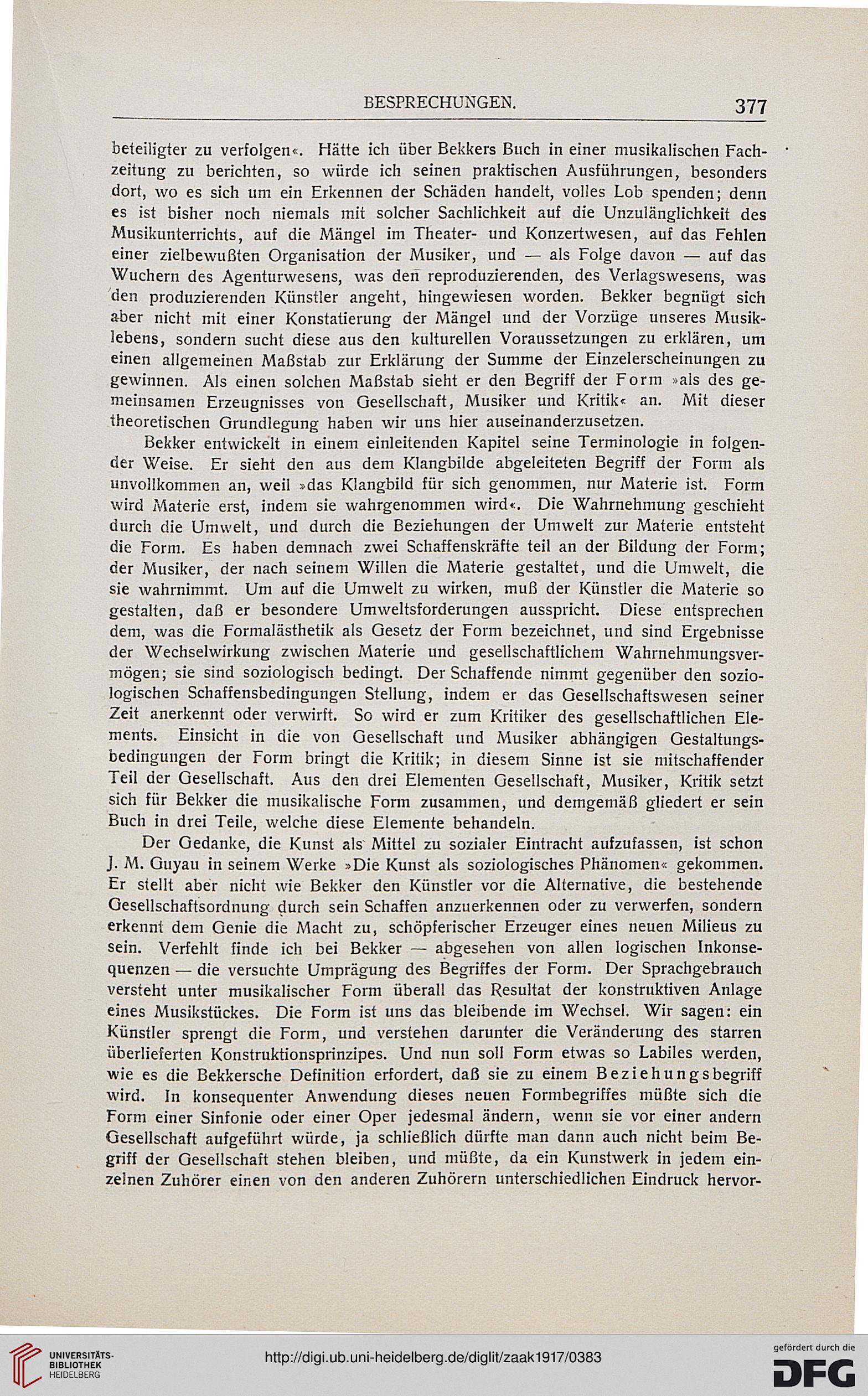BESPRECHUNGEN. 377
beteiligter zu verfolgen«. Hätte ich über Bekkers Buch in einer musikalischen Fach-
zeitung zu berichten, so würde ich seinen praktischen Ausführungen, besonders
dort, wo es sich um ein Erkennen der Schäden handelt, volles Lob spenden; denn
es ist bisher noch niemals mit solcher Sachlichkeit auf die Unzulänglichkeit des
Musikunterrichts, auf die Mängel im Theater- und Konzertwesen, auf das Fehlen
einer zielbewußten Organisation der Musiker, und — als Folge davon — auf das
Wuchern des Agenturwesens, was den reproduzierenden, des Verlagswesens, was
den produzierenden Künstler angeht, hingewiesen worden. Bekker begnügt sich
aber nicht mit einer Konstatierung der Mängel und der Vorzüge unseres Musik-
lebens, sondern sucht diese aus den kulturellen Voraussetzungen zu erklären, um
einen allgemeinen Maßstab zur Erklärung der Summe der Einzelerscheinungen zu
gewinnen. Als einen solchen Maßstab sieht er den Begriff der Form »als des ge-
meinsamen Erzeugnisses von Gesellschaft, Musiker und Kritik« an. Mit dieser
theoretischen Grundlegung haben wir uns hier auseinanderzusetzen.
Bekker entwickelt in einem einleitenden Kapitel seine Terminologie in folgen-
der Weise. Er sieht den aus dem Klangbilde abgeleiteten Begriff der Form als
unvollkommen an, weil »das Klangbild für sich genommen, nur Materie ist. Form
wird Materie erst, indem sie wahrgenommen wird«:. Die Wahrnehmung geschieht
durch die Umwelt, und durch die Beziehungen der Umwelt zur Materie entsteht
die Form. Es haben demnach zwei Schaffenskräfte teil an der Bildung der Form;
der Musiker, der nach seinem Willen die Materie gestaltet, und die Umwelt, die
sie wahrnimmt. Um auf die Umwelt zu wirken, muß der Künstler die Materie so
gestalten, daß er besondere Umweltsforderungen ausspricht. Diese entsprechen
dem, was die Formalästhetik als Gesetz der Form bezeichnet, und sind Ergebnisse
der Wechselwirkung zwischen Materie und gesellschaftlichem Wahrnehmungsver-
mögen; sie sind soziologisch bedingt. Der Schaffende nimmt gegenüber den sozio-
logischen Schaffensbedingungen Stellung, indem er das Gesellschaftswesen seiner
Zeit anerkennt oder verwirft. So wird er zum Kritiker des gesellschaftlichen Ele-
ments. Einsicht in die von Gesellschaft und Musiker abhängigen Gestaltungs-
bedingungen der Form bringt die Kritik; in diesem Sinne ist sie mitschaffender
Teil der Gesellschaft. Aus den drei Elementen Gesellschaft, Musiker, Kritik setzt
sich für Bekker die musikalische Form zusammen, und demgemäß gliedert er sein
Buch in drei Teile, welche diese Elemente behandeln.
Der Gedanke, die Kunst als Mittel zu sozialer Eintracht aufzufassen, ist schon
J. M. Guyau in seinem Werke »Die Kunst als soziologisches Phänomen.: gekommen.
Er stellt aber nicht wie Bekker den Künstler vor die Alternative, die bestehende
Gesellschaftsordnung durch sein Schaffen anzuerkennen oder zu verwerfen, sondern
erkennt dem Genie die Macht zu, schöpferischer Erzeuger eines neuen Milieus zu
sein. Verfehlt finde ich bei Bekker — abgesehen von allen logischen Inkonse-
quenzen — die versuchte Umprägung des Begriffes der Form. Der Sprachgebrauch
versteht unter musikalischer Form überall das Resultat der konstruktiven Anlage
eines Musikstückes. Die Form ist uns das bleibende im Wechsel. Wir sagen: ein
Künstler sprengt die Form, und verstehen darunter die Veränderung des starren
überlieferten Konstruktionsprinzipes. Und nun soll Form etwas so Labiles werden,
wie es die Bekkersche Definition erfordert, daß sie zu einem Beziehungsbegriff
wird. In konsequenter Anwendung dieses neuen Formbegriffes müßte sich die
Form einer Sinfonie oder einer Oper jedesmal ändern, wenn sie vor einer andern
Gesellschaft aufgeführt würde, ja schließlich dürfte man dann auch nicht beim Be-
griff der Gesellschaft stehen bleiben, und müßte, da ein Kunstwerk in jedem ein-
zelnen Zuhörer einen von den anderen Zuhörern unterschiedlichen Eindruck hervor-
beteiligter zu verfolgen«. Hätte ich über Bekkers Buch in einer musikalischen Fach-
zeitung zu berichten, so würde ich seinen praktischen Ausführungen, besonders
dort, wo es sich um ein Erkennen der Schäden handelt, volles Lob spenden; denn
es ist bisher noch niemals mit solcher Sachlichkeit auf die Unzulänglichkeit des
Musikunterrichts, auf die Mängel im Theater- und Konzertwesen, auf das Fehlen
einer zielbewußten Organisation der Musiker, und — als Folge davon — auf das
Wuchern des Agenturwesens, was den reproduzierenden, des Verlagswesens, was
den produzierenden Künstler angeht, hingewiesen worden. Bekker begnügt sich
aber nicht mit einer Konstatierung der Mängel und der Vorzüge unseres Musik-
lebens, sondern sucht diese aus den kulturellen Voraussetzungen zu erklären, um
einen allgemeinen Maßstab zur Erklärung der Summe der Einzelerscheinungen zu
gewinnen. Als einen solchen Maßstab sieht er den Begriff der Form »als des ge-
meinsamen Erzeugnisses von Gesellschaft, Musiker und Kritik« an. Mit dieser
theoretischen Grundlegung haben wir uns hier auseinanderzusetzen.
Bekker entwickelt in einem einleitenden Kapitel seine Terminologie in folgen-
der Weise. Er sieht den aus dem Klangbilde abgeleiteten Begriff der Form als
unvollkommen an, weil »das Klangbild für sich genommen, nur Materie ist. Form
wird Materie erst, indem sie wahrgenommen wird«:. Die Wahrnehmung geschieht
durch die Umwelt, und durch die Beziehungen der Umwelt zur Materie entsteht
die Form. Es haben demnach zwei Schaffenskräfte teil an der Bildung der Form;
der Musiker, der nach seinem Willen die Materie gestaltet, und die Umwelt, die
sie wahrnimmt. Um auf die Umwelt zu wirken, muß der Künstler die Materie so
gestalten, daß er besondere Umweltsforderungen ausspricht. Diese entsprechen
dem, was die Formalästhetik als Gesetz der Form bezeichnet, und sind Ergebnisse
der Wechselwirkung zwischen Materie und gesellschaftlichem Wahrnehmungsver-
mögen; sie sind soziologisch bedingt. Der Schaffende nimmt gegenüber den sozio-
logischen Schaffensbedingungen Stellung, indem er das Gesellschaftswesen seiner
Zeit anerkennt oder verwirft. So wird er zum Kritiker des gesellschaftlichen Ele-
ments. Einsicht in die von Gesellschaft und Musiker abhängigen Gestaltungs-
bedingungen der Form bringt die Kritik; in diesem Sinne ist sie mitschaffender
Teil der Gesellschaft. Aus den drei Elementen Gesellschaft, Musiker, Kritik setzt
sich für Bekker die musikalische Form zusammen, und demgemäß gliedert er sein
Buch in drei Teile, welche diese Elemente behandeln.
Der Gedanke, die Kunst als Mittel zu sozialer Eintracht aufzufassen, ist schon
J. M. Guyau in seinem Werke »Die Kunst als soziologisches Phänomen.: gekommen.
Er stellt aber nicht wie Bekker den Künstler vor die Alternative, die bestehende
Gesellschaftsordnung durch sein Schaffen anzuerkennen oder zu verwerfen, sondern
erkennt dem Genie die Macht zu, schöpferischer Erzeuger eines neuen Milieus zu
sein. Verfehlt finde ich bei Bekker — abgesehen von allen logischen Inkonse-
quenzen — die versuchte Umprägung des Begriffes der Form. Der Sprachgebrauch
versteht unter musikalischer Form überall das Resultat der konstruktiven Anlage
eines Musikstückes. Die Form ist uns das bleibende im Wechsel. Wir sagen: ein
Künstler sprengt die Form, und verstehen darunter die Veränderung des starren
überlieferten Konstruktionsprinzipes. Und nun soll Form etwas so Labiles werden,
wie es die Bekkersche Definition erfordert, daß sie zu einem Beziehungsbegriff
wird. In konsequenter Anwendung dieses neuen Formbegriffes müßte sich die
Form einer Sinfonie oder einer Oper jedesmal ändern, wenn sie vor einer andern
Gesellschaft aufgeführt würde, ja schließlich dürfte man dann auch nicht beim Be-
griff der Gesellschaft stehen bleiben, und müßte, da ein Kunstwerk in jedem ein-
zelnen Zuhörer einen von den anderen Zuhörern unterschiedlichen Eindruck hervor-