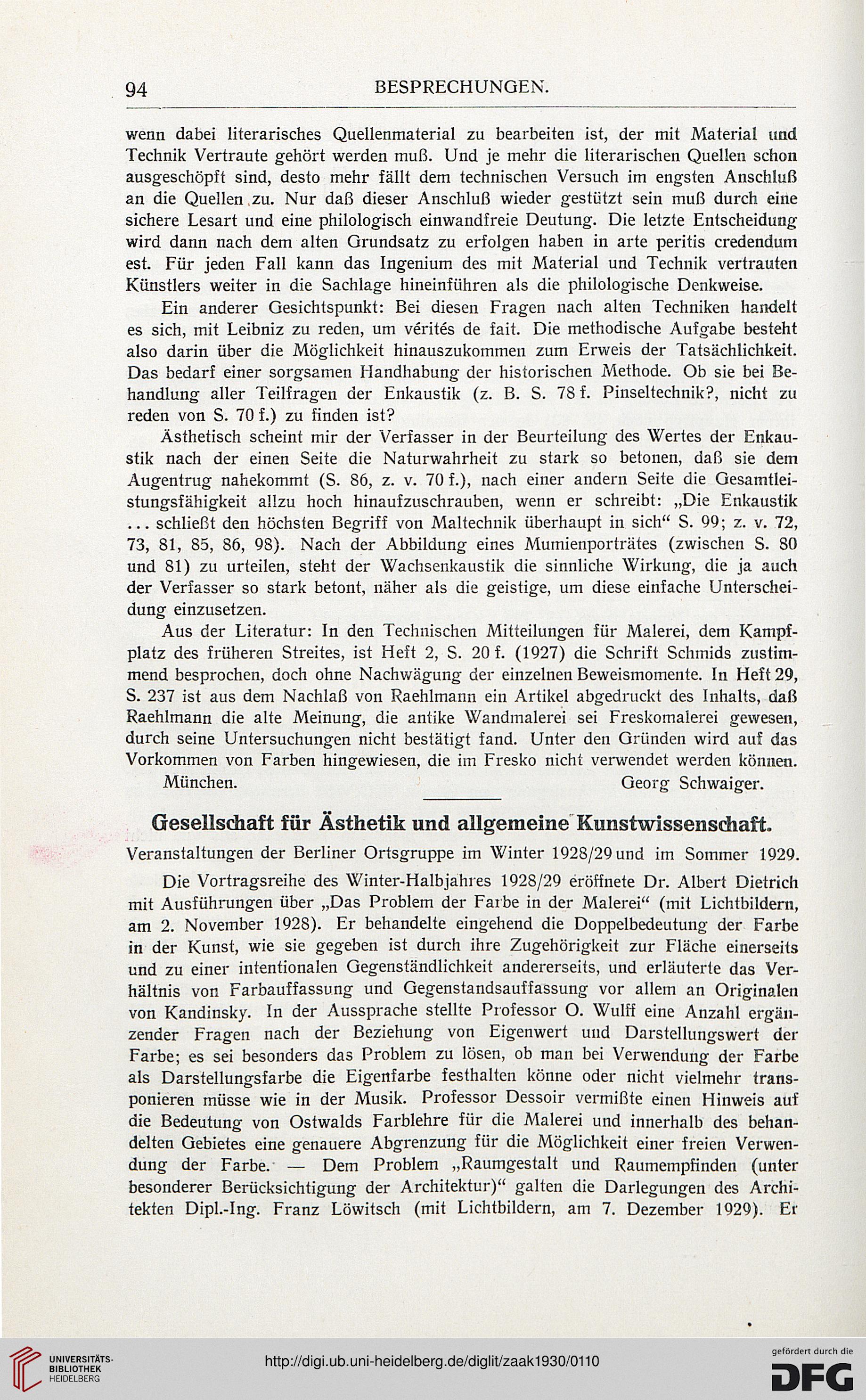94
BESPRECHUNGEN.
wenn dabei literarisches Quellenmaterial zu bearbeiten ist, der mit Material und
Technik Vertraute gehört werden muß. Und je mehr die literarischen Quellen schon
ausgeschöpft sind, desto mehr fällt dem technischen Versuch im engsten Anschluß
an die Quellen , zu. Nur daß dieser Anschluß wieder gestützt sein muß durch eine
sichere Lesart und eine philologisch einwandfreie Deutung. Die letzte Entscheidung
wird dann nach dem alten Grundsatz zu erfolgen haben in arte peritis credendum
est. Für jeden Fall kann das Ingenium des mit Material und Technik vertrauten
Künstlers weiter in die Sachlage hineinführen als die philologische Denkweise.
Ein anderer Gesichtspunkt: Bei diesen Fragen nach alten Techniken handelt
es sich, mit Leibniz zu reden, um verites de fait. Die methodische Aufgabe besteht
also darin über die Möglichkeit hinauszukommen zum Erweis der Tatsächlichkeit.
Das bedarf einer sorgsamen Handhabung der historischen Methode. Ob sie bei Be-
handlung aller Teilfragen der Enkaustik (z. B. S. 78 f. Pinseltechnik?, nicht zu
reden von S. 70 f.) zu finden ist?
Ästhetisch scheint mir der Verfasser in der Beurteilung des Wertes der Enkau-
stik nach der einen Seite die Naturwahrheit zu stark so betonen, daß sie dem
Augentrug nahekommt (S. 86, z. v. 70 f.), nach einer andern Seite die Gesamtlei-
stungsfähigkeit allzu hoch hinaufzuschrauben, wenn er schreibt: „Die Enkaustik
... schließt den höchsten Begriff von Maltechnik überhaupt in sich" S. 99; z. v. 72,
73, 81, 85, 86, 98). Nach der Abbildung eines Mumienporträtes (zwischen S. 80
und 81) zu urteilen, steht der Wachsenkaustik die sinnliche Wirkung, die ja auch
der Verfasser so stark betont, näher als die geistige, um diese einfache Unterschei-
dung einzusetzen.
Aus der Literatur: In den Technischen Mitteilungen für Malerei, dem Kampf-
platz des früheren Streites, ist Heft 2, S. 20 f. (1927) die Schrift Schmids zustim-
mend besprochen, doch ohne Nachwägung der einzelnen Beweismomente. In Heft 29,
S. 237 ist aus dem Nachlaß von Raehlmann ein Artikel abgedruckt des Inhalts, daß
Raehlmann die alte Meinung, die antike Wandmalerei sei Freskomalerei gewesen,
durch seine Untersuchungen nicht bestätigt fand. Unter den Gründen wird auf das
Vorkommen von Farben hingewiesen, die im Fresko nicht verwendet werden können.
München. Georg Schwaiger.
Gesellschaft für Ästhetik und allgemeine Kunstwissenschaft.
Veranstaltungen der Berliner Ortsgruppe im Winter 1928/29 und im Sommer 1929.
Die Vortragsreihe des Winter-Halbjahres 1928/29 eröffnete Dr. Albert Dietrich
mit Ausführungen über „Das Problem der Farbe in der Malerei" (mit Lichtbildern,
am 2. November 1928). Er behandelte eingehend die Doppelbedeutung der Farbe
in der Kunst, wie sie gegeben ist durch ihre Zugehörigkeit zur Fläche einerseits
und zu einer intentionalen Gegenständlichkeit andererseits, und erläuterte das Ver-
hältnis von Farbauffassung und Gegenstandsauffassung vor allem an Originalen
von Kandinsky. In der Aussprache stellte Professor O. Wulff eine Anzahl ergän-
zender Fragen nach der Beziehung von Eigenwert und Darstellungswert der
Farbe; es sei besonders das Problem zu lösen, ob man bei Verwendung der Farbe
als Darstellungsfarbe die Eigenfarbe festhalten könne oder nicht vielmehr trans-
ponieren müsse wie in der Musik. Professor Dessoir vermißte einen Hinweis auf
die Bedeutung von Ostwalds Farblehre für die Malerei und innerhalb des behan-
delten Gebietes eine genauere Abgrenzung für die Möglichkeit einer freien Verwen-
dung der Farbe. — Dem Problem „Raumgestalt und Raumempfinden (unter
besonderer Berücksichtigung der Architektur)" galten die Darlegungen des Archi-
tekten Dipl.-Ing. Franz Löwitsch (mit Lichtbildern, am 7. Dezember 1929). Er
BESPRECHUNGEN.
wenn dabei literarisches Quellenmaterial zu bearbeiten ist, der mit Material und
Technik Vertraute gehört werden muß. Und je mehr die literarischen Quellen schon
ausgeschöpft sind, desto mehr fällt dem technischen Versuch im engsten Anschluß
an die Quellen , zu. Nur daß dieser Anschluß wieder gestützt sein muß durch eine
sichere Lesart und eine philologisch einwandfreie Deutung. Die letzte Entscheidung
wird dann nach dem alten Grundsatz zu erfolgen haben in arte peritis credendum
est. Für jeden Fall kann das Ingenium des mit Material und Technik vertrauten
Künstlers weiter in die Sachlage hineinführen als die philologische Denkweise.
Ein anderer Gesichtspunkt: Bei diesen Fragen nach alten Techniken handelt
es sich, mit Leibniz zu reden, um verites de fait. Die methodische Aufgabe besteht
also darin über die Möglichkeit hinauszukommen zum Erweis der Tatsächlichkeit.
Das bedarf einer sorgsamen Handhabung der historischen Methode. Ob sie bei Be-
handlung aller Teilfragen der Enkaustik (z. B. S. 78 f. Pinseltechnik?, nicht zu
reden von S. 70 f.) zu finden ist?
Ästhetisch scheint mir der Verfasser in der Beurteilung des Wertes der Enkau-
stik nach der einen Seite die Naturwahrheit zu stark so betonen, daß sie dem
Augentrug nahekommt (S. 86, z. v. 70 f.), nach einer andern Seite die Gesamtlei-
stungsfähigkeit allzu hoch hinaufzuschrauben, wenn er schreibt: „Die Enkaustik
... schließt den höchsten Begriff von Maltechnik überhaupt in sich" S. 99; z. v. 72,
73, 81, 85, 86, 98). Nach der Abbildung eines Mumienporträtes (zwischen S. 80
und 81) zu urteilen, steht der Wachsenkaustik die sinnliche Wirkung, die ja auch
der Verfasser so stark betont, näher als die geistige, um diese einfache Unterschei-
dung einzusetzen.
Aus der Literatur: In den Technischen Mitteilungen für Malerei, dem Kampf-
platz des früheren Streites, ist Heft 2, S. 20 f. (1927) die Schrift Schmids zustim-
mend besprochen, doch ohne Nachwägung der einzelnen Beweismomente. In Heft 29,
S. 237 ist aus dem Nachlaß von Raehlmann ein Artikel abgedruckt des Inhalts, daß
Raehlmann die alte Meinung, die antike Wandmalerei sei Freskomalerei gewesen,
durch seine Untersuchungen nicht bestätigt fand. Unter den Gründen wird auf das
Vorkommen von Farben hingewiesen, die im Fresko nicht verwendet werden können.
München. Georg Schwaiger.
Gesellschaft für Ästhetik und allgemeine Kunstwissenschaft.
Veranstaltungen der Berliner Ortsgruppe im Winter 1928/29 und im Sommer 1929.
Die Vortragsreihe des Winter-Halbjahres 1928/29 eröffnete Dr. Albert Dietrich
mit Ausführungen über „Das Problem der Farbe in der Malerei" (mit Lichtbildern,
am 2. November 1928). Er behandelte eingehend die Doppelbedeutung der Farbe
in der Kunst, wie sie gegeben ist durch ihre Zugehörigkeit zur Fläche einerseits
und zu einer intentionalen Gegenständlichkeit andererseits, und erläuterte das Ver-
hältnis von Farbauffassung und Gegenstandsauffassung vor allem an Originalen
von Kandinsky. In der Aussprache stellte Professor O. Wulff eine Anzahl ergän-
zender Fragen nach der Beziehung von Eigenwert und Darstellungswert der
Farbe; es sei besonders das Problem zu lösen, ob man bei Verwendung der Farbe
als Darstellungsfarbe die Eigenfarbe festhalten könne oder nicht vielmehr trans-
ponieren müsse wie in der Musik. Professor Dessoir vermißte einen Hinweis auf
die Bedeutung von Ostwalds Farblehre für die Malerei und innerhalb des behan-
delten Gebietes eine genauere Abgrenzung für die Möglichkeit einer freien Verwen-
dung der Farbe. — Dem Problem „Raumgestalt und Raumempfinden (unter
besonderer Berücksichtigung der Architektur)" galten die Darlegungen des Archi-
tekten Dipl.-Ing. Franz Löwitsch (mit Lichtbildern, am 7. Dezember 1929). Er