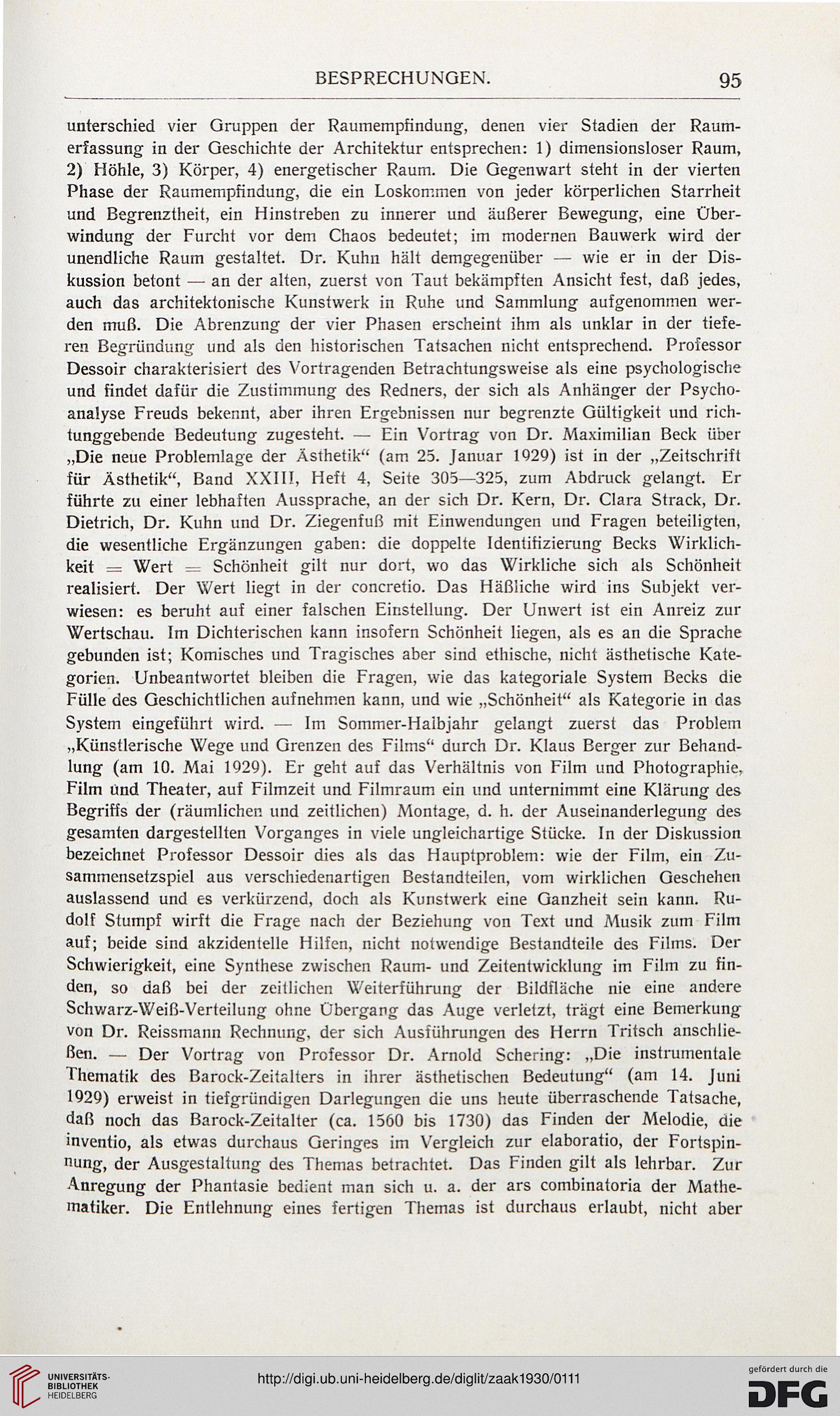BESPRECHUNGEN.
95
unterschied vier Gruppen der Raumempfindung, denen vier Stadien der Raum-
erfassung in der Geschichte der Architektur entsprechen: 1) dimensionsloser Raum,
2) Höhle, 3) Körper, 4) energetischer Raum. Die Gegenwart steht in der vierten
Phase der Raumempfindung, die ein Loskommen von jeder körperlichen Starrheit
und Begrenztheit, ein Hinstreben zu innerer und äußerer Bewegung, eine Über-
windung der Furcht vor dem Chaos bedeutet; im modernen Bauwerk wird der
unendliche Raum gestaltet. Dr. Kuhn hält demgegenüber — wie er in der Dis-
kussion betont — an der alten, zuerst von Taut bekämpften Ansicht fest, daß jedes,
auch das architektonische Kunstwerk in Ruhe und Sammlung aufgenommen wer-
den muß. Die Abrenzung der vier Phasen erscheint ihm als unklar in der tiefe-
ren Begründung und als den historischen Tatsachen nicht entsprechend. Professor
Dessoir charakterisiert des Vortragenden Betrachtungsweise als eine psychologische
und findet dafür die Zustimmung des Redners, der sich als Anhänger der Psycho-
analyse Freuds bekennt, aber ihren Ergebnissen nur begrenzte Gültigkeit und rich-
tunggebende Bedeutung zugesteht. — Ein Vortrag von Dr. Maximilian Beck über
„Die neue Problemlage der Ästhetik" (am 25. Januar 1929) ist in der „Zeitschrift
für Ästhetik", Band XXIII, Heft 4, Seite 305—325, zum Abdruck gelangt. Er
führte zu einer lebhaften Aussprache, an der sich Dr. Kern, Dr. Clara Strack, Dr.
Dietrich, Dr. Kuhn und Dr. Ziegenfuß mit Einwendungen und Fragen beteiligten,
die wesentliche Ergänzungen gaben: die doppelte Identifizierung Becks Wirklich-
keit = Wert = Schönheit gilt nur dort, wo das Wirkliche sich als Schönheit
realisiert. Der Wert liegt in der concretio. Das Häßliche wird ins Subjekt ver-
wiesen: es beruht auf einer falschen Einstellung. Der Unwert ist ein Anreiz zur
Wertschau. Im Dichterischen kann insofern Schönheit liegen, als es an die Sprache
gebunden ist; Komisches und Tragisches aber sind ethische, nicht ästhetische Kate-
gorien. Unbeantwortet bleiben die Fragen, wie das kategoriale System Becks die
Fülle des Geschichtlichen aufnehmen kann, und wie „Schönheit" als Kategorie in das
System eingeführt wird. — Im Sommer-Halbjahr gelangt zuerst das Problem
„Künstlerische Wege und Grenzen des Films" durch Dr. Klaus Berger zur Behand-
lung (am 10. Mai 1929). Er geht auf das Verhältnis von Film und Photographie,
Film und Theater, auf Filmzeit und Filmraum ein und unternimmt eine Klärung des
Begriffs der (räumlichen und zeitlichen) Montage, d. h. der Auseinanderlegung des
gesamten dargestellten Vorganges in viele ungleichartige Stücke. In der Diskussion
bezeichnet Professor Dessoir dies als das Hauptproblem: wie der Film, ein Zu-
sammensetzspiel aus verschiedenartigen Bestandteilen, vom wirklichen Geschehen
auslassend und es verkürzend, doch als Kunstwerk eine Ganzheit sein kann. Ru-
dolf Stumpf wirft die Frage nach der Beziehung von Text und Musik zum Film
auf; beide sind akzidentelle Hilfen, nicht notwendige Bestandteile des Films. Der
Schwierigkeit, eine Synthese zwischen Raum- und Zeitentwicklung im Film zu fin-
den, so daß bei der zeitlichen Weiterführung der Bildfläche nie eine andere
Schwarz-Weiß-Verteilung ohne Übergang das Auge verletzt, trägt eine Bemerkung
von Dr. Reissmann Rechnung, der sich Ausführungen des Herrn Tritsch anschlie-
ßen. — Der Vortrag von Professor Dr. Arnold Schering: „Die instrumentale
Thematik des Barock-Zeitalters in ihrer ästhetischen Bedeutung" (am 14. Juni
1929) erweist in tiefgründigen Darlegungen die uns heute überraschende Tatsache,
daß noch das Barock-Zeitalter (ca. 1560 bis 1730) das Finden der Melodie, die
inventio, als etwas durchaus Geringes im Vergleich zur elaboratio, der Fortspin-
nung, der Ausgestaltung des Themas betrachtet. Das Finden gilt als lehrbar. Zur
Anregung der Phantasie bedient man sich u. a. der ars combinatoria der Mathe-
matiker. Die Entlehnung eines fertigen Themas ist durchaus erlaubt, nicht aber
95
unterschied vier Gruppen der Raumempfindung, denen vier Stadien der Raum-
erfassung in der Geschichte der Architektur entsprechen: 1) dimensionsloser Raum,
2) Höhle, 3) Körper, 4) energetischer Raum. Die Gegenwart steht in der vierten
Phase der Raumempfindung, die ein Loskommen von jeder körperlichen Starrheit
und Begrenztheit, ein Hinstreben zu innerer und äußerer Bewegung, eine Über-
windung der Furcht vor dem Chaos bedeutet; im modernen Bauwerk wird der
unendliche Raum gestaltet. Dr. Kuhn hält demgegenüber — wie er in der Dis-
kussion betont — an der alten, zuerst von Taut bekämpften Ansicht fest, daß jedes,
auch das architektonische Kunstwerk in Ruhe und Sammlung aufgenommen wer-
den muß. Die Abrenzung der vier Phasen erscheint ihm als unklar in der tiefe-
ren Begründung und als den historischen Tatsachen nicht entsprechend. Professor
Dessoir charakterisiert des Vortragenden Betrachtungsweise als eine psychologische
und findet dafür die Zustimmung des Redners, der sich als Anhänger der Psycho-
analyse Freuds bekennt, aber ihren Ergebnissen nur begrenzte Gültigkeit und rich-
tunggebende Bedeutung zugesteht. — Ein Vortrag von Dr. Maximilian Beck über
„Die neue Problemlage der Ästhetik" (am 25. Januar 1929) ist in der „Zeitschrift
für Ästhetik", Band XXIII, Heft 4, Seite 305—325, zum Abdruck gelangt. Er
führte zu einer lebhaften Aussprache, an der sich Dr. Kern, Dr. Clara Strack, Dr.
Dietrich, Dr. Kuhn und Dr. Ziegenfuß mit Einwendungen und Fragen beteiligten,
die wesentliche Ergänzungen gaben: die doppelte Identifizierung Becks Wirklich-
keit = Wert = Schönheit gilt nur dort, wo das Wirkliche sich als Schönheit
realisiert. Der Wert liegt in der concretio. Das Häßliche wird ins Subjekt ver-
wiesen: es beruht auf einer falschen Einstellung. Der Unwert ist ein Anreiz zur
Wertschau. Im Dichterischen kann insofern Schönheit liegen, als es an die Sprache
gebunden ist; Komisches und Tragisches aber sind ethische, nicht ästhetische Kate-
gorien. Unbeantwortet bleiben die Fragen, wie das kategoriale System Becks die
Fülle des Geschichtlichen aufnehmen kann, und wie „Schönheit" als Kategorie in das
System eingeführt wird. — Im Sommer-Halbjahr gelangt zuerst das Problem
„Künstlerische Wege und Grenzen des Films" durch Dr. Klaus Berger zur Behand-
lung (am 10. Mai 1929). Er geht auf das Verhältnis von Film und Photographie,
Film und Theater, auf Filmzeit und Filmraum ein und unternimmt eine Klärung des
Begriffs der (räumlichen und zeitlichen) Montage, d. h. der Auseinanderlegung des
gesamten dargestellten Vorganges in viele ungleichartige Stücke. In der Diskussion
bezeichnet Professor Dessoir dies als das Hauptproblem: wie der Film, ein Zu-
sammensetzspiel aus verschiedenartigen Bestandteilen, vom wirklichen Geschehen
auslassend und es verkürzend, doch als Kunstwerk eine Ganzheit sein kann. Ru-
dolf Stumpf wirft die Frage nach der Beziehung von Text und Musik zum Film
auf; beide sind akzidentelle Hilfen, nicht notwendige Bestandteile des Films. Der
Schwierigkeit, eine Synthese zwischen Raum- und Zeitentwicklung im Film zu fin-
den, so daß bei der zeitlichen Weiterführung der Bildfläche nie eine andere
Schwarz-Weiß-Verteilung ohne Übergang das Auge verletzt, trägt eine Bemerkung
von Dr. Reissmann Rechnung, der sich Ausführungen des Herrn Tritsch anschlie-
ßen. — Der Vortrag von Professor Dr. Arnold Schering: „Die instrumentale
Thematik des Barock-Zeitalters in ihrer ästhetischen Bedeutung" (am 14. Juni
1929) erweist in tiefgründigen Darlegungen die uns heute überraschende Tatsache,
daß noch das Barock-Zeitalter (ca. 1560 bis 1730) das Finden der Melodie, die
inventio, als etwas durchaus Geringes im Vergleich zur elaboratio, der Fortspin-
nung, der Ausgestaltung des Themas betrachtet. Das Finden gilt als lehrbar. Zur
Anregung der Phantasie bedient man sich u. a. der ars combinatoria der Mathe-
matiker. Die Entlehnung eines fertigen Themas ist durchaus erlaubt, nicht aber