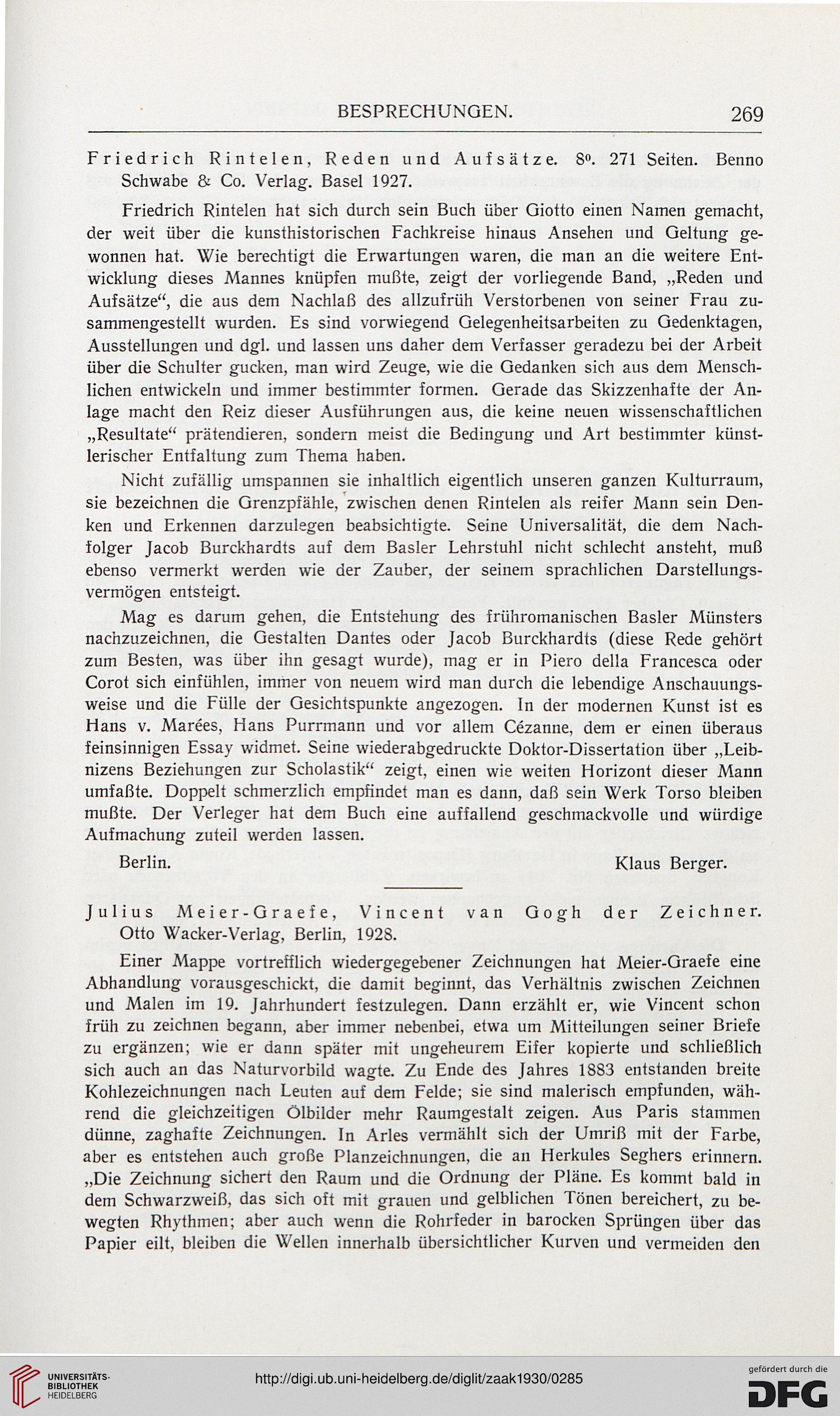BESPRECHUNGEN.
269
Friedrich Rintelen, Reden und Aufsätze. 8°. 271 Seiten. Benno
Schwabe & Co. Verlag. Basel 1927.
Friedrich Rintelen hat sich durch sein Buch über Giotto einen Namen gemacht,
der weit über die kunsthistorischen Fachkreise hinaus Ansehen und Geltung ge-
wonnen hat. Wie berechtigt die Erwartungen waren, die man an die weitere Ent-
wicklung dieses Mannes knüpfen mußte, zeigt der vorliegende Band, „Reden und
Aufsätze", die aus dem Nachlaß des allzufrüh Verstorbenen von seiner Frau zu-
sammengestellt wurden. Es sind vorwiegend Gelegenheitsarbeiten zu Gedenktagen,
Ausstellungen und dgl. und lassen uns daher dem Verfasser geradezu bei der Arbeit
über die Schulter gucken, man wird Zeuge, wie die Gedanken sich aus dem Mensch-
lichen entwickeln und immer bestimmter formen. Gerade das Skizzenhafte der An-
lage macht den Reiz dieser Ausführungen aus, die keine neuen wissenschaftlichen
„Resultate" prätendieren, sondern meist die Bedingung und Art bestimmter künst-
lerischer Entfaltung zum Thema haben.
Nicht zufällig umspannen sie inhaltlich eigentlich unseren ganzen Kulturraum,
sie bezeichnen die Grenzpfähle, zwischen denen Rintelen als reifer Mann sein Den-
ken und Erkennen darzulegen beabsichtigte. Seine Universalität, die dem Nach-
folger Jacob Burckhardts auf dem Basler Lehrstuhl nicht schlecht ansteht, muß
ebenso vermerkt werden wie der Zauber, der seinem sprachlichen Darstellungs-
vermögen entsteigt.
Mag es darum gehen, die Entstehung des frühromanischen Basler Münsters
nachzuzeichnen, die Gestalten Dantes oder Jacob Burckhardts (diese Rede gehört
zum Besten, was über ihn gesagt wurde), mag er in Piero della Francesca oder
Corot sich einfühlen, immer von neuem wird man durch die lebendige Anschauungs-
weise und die Fülle der Gesichtspunkte angezogen. In der modernen Kunst ist es
Hans v. Marees, Hans Purrmann und vor allem Cezanne, dem er einen überaus
feinsinnigen Essay widmet. Seine wiederabgedruckte Doktor-Dissertation über „Leib-
nizens Beziehungen zur Scholastik" zeigt, einen wie weiten Horizont dieser Mann
umfaßte. Doppelt schmerzlich empfindet man es dann, daß sein Werk Torso bleiben
mußte. Der Verleger hat dem Buch eine auffallend geschmackvolle und würdige
Aufmachung zuteil werden lassen.
Berlin. Klaus Berger.
Julius Meier-Graefe, Vincent van Gogh der Zeichner.
Otto Wacker-Verlag, Berlin, 1928.
Einer Mappe vortrefflich wiedergegebener Zeichnungen hat Meier-Graefe eine
Abhandlung vorausgeschickt, die damit beginnt, das Verhältnis zwischen Zeichnen
und Malen im 19. Jahrhundert festzulegen. Dann erzählt er, wie Vincent schon
früh zu zeichnen begann, aber immer nebenbei, etwa um Mitteilungen seiner Briefe
zu ergänzen; wie er dann später mit ungeheurem Eifer kopierte und schließlich
sich auch an das Naturvorbild wagte. Zu Ende des Jahres 1883 entstanden breite
Kohlezeichnungen nach Leuten auf dem Felde; sie sind malerisch empfunden, wäh-
rend die gleichzeitigen Ölbilder mehr Raumgestalt zeigen. Aus Paris stammen
dünne, zaghafte Zeichnungen. In Arles vermählt sich der Umriß mit der Farbe,
aber es entstehen auch große Planzeichnungen, die an Herkules Seghers erinnern.
„Die Zeichnung sichert den Raum und die Ordnung der Pläne. Es kommt bald in
dem Schwarzweiß, das sich oft mit grauen und gelblichen Tönen bereichert, zu be-
wegten Rhythmen; aber auch wenn die Rohrfeder in barocken Sprüngen über das
Papier eilt, bleiben die Wellen innerhalb übersichtlicher Kurven und vermeiden den
269
Friedrich Rintelen, Reden und Aufsätze. 8°. 271 Seiten. Benno
Schwabe & Co. Verlag. Basel 1927.
Friedrich Rintelen hat sich durch sein Buch über Giotto einen Namen gemacht,
der weit über die kunsthistorischen Fachkreise hinaus Ansehen und Geltung ge-
wonnen hat. Wie berechtigt die Erwartungen waren, die man an die weitere Ent-
wicklung dieses Mannes knüpfen mußte, zeigt der vorliegende Band, „Reden und
Aufsätze", die aus dem Nachlaß des allzufrüh Verstorbenen von seiner Frau zu-
sammengestellt wurden. Es sind vorwiegend Gelegenheitsarbeiten zu Gedenktagen,
Ausstellungen und dgl. und lassen uns daher dem Verfasser geradezu bei der Arbeit
über die Schulter gucken, man wird Zeuge, wie die Gedanken sich aus dem Mensch-
lichen entwickeln und immer bestimmter formen. Gerade das Skizzenhafte der An-
lage macht den Reiz dieser Ausführungen aus, die keine neuen wissenschaftlichen
„Resultate" prätendieren, sondern meist die Bedingung und Art bestimmter künst-
lerischer Entfaltung zum Thema haben.
Nicht zufällig umspannen sie inhaltlich eigentlich unseren ganzen Kulturraum,
sie bezeichnen die Grenzpfähle, zwischen denen Rintelen als reifer Mann sein Den-
ken und Erkennen darzulegen beabsichtigte. Seine Universalität, die dem Nach-
folger Jacob Burckhardts auf dem Basler Lehrstuhl nicht schlecht ansteht, muß
ebenso vermerkt werden wie der Zauber, der seinem sprachlichen Darstellungs-
vermögen entsteigt.
Mag es darum gehen, die Entstehung des frühromanischen Basler Münsters
nachzuzeichnen, die Gestalten Dantes oder Jacob Burckhardts (diese Rede gehört
zum Besten, was über ihn gesagt wurde), mag er in Piero della Francesca oder
Corot sich einfühlen, immer von neuem wird man durch die lebendige Anschauungs-
weise und die Fülle der Gesichtspunkte angezogen. In der modernen Kunst ist es
Hans v. Marees, Hans Purrmann und vor allem Cezanne, dem er einen überaus
feinsinnigen Essay widmet. Seine wiederabgedruckte Doktor-Dissertation über „Leib-
nizens Beziehungen zur Scholastik" zeigt, einen wie weiten Horizont dieser Mann
umfaßte. Doppelt schmerzlich empfindet man es dann, daß sein Werk Torso bleiben
mußte. Der Verleger hat dem Buch eine auffallend geschmackvolle und würdige
Aufmachung zuteil werden lassen.
Berlin. Klaus Berger.
Julius Meier-Graefe, Vincent van Gogh der Zeichner.
Otto Wacker-Verlag, Berlin, 1928.
Einer Mappe vortrefflich wiedergegebener Zeichnungen hat Meier-Graefe eine
Abhandlung vorausgeschickt, die damit beginnt, das Verhältnis zwischen Zeichnen
und Malen im 19. Jahrhundert festzulegen. Dann erzählt er, wie Vincent schon
früh zu zeichnen begann, aber immer nebenbei, etwa um Mitteilungen seiner Briefe
zu ergänzen; wie er dann später mit ungeheurem Eifer kopierte und schließlich
sich auch an das Naturvorbild wagte. Zu Ende des Jahres 1883 entstanden breite
Kohlezeichnungen nach Leuten auf dem Felde; sie sind malerisch empfunden, wäh-
rend die gleichzeitigen Ölbilder mehr Raumgestalt zeigen. Aus Paris stammen
dünne, zaghafte Zeichnungen. In Arles vermählt sich der Umriß mit der Farbe,
aber es entstehen auch große Planzeichnungen, die an Herkules Seghers erinnern.
„Die Zeichnung sichert den Raum und die Ordnung der Pläne. Es kommt bald in
dem Schwarzweiß, das sich oft mit grauen und gelblichen Tönen bereichert, zu be-
wegten Rhythmen; aber auch wenn die Rohrfeder in barocken Sprüngen über das
Papier eilt, bleiben die Wellen innerhalb übersichtlicher Kurven und vermeiden den