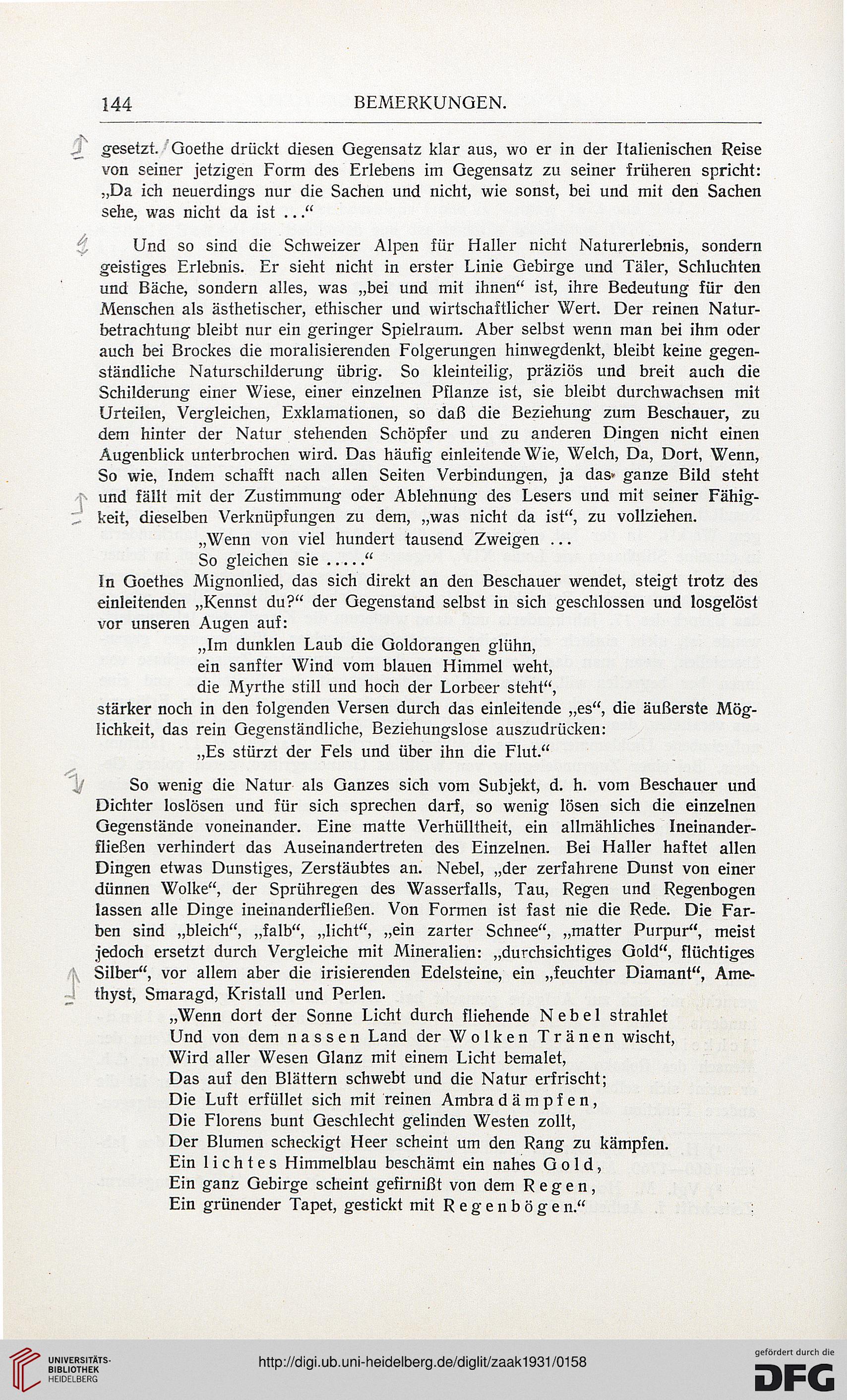144
BEMERKUNGEN.
^ gesetzt. Goethe drückt diesen Gegensatz klar aus, wo er in der Italienischen Reise
von seiner jetzigen Form des Erlebens im Gegensatz zu seiner früheren spricht:
„Da ich neuerdings nur die Sachen und nicht, wie sonst, bei und mit den Sachen
sehe, was nicht da ist ..."
Und so sind die Schweizer Alpen für Haller nicht Naturerlebnis, sondern
geistiges Erlebnis. Er sieht nicht in erster Linie Gebirge und Täler, Schluchten
und Bäche, sondern alles, was „bei und mit ihnen" ist, ihre Bedeutung für den
Menschen als ästhetischer, ethischer und wirtschaftlicher Wert. Der reinen Natur-
betrachtung bleibt nur ein geringer Spielraum. Aber selbst wenn man bei ihm oder
auch bei Brockes die moralisierenden Folgerungen hinwegdenkt, bleibt keine gegen-
ständliche Naturschilderung übrig. So kleinteilig, präziös und breit auch die
Schilderung einer Wiese, einer einzelnen Pflanze ist, sie bleibt durchwachsen mit
Urteilen, Vergleichen, Exklamationen, so daß die Beziehung zum Beschauer, zu
dem hinter der Natur stehenden Schöpfer und zu anderen Dingen nicht einen
Augenblick unterbrochen wird. Das häufig einleitende Wie, Welch, Da, Dort, Wenn,
So wie, Indem schafft nach allen Seiten Verbindungen, ja das» ganze Bild steht
<f* und fällt mit der Zustimmung oder Ablehnung des Lesers und mit seiner Fähig-
Z> keit, dieselben Verknüpfungen zu dem, „was nicht da ist", zu vollziehen.
„Wenn von viel hundert tausend Zweigen ...
So gleichen sie....."
In Goethes Mignonlied, das sich direkt an den Beschauer wendet, steigt trotz des
einleitenden „Kennst du?" der Gegenstand selbst in sich geschlossen und losgelöst
vor unseren Augen auf:
„Im dunklen Laub die Goldorangen glühn,
ein sanfter Wind vom blauen Himmel weht,
die Myrthe still und hoch der Lorbeer steht",
stärker noch in den folgenden Versen durch das einleitende „es", die äußerste Mög-
lichkeit, das rein Gegenständliche, Beziehungslose auszudrücken:
„Es stürzt der Fels und über ihn die Flut."
So wenig die Natur als Ganzes sich vom Subjekt, d. h. vom Beschauer und
Dichter loslösen und für sich sprechen darf, so wenig lösen sich die einzelnen
Gegenstände voneinander. Eine matte Verhülltheit, ein allmähliches Ineinander-
fließen verhindert das Auseinandertreten des Einzelnen. Bei Haller haftet allen
Dingen etwas Dunstiges, Zerstäubtes an. Nebel, „der zerfahrene Dunst von einer
dünnen Wolke", der Sprühregen des Wasserfalls, Tau, Regen und Regenbogen
lassen alle Dinge ineinanderfließen. Von Formen ist fast nie die Rede. Die Far-
ben sind „bleich", „falb", „licht", „ein zarter Schnee", „matter Purpur", meist
jedoch ersetzt durch Vergleiche mit Mineralien: „durchsichtiges Gold", flüchtiges
Silber", vor allem aber die irisierenden Edelsteine, ein „feuchter Diamant", Ame-
J thyst, Smaragd, Kristall und Perlen.
„Wenn dort der Sonne Licht durch fliehende Nebel strahlet
Und von dem nassen Land der Wolken Tränen wischt,
Wird aller Wesen Glanz mit einem Licht bemalet,
Das auf den Blättern schwebt und die Natur erfrischt;
Die Luft erfüllet sich mit reinen Ambra dämpfen,
Die Florens bunt Geschlecht gelinden Westen zollt,
Der Blumen scheckigt Heer scheint um den Rang zu kämpfen.
Ein lichtes Himmelblau beschämt ein nahes Gold,
Ein ganz Gebirge scheint gefirnißt von dem Regen,
Ein grünender Tapet, gestickt mit Regen böge n."
BEMERKUNGEN.
^ gesetzt. Goethe drückt diesen Gegensatz klar aus, wo er in der Italienischen Reise
von seiner jetzigen Form des Erlebens im Gegensatz zu seiner früheren spricht:
„Da ich neuerdings nur die Sachen und nicht, wie sonst, bei und mit den Sachen
sehe, was nicht da ist ..."
Und so sind die Schweizer Alpen für Haller nicht Naturerlebnis, sondern
geistiges Erlebnis. Er sieht nicht in erster Linie Gebirge und Täler, Schluchten
und Bäche, sondern alles, was „bei und mit ihnen" ist, ihre Bedeutung für den
Menschen als ästhetischer, ethischer und wirtschaftlicher Wert. Der reinen Natur-
betrachtung bleibt nur ein geringer Spielraum. Aber selbst wenn man bei ihm oder
auch bei Brockes die moralisierenden Folgerungen hinwegdenkt, bleibt keine gegen-
ständliche Naturschilderung übrig. So kleinteilig, präziös und breit auch die
Schilderung einer Wiese, einer einzelnen Pflanze ist, sie bleibt durchwachsen mit
Urteilen, Vergleichen, Exklamationen, so daß die Beziehung zum Beschauer, zu
dem hinter der Natur stehenden Schöpfer und zu anderen Dingen nicht einen
Augenblick unterbrochen wird. Das häufig einleitende Wie, Welch, Da, Dort, Wenn,
So wie, Indem schafft nach allen Seiten Verbindungen, ja das» ganze Bild steht
<f* und fällt mit der Zustimmung oder Ablehnung des Lesers und mit seiner Fähig-
Z> keit, dieselben Verknüpfungen zu dem, „was nicht da ist", zu vollziehen.
„Wenn von viel hundert tausend Zweigen ...
So gleichen sie....."
In Goethes Mignonlied, das sich direkt an den Beschauer wendet, steigt trotz des
einleitenden „Kennst du?" der Gegenstand selbst in sich geschlossen und losgelöst
vor unseren Augen auf:
„Im dunklen Laub die Goldorangen glühn,
ein sanfter Wind vom blauen Himmel weht,
die Myrthe still und hoch der Lorbeer steht",
stärker noch in den folgenden Versen durch das einleitende „es", die äußerste Mög-
lichkeit, das rein Gegenständliche, Beziehungslose auszudrücken:
„Es stürzt der Fels und über ihn die Flut."
So wenig die Natur als Ganzes sich vom Subjekt, d. h. vom Beschauer und
Dichter loslösen und für sich sprechen darf, so wenig lösen sich die einzelnen
Gegenstände voneinander. Eine matte Verhülltheit, ein allmähliches Ineinander-
fließen verhindert das Auseinandertreten des Einzelnen. Bei Haller haftet allen
Dingen etwas Dunstiges, Zerstäubtes an. Nebel, „der zerfahrene Dunst von einer
dünnen Wolke", der Sprühregen des Wasserfalls, Tau, Regen und Regenbogen
lassen alle Dinge ineinanderfließen. Von Formen ist fast nie die Rede. Die Far-
ben sind „bleich", „falb", „licht", „ein zarter Schnee", „matter Purpur", meist
jedoch ersetzt durch Vergleiche mit Mineralien: „durchsichtiges Gold", flüchtiges
Silber", vor allem aber die irisierenden Edelsteine, ein „feuchter Diamant", Ame-
J thyst, Smaragd, Kristall und Perlen.
„Wenn dort der Sonne Licht durch fliehende Nebel strahlet
Und von dem nassen Land der Wolken Tränen wischt,
Wird aller Wesen Glanz mit einem Licht bemalet,
Das auf den Blättern schwebt und die Natur erfrischt;
Die Luft erfüllet sich mit reinen Ambra dämpfen,
Die Florens bunt Geschlecht gelinden Westen zollt,
Der Blumen scheckigt Heer scheint um den Rang zu kämpfen.
Ein lichtes Himmelblau beschämt ein nahes Gold,
Ein ganz Gebirge scheint gefirnißt von dem Regen,
Ein grünender Tapet, gestickt mit Regen böge n."