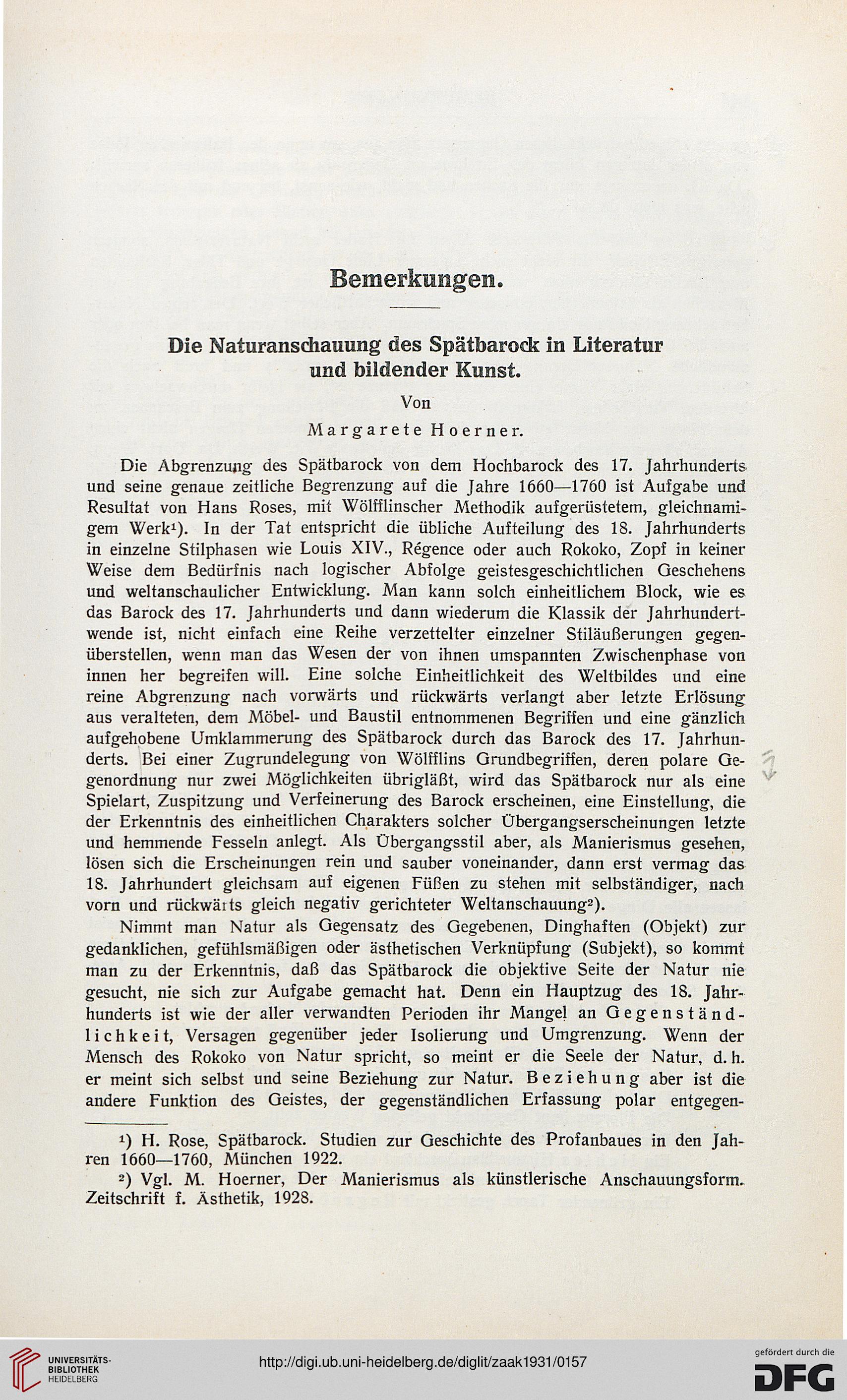Bemerkungen.
Die Naturanschauung des Spätbarock in Literatur
und bildender Kunst.
Von
Margarete Hoerner.
Die Abgrenzung des Spätbarock von dem Hochbarock des 17. Jahrhunderts
und seine genaue zeitliche Begrenzung auf die Jahre 1660—1760 ist Aufgabe und
Resultat von Hans Roses, mit Wölfflinscher Methodik aufgerüstetem, gleichnami-
gem Werk1). In der Tat entspricht die übliche Aufteilung des 18. Jahrhunderts
in einzelne Stilphasen wie Louis XIV., Regence oder auch Rokoko, Zopf in keiner
Weise dem Bedürfnis nach logischer Abfolge geistesgeschichtlichen Geschehens
und weltanschaulicher Entwicklung. Man kann solch einheitlichem Block, wie es
das Barock des 17. Jahrhunderts und dann wiederum die Klassik der Jahrhundert-
wende ist, nicht einfach eine Reihe verzettelter einzelner Stiläußerungen gegen-
überstellen, wenn man das Wesen der von ihnen umspannten Zwischenphase von
innen her begreifen will. Eine solche Einheitlichkeit des Weltbildes und eine
reine Abgrenzung nach vorwärts und rückwärts verlangt aber letzte Erlösung
aus veralteten, dem Möbel- und Baustil entnommenen Begriffen und eine gänzlich
aufgehobene Umklammerung des Spätbarock durch das Barock des 17. Jahrhun-
derts. Bei einer Zugrundelegung von Wölfflins Grundbegriffen, deren polare Ge-
genordnung nur zwei Möglichkeiten übrigläßt, wird das Spätbarock nur als eine
Spielart, Zuspitzung und Verfeinerung des Barock erscheinen, eine Einstellung, die
der Erkenntnis des einheitlichen Charakters solcher Übergangserscheinungen letzte
und hemmende Fesseln anlegt. Als Übergangsstil aber, als Manierismus gesehen,
lösen sich die Erscheinungen rein und sauber voneinander, dann erst vermag das
18. Jahrhundert gleichsam auf eigenen Füßen zu stehen mit selbständiger, nach
vorn und rückwäits gleich negativ gerichteter Weltanschauung2).
Nimmt man Natur als Gegensatz des Gegebenen, Dinghaften (Objekt) zur
gedanklichen, gefühlsmäßigen oder ästhetischen Verknüpfung (Subjekt), so kommt
man zu der Erkenntnis, daß das Spätbarock die objektive Seite der Natur nie
gesucht, nie sich zur Aufgabe gemacht hat. Denn ein Hauptzug des 18. Jahr-
hunderts ist wie der aller verwandten Perioden ihr Mangel an Gegenständ-
lichkeit, Versagen gegenüber jeder Isolierung und Umgrenzung. Wenn der
Mensch des Rokoko von Natur spricht, so meint er die Seele der Natur, d. h.
er meint sich selbst und seine Beziehung zur Natur. Beziehung aber ist die
andere Funktion des Geistes, der gegenständlichen Erfassung polar entgegen-
*) H. Rose, Spätbarock. Studien zur Geschichte des Profanbaues in den Jah-
ren 1660—1760, München 1922.
2) Vgl. M. Hoerner, Der Manierismus als künstlerische Anschauungsform.
Zeitschrift f. Ästhetik, 1928.
Die Naturanschauung des Spätbarock in Literatur
und bildender Kunst.
Von
Margarete Hoerner.
Die Abgrenzung des Spätbarock von dem Hochbarock des 17. Jahrhunderts
und seine genaue zeitliche Begrenzung auf die Jahre 1660—1760 ist Aufgabe und
Resultat von Hans Roses, mit Wölfflinscher Methodik aufgerüstetem, gleichnami-
gem Werk1). In der Tat entspricht die übliche Aufteilung des 18. Jahrhunderts
in einzelne Stilphasen wie Louis XIV., Regence oder auch Rokoko, Zopf in keiner
Weise dem Bedürfnis nach logischer Abfolge geistesgeschichtlichen Geschehens
und weltanschaulicher Entwicklung. Man kann solch einheitlichem Block, wie es
das Barock des 17. Jahrhunderts und dann wiederum die Klassik der Jahrhundert-
wende ist, nicht einfach eine Reihe verzettelter einzelner Stiläußerungen gegen-
überstellen, wenn man das Wesen der von ihnen umspannten Zwischenphase von
innen her begreifen will. Eine solche Einheitlichkeit des Weltbildes und eine
reine Abgrenzung nach vorwärts und rückwärts verlangt aber letzte Erlösung
aus veralteten, dem Möbel- und Baustil entnommenen Begriffen und eine gänzlich
aufgehobene Umklammerung des Spätbarock durch das Barock des 17. Jahrhun-
derts. Bei einer Zugrundelegung von Wölfflins Grundbegriffen, deren polare Ge-
genordnung nur zwei Möglichkeiten übrigläßt, wird das Spätbarock nur als eine
Spielart, Zuspitzung und Verfeinerung des Barock erscheinen, eine Einstellung, die
der Erkenntnis des einheitlichen Charakters solcher Übergangserscheinungen letzte
und hemmende Fesseln anlegt. Als Übergangsstil aber, als Manierismus gesehen,
lösen sich die Erscheinungen rein und sauber voneinander, dann erst vermag das
18. Jahrhundert gleichsam auf eigenen Füßen zu stehen mit selbständiger, nach
vorn und rückwäits gleich negativ gerichteter Weltanschauung2).
Nimmt man Natur als Gegensatz des Gegebenen, Dinghaften (Objekt) zur
gedanklichen, gefühlsmäßigen oder ästhetischen Verknüpfung (Subjekt), so kommt
man zu der Erkenntnis, daß das Spätbarock die objektive Seite der Natur nie
gesucht, nie sich zur Aufgabe gemacht hat. Denn ein Hauptzug des 18. Jahr-
hunderts ist wie der aller verwandten Perioden ihr Mangel an Gegenständ-
lichkeit, Versagen gegenüber jeder Isolierung und Umgrenzung. Wenn der
Mensch des Rokoko von Natur spricht, so meint er die Seele der Natur, d. h.
er meint sich selbst und seine Beziehung zur Natur. Beziehung aber ist die
andere Funktion des Geistes, der gegenständlichen Erfassung polar entgegen-
*) H. Rose, Spätbarock. Studien zur Geschichte des Profanbaues in den Jah-
ren 1660—1760, München 1922.
2) Vgl. M. Hoerner, Der Manierismus als künstlerische Anschauungsform.
Zeitschrift f. Ästhetik, 1928.