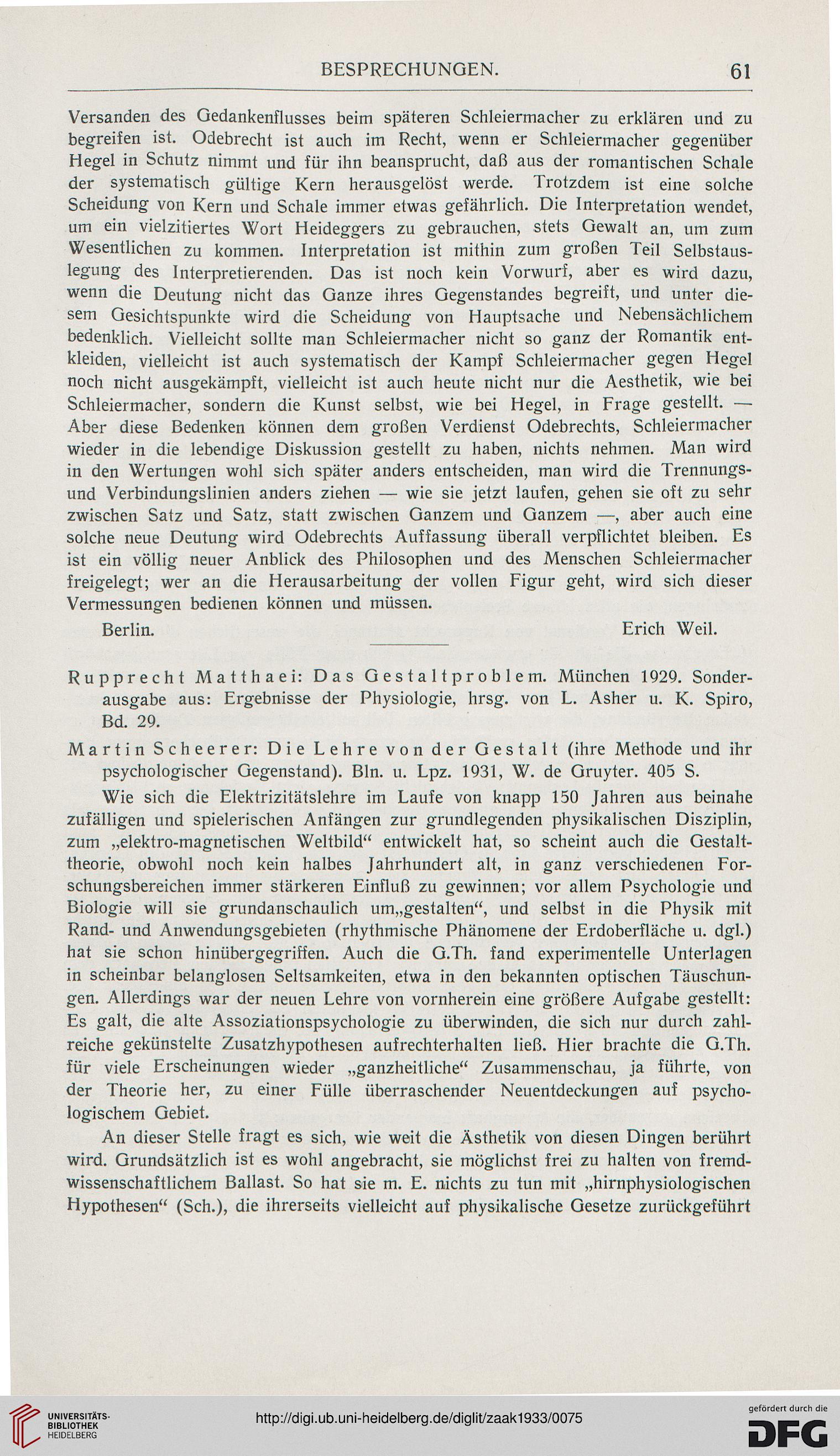BESPRECHUNGEN. 61
Versanden des Gedankenflusses beim späteren Schleiermacher zu erklären und zu
begreifen ist. Odebrecht ist auch im Recht, wenn er Schleiermacher gegenüber
Hegel in Schutz nimmt und für ihn beansprucht, daß aus der romantischen Schale
der systematisch gültige Kern herausgelöst werde. Trotzdem ist eine solche
Scheidung von Kern und Schale immer etwas gefährlich. Die Interpretation wendet,
um ein vielzitiertes Wort Heideggers zu gebrauchen, stets Gewalt an, um zum
Wesentlichen zu kommen. Interpretation ist mithin zum großen Teil Selbstaus-
legung des Interpretierenden. Das ist noch kein Vorwurf, aber es wird dazu,
wenn die Deutung nicht das Ganze ihres Gegenstandes begreift, und unter die-
sem Gesichtspunkte wird die Scheidung von Hauptsache und Nebensächlichem
bedenklich. Vielleicht sollte man Schleiermacher nicht so ganz der Romantik ent-
kleiden, vielleicht ist auch systematisch der Kampf Schleiermacher gegen Hegel
noch nicht ausgekämpft, vielleicht ist auch heute nicht nur die Aesthetik, wie bei
Schleiermacher, sondern die Kunst selbst, wie bei Hegel, in Frage gestellt. —
Aber diese Bedenken können dem großen Verdienst Odebrechts, Schleiermacher
wieder in die lebendige Diskussion gestellt zu haben, nichts nehmen. Man wird
in den Wertungen wohl sich später anders entscheiden, man wird die Trennuugs-
und Verbindungslinien anders ziehen — wie sie jetzt laufen, gehen sie oft zu sehr
zwischen Satz und Satz, statt zwischen Ganzem und Ganzem —, aber auch eine
solche neue Deutung wird Odebrechts Auffassung überall verpflichtet bleiben. Es
ist ein völlig neuer Anblick des Philosophen und des Menschen Schleiermacher
freigelegt; wer an die Herausarbeitung der vollen Figur geht, wird sich dieser
Vermessungen bedienen können und müssen.
Berlin. Erich Weil.
Rupprecht Matthaei: Das Gestaltproblem. München 1929. Sonder-
ausgabe aus: Ergebnisse der Physiologie, hrsg. von L. Asher u. K. Spiro,
Bd. 29.
Martin Scheerer: Die Lehre von der Gestalt (ihre Methode und ihr
psychologischer Gegenstand). Bln. u. Lpz. 1931, W. de Gruyter. 405 S.
Wie sich die Elektrizitätslehre im Laufe von knapp 150 Jahren aus beinahe
zufälligen und spielerischen Anfängen zur grundlegenden physikalischen Disziplin,
zum „elektro-magnetischen Weltbild" entwickelt hat, so scheint auch die Gestalt-
theorie, obwohl noch kein halbes Jahrhundert alt, in ganz verschiedenen For-
schungsbereichen immer stärkeren Einfluß zu gewinnen; vor allem Psychologie und
Biologie will sie grundanschaulich umgestalten", und selbst in die Physik mit
Rand- und Anwendungsgebieten (rhythmische Phänomene der Erdoberfläche u. dgl.)
hat sie schon hinübergegriffen. Auch die G.Th. fand experimentelle Unterlagen
in scheinbar belanglosen Seltsamkeiten, etwa in den bekannten optischen Täuschun-
gen. Allerdings war der neuen Lehre von vornherein eine größere Aufgabe gestellt:
Es galt, die alte Assoziationspsychologie zu überwinden, die sich nur durch zahl-
reiche gekünstelte Zusatzhypothesen aufrechterhalten ließ. Hier brachte die G.Th.
für viele Erscheinungen wieder „ganzheitliche" Zusammenschau, ja führte, von
der Theorie her, zu einer Fülle überraschender Neuentdeckungen auf psycho-
logischem Gebiet.
An dieser Stelle fragt es sich, wie weit die Ästhetik von diesen Dingen berührt
wird. Grundsätzlich ist es wohl angebracht, sie möglichst frei zu halten von fremd-
wissenschaftlichem Ballast. So hat sie m. E. nichts zu tun mit „hirnphysiologischen
Hypothesen" (Sch.), die ihrerseits vielleicht auf physikalische Gesetze zurückgeführt
Versanden des Gedankenflusses beim späteren Schleiermacher zu erklären und zu
begreifen ist. Odebrecht ist auch im Recht, wenn er Schleiermacher gegenüber
Hegel in Schutz nimmt und für ihn beansprucht, daß aus der romantischen Schale
der systematisch gültige Kern herausgelöst werde. Trotzdem ist eine solche
Scheidung von Kern und Schale immer etwas gefährlich. Die Interpretation wendet,
um ein vielzitiertes Wort Heideggers zu gebrauchen, stets Gewalt an, um zum
Wesentlichen zu kommen. Interpretation ist mithin zum großen Teil Selbstaus-
legung des Interpretierenden. Das ist noch kein Vorwurf, aber es wird dazu,
wenn die Deutung nicht das Ganze ihres Gegenstandes begreift, und unter die-
sem Gesichtspunkte wird die Scheidung von Hauptsache und Nebensächlichem
bedenklich. Vielleicht sollte man Schleiermacher nicht so ganz der Romantik ent-
kleiden, vielleicht ist auch systematisch der Kampf Schleiermacher gegen Hegel
noch nicht ausgekämpft, vielleicht ist auch heute nicht nur die Aesthetik, wie bei
Schleiermacher, sondern die Kunst selbst, wie bei Hegel, in Frage gestellt. —
Aber diese Bedenken können dem großen Verdienst Odebrechts, Schleiermacher
wieder in die lebendige Diskussion gestellt zu haben, nichts nehmen. Man wird
in den Wertungen wohl sich später anders entscheiden, man wird die Trennuugs-
und Verbindungslinien anders ziehen — wie sie jetzt laufen, gehen sie oft zu sehr
zwischen Satz und Satz, statt zwischen Ganzem und Ganzem —, aber auch eine
solche neue Deutung wird Odebrechts Auffassung überall verpflichtet bleiben. Es
ist ein völlig neuer Anblick des Philosophen und des Menschen Schleiermacher
freigelegt; wer an die Herausarbeitung der vollen Figur geht, wird sich dieser
Vermessungen bedienen können und müssen.
Berlin. Erich Weil.
Rupprecht Matthaei: Das Gestaltproblem. München 1929. Sonder-
ausgabe aus: Ergebnisse der Physiologie, hrsg. von L. Asher u. K. Spiro,
Bd. 29.
Martin Scheerer: Die Lehre von der Gestalt (ihre Methode und ihr
psychologischer Gegenstand). Bln. u. Lpz. 1931, W. de Gruyter. 405 S.
Wie sich die Elektrizitätslehre im Laufe von knapp 150 Jahren aus beinahe
zufälligen und spielerischen Anfängen zur grundlegenden physikalischen Disziplin,
zum „elektro-magnetischen Weltbild" entwickelt hat, so scheint auch die Gestalt-
theorie, obwohl noch kein halbes Jahrhundert alt, in ganz verschiedenen For-
schungsbereichen immer stärkeren Einfluß zu gewinnen; vor allem Psychologie und
Biologie will sie grundanschaulich umgestalten", und selbst in die Physik mit
Rand- und Anwendungsgebieten (rhythmische Phänomene der Erdoberfläche u. dgl.)
hat sie schon hinübergegriffen. Auch die G.Th. fand experimentelle Unterlagen
in scheinbar belanglosen Seltsamkeiten, etwa in den bekannten optischen Täuschun-
gen. Allerdings war der neuen Lehre von vornherein eine größere Aufgabe gestellt:
Es galt, die alte Assoziationspsychologie zu überwinden, die sich nur durch zahl-
reiche gekünstelte Zusatzhypothesen aufrechterhalten ließ. Hier brachte die G.Th.
für viele Erscheinungen wieder „ganzheitliche" Zusammenschau, ja führte, von
der Theorie her, zu einer Fülle überraschender Neuentdeckungen auf psycho-
logischem Gebiet.
An dieser Stelle fragt es sich, wie weit die Ästhetik von diesen Dingen berührt
wird. Grundsätzlich ist es wohl angebracht, sie möglichst frei zu halten von fremd-
wissenschaftlichem Ballast. So hat sie m. E. nichts zu tun mit „hirnphysiologischen
Hypothesen" (Sch.), die ihrerseits vielleicht auf physikalische Gesetze zurückgeführt