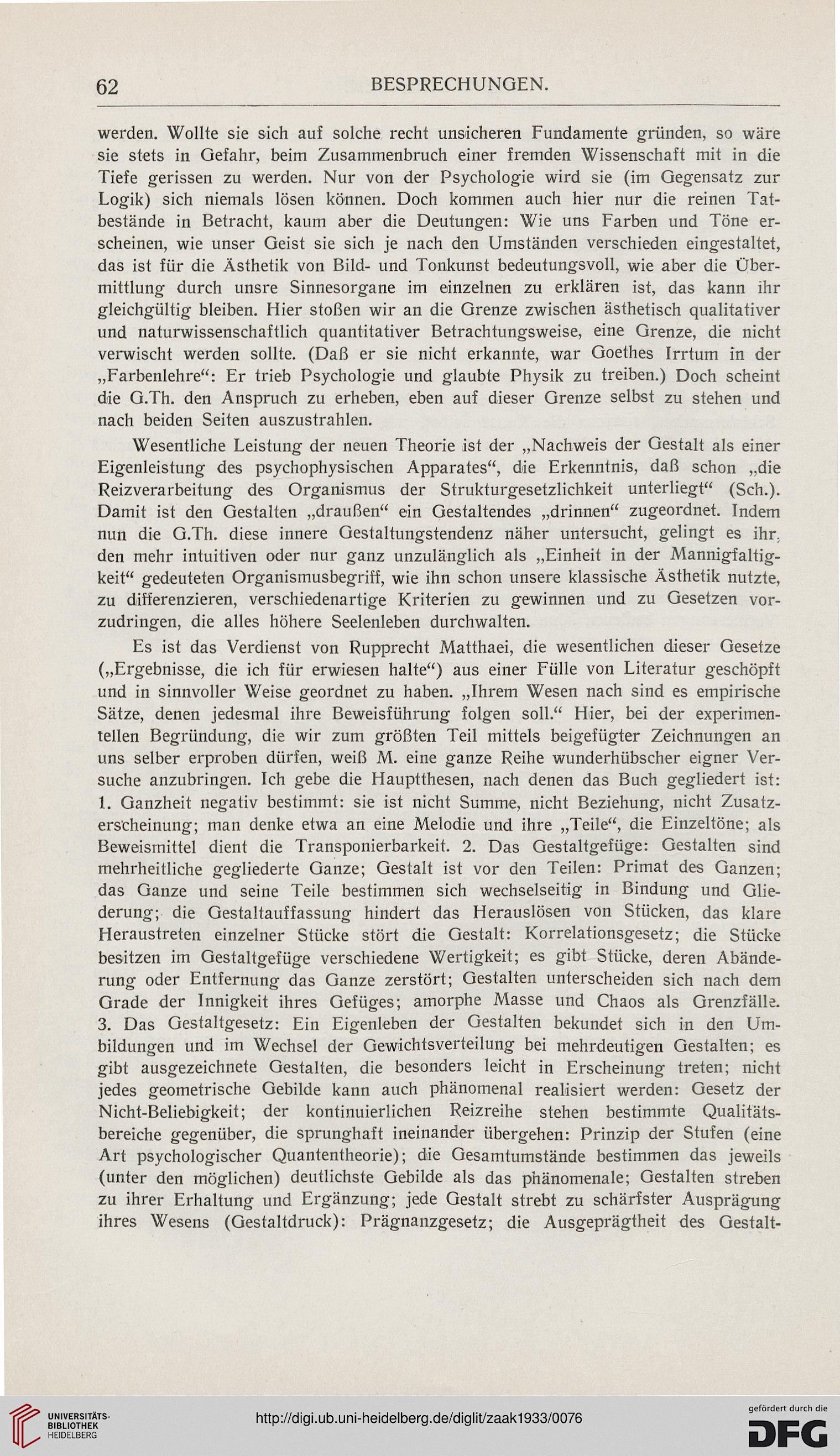62
BESPRECHUNGEN.
werden. Wollte sie sich auf solche recht unsicheren Fundamente gründen, so wäre
sie stets in Gefahr, beim Zusammenbruch einer fremden Wissenschaft mit in die
Tiefe gerissen zu werden. Nur von der Psychologie wird sie (im Gegensatz zur
Logik) sich niemals lösen können. Doch kommen auch hier nur die reinen Tat-
bestände in Betracht, kaum aber die Deutungen: Wie uns Farben und Töne er-
scheinen, wie unser Geist sie sich je nach den Umständen verschieden eingestaltet,
das ist für die Ästhetik von Bild- und Tonkunst bedeutungsvoll, wie aber die Über-
mittlung durch unsre Sinnesorgane im einzelnen zu erklären ist, das kann ihr
gleichgültig bleiben. Hier stoßen wir an die Grenze zwischen ästhetisch qualitativer
und naturwissenschaftlich quantitativer Betrachtungsweise, eine Grenze, die nicht
verwischt werden sollte. (Daß er sie nicht erkannte, war Goethes Irrtum in der
„Farbenlehre": Er trieb Psychologie und glaubte Physik zu treiben.) Doch scheint
die G.Th. den Anspruch zu erheben, eben auf dieser Grenze selbst zu stehen und
nach beiden Seiten auszustrahlen.
Wesentliche Leistung der neuen Theorie ist der „Nachweis der Gestalt als einer
Eigenleistung des psychophysischen Apparates", die Erkenntnis, daß schon „die
Reizverarbeitung des Organismus der Strukturgesetzlichkeit unterliegt" (Sch.).
Damit ist den Gestalten „draußen" ein Gestaltendes „drinnen" zugeordnet. Indem
nun die G.Th. diese innere Gestaltungstendenz näher untersucht, gelingt es ihr.
den mehr intuitiven oder nur ganz unzulänglich als „Einheit in der Mannigfaltig-
keit" gedeuteten Organismusbegriff, wie ihn schon unsere klassische Ästhetik nutzte,
zu differenzieren, verschiedenartige Kriterien zu gewinnen und zu Gesetzen vor-
zudringen, die alles höhere Seelenleben durchwalten.
Es ist das Verdienst von Rupprecht Matthaei, die wesentlichen dieser Gesetze
(„Ergebnisse, die ich für erwiesen halte") aus einer Fülle von Literatur geschöpft
und in sinnvoller Weise geordnet zu haben. „Ihrem Wesen nach sind es empirische
Sätze, denen jedesmal ihre Beweisführung folgen soll." Hier, bei der experimen-
tellen Begründung, die wir zum größten Teil mittels beigefügter Zeichnungen an
uns selber erproben dürfen, weiß M. eine ganze Reihe wunderhübscher eigner Ver-
suche anzubringen. Ich gebe die Hauptthesen, nach denen das Buch gegliedert ist:
1. Ganzheit negativ bestimmt: sie ist nicht Summe, nicht Beziehung, nicht Zusatz-
erscheinung; man denke etwa an eine Melodie und ihre „Teile", die Einzeltöne; als
Beweismittel dient die Transponierbarkeit. 2. Das Gestaltgefüge: Gestalten sind
mehrheitliche gegliederte Ganze; Gestalt ist vor den Teilen: Primat des Ganzen;
das Ganze und seine Teile bestimmen sich wechselseitig in Bindung und Glie-
derung; die Gestaltauffassung hindert das Herauslösen von Stücken, das klare
Heraustreten einzelner Stücke stört die Gestalt: Korrelationsgesetz; die Stücke
besitzen im Gestaltgefüge verschiedene Wertigkeit; es gibt Stücke, deren Abände-
rung oder Entfernung das Ganze zerstört; Gestalten unterscheiden sich nach dem
Grade der Innigkeit ihres Gefüges; amorphe Masse und Chaos als Grenzfälle.
3. Das Gestaltgesetz: Ein Eigenleben der Gestalten bekundet sich in den Um-
bildungen und im Wechsel der Gewichtsverteilung bei mehrdeutigen Gestalten; es
gibt ausgezeichnete Gestalten, die besonders leicht in Erscheinung treten; nicht
jedes geometrische Gebilde kann auch phänomenal realisiert werden: Gesetz der
Nicht-Beliebigkeit; der kontinuierlichen Reizreihe stehen bestimmte Qualitäts-
bereiche gegenüber, die sprunghaft ineinander übergehen: Prinzip der Stufen (eine
Art psychologischer Quantentheorie); die Gesamtumstände bestimmen das jeweils
(unter den möglichen) deutlichste Gebilde als das phänomenale; Gestalten streben
zu ihrer Erhaltung und Ergänzung; jede Gestalt strebt zu schärfster Ausprägung
ihres Wesens (Gestaltdruck): Prägnanzgesetz; die Ausgeprägtheit des Gestalt-
BESPRECHUNGEN.
werden. Wollte sie sich auf solche recht unsicheren Fundamente gründen, so wäre
sie stets in Gefahr, beim Zusammenbruch einer fremden Wissenschaft mit in die
Tiefe gerissen zu werden. Nur von der Psychologie wird sie (im Gegensatz zur
Logik) sich niemals lösen können. Doch kommen auch hier nur die reinen Tat-
bestände in Betracht, kaum aber die Deutungen: Wie uns Farben und Töne er-
scheinen, wie unser Geist sie sich je nach den Umständen verschieden eingestaltet,
das ist für die Ästhetik von Bild- und Tonkunst bedeutungsvoll, wie aber die Über-
mittlung durch unsre Sinnesorgane im einzelnen zu erklären ist, das kann ihr
gleichgültig bleiben. Hier stoßen wir an die Grenze zwischen ästhetisch qualitativer
und naturwissenschaftlich quantitativer Betrachtungsweise, eine Grenze, die nicht
verwischt werden sollte. (Daß er sie nicht erkannte, war Goethes Irrtum in der
„Farbenlehre": Er trieb Psychologie und glaubte Physik zu treiben.) Doch scheint
die G.Th. den Anspruch zu erheben, eben auf dieser Grenze selbst zu stehen und
nach beiden Seiten auszustrahlen.
Wesentliche Leistung der neuen Theorie ist der „Nachweis der Gestalt als einer
Eigenleistung des psychophysischen Apparates", die Erkenntnis, daß schon „die
Reizverarbeitung des Organismus der Strukturgesetzlichkeit unterliegt" (Sch.).
Damit ist den Gestalten „draußen" ein Gestaltendes „drinnen" zugeordnet. Indem
nun die G.Th. diese innere Gestaltungstendenz näher untersucht, gelingt es ihr.
den mehr intuitiven oder nur ganz unzulänglich als „Einheit in der Mannigfaltig-
keit" gedeuteten Organismusbegriff, wie ihn schon unsere klassische Ästhetik nutzte,
zu differenzieren, verschiedenartige Kriterien zu gewinnen und zu Gesetzen vor-
zudringen, die alles höhere Seelenleben durchwalten.
Es ist das Verdienst von Rupprecht Matthaei, die wesentlichen dieser Gesetze
(„Ergebnisse, die ich für erwiesen halte") aus einer Fülle von Literatur geschöpft
und in sinnvoller Weise geordnet zu haben. „Ihrem Wesen nach sind es empirische
Sätze, denen jedesmal ihre Beweisführung folgen soll." Hier, bei der experimen-
tellen Begründung, die wir zum größten Teil mittels beigefügter Zeichnungen an
uns selber erproben dürfen, weiß M. eine ganze Reihe wunderhübscher eigner Ver-
suche anzubringen. Ich gebe die Hauptthesen, nach denen das Buch gegliedert ist:
1. Ganzheit negativ bestimmt: sie ist nicht Summe, nicht Beziehung, nicht Zusatz-
erscheinung; man denke etwa an eine Melodie und ihre „Teile", die Einzeltöne; als
Beweismittel dient die Transponierbarkeit. 2. Das Gestaltgefüge: Gestalten sind
mehrheitliche gegliederte Ganze; Gestalt ist vor den Teilen: Primat des Ganzen;
das Ganze und seine Teile bestimmen sich wechselseitig in Bindung und Glie-
derung; die Gestaltauffassung hindert das Herauslösen von Stücken, das klare
Heraustreten einzelner Stücke stört die Gestalt: Korrelationsgesetz; die Stücke
besitzen im Gestaltgefüge verschiedene Wertigkeit; es gibt Stücke, deren Abände-
rung oder Entfernung das Ganze zerstört; Gestalten unterscheiden sich nach dem
Grade der Innigkeit ihres Gefüges; amorphe Masse und Chaos als Grenzfälle.
3. Das Gestaltgesetz: Ein Eigenleben der Gestalten bekundet sich in den Um-
bildungen und im Wechsel der Gewichtsverteilung bei mehrdeutigen Gestalten; es
gibt ausgezeichnete Gestalten, die besonders leicht in Erscheinung treten; nicht
jedes geometrische Gebilde kann auch phänomenal realisiert werden: Gesetz der
Nicht-Beliebigkeit; der kontinuierlichen Reizreihe stehen bestimmte Qualitäts-
bereiche gegenüber, die sprunghaft ineinander übergehen: Prinzip der Stufen (eine
Art psychologischer Quantentheorie); die Gesamtumstände bestimmen das jeweils
(unter den möglichen) deutlichste Gebilde als das phänomenale; Gestalten streben
zu ihrer Erhaltung und Ergänzung; jede Gestalt strebt zu schärfster Ausprägung
ihres Wesens (Gestaltdruck): Prägnanzgesetz; die Ausgeprägtheit des Gestalt-