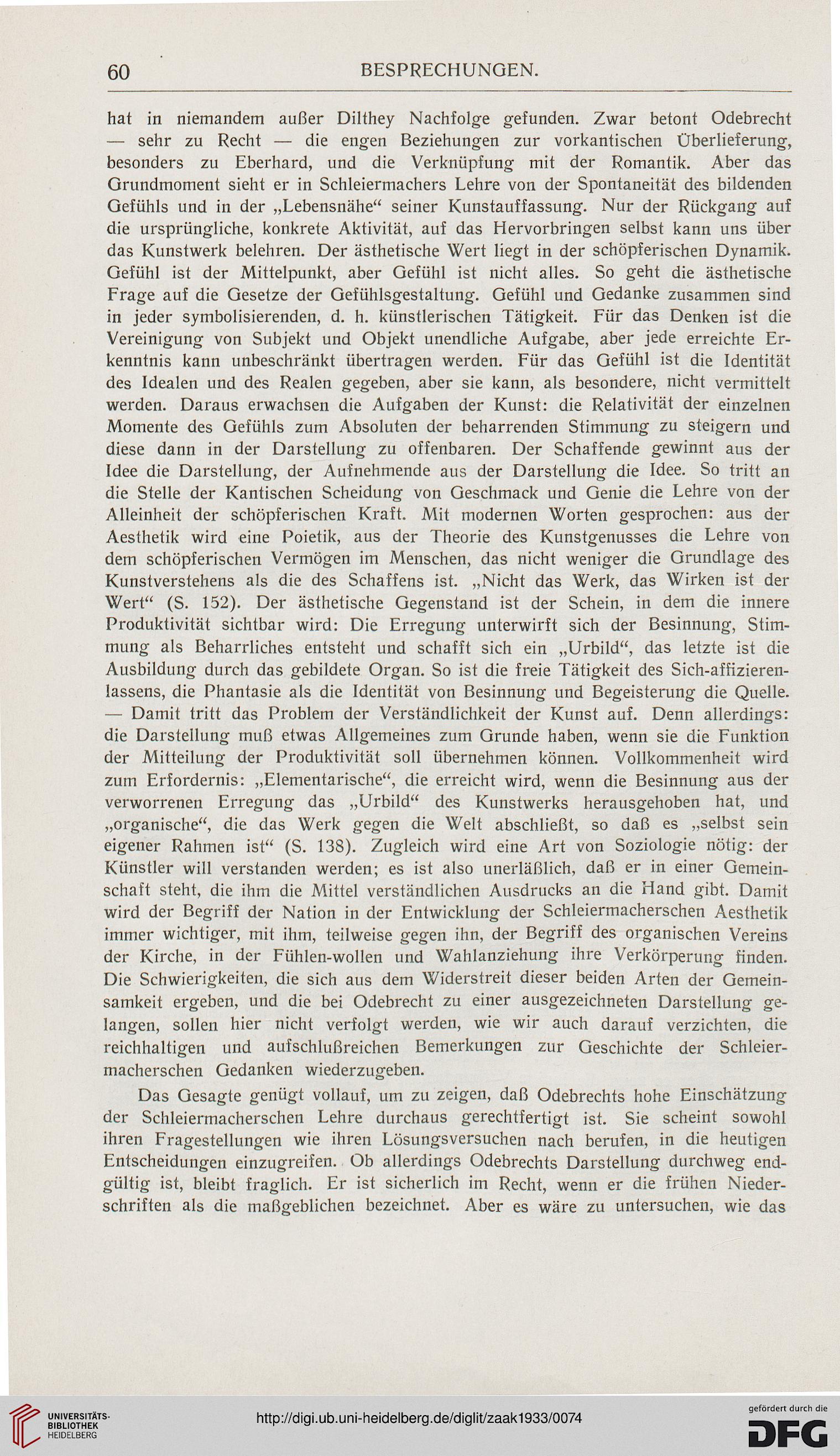60
BESPRECHUNGEN.
hat in niemandem außer Dilthey Nachfolge gefunden. Zwar betont Odebrecht
— sehr zu Recht — die engen Beziehungen zur vorkantischen Überlieferung,
besonders zu Eberhard, und die Verknüpfung mit der Romantik. Aber das
Orundmoment sieht er in Schleiermachers Lehre von der Spontaneität des bildenden
Gefühls und in der „Lebensnähe" seiner Kunstauffassung. Nur der Rückgang auf
die ursprüngliche, konkrete Aktivität, auf das Hervorbringen selbst kann uns über
das Kunstwerk belehren. Der ästhetische Wert liegt in der schöpferischen Dynamik.
Gefühl ist der Mittelpunkt, aber Gefühl ist nicht alles. So geht die ästhetische
Frage auf die Gesetze der Gefühlsgestaltung. Gefühl und Gedanke zusammen sind
in jeder symbolisierenden, d. h. künstlerischen Tätigkeit. Für das Denken ist die
Vereinigung von Subjekt und Objekt unendliche Aufgabe, aber jede erreichte Er-
kenntnis kann unbeschränkt übertragen werden. Für das Gefühl ist die Identität
des Idealen und des Realen gegeben, aber sie kann, als besondere, nicht vermittelt
werden. Daraus erwachsen die Aufgaben der Kunst: die Relativität der einzelnen
Momente des Gefühls zum Absoluten der beharrenden Stimmung zu steigern und
diese dann in der Darstellung zu offenbaren. Der Schaffende gewinnt aus der
Idee die Darstellung, der Aufnehmende aus der Darstellung die Idee. So tritt an
die Stelle der Kantischen Scheidung von Geschmack und Genie die Lehre von der
Alleinheit der schöpferischen Kraft. Mit modernen Worten gesprochen: aus der
Aesthetik wird eine Poietik, aus der Theorie des Kunstgenusses die Lehre von
dem schöpferischen Vermögen im Menschen, das nicht weniger die Grundlage des
Kunstverstehens als die des Schaffens ist. „Nicht das Werk, das Wirken ist der
Wert" (S. 152). Der ästhetische Gegenstand ist der Schein, in dem die innere
Produktivität sichtbar wird: Die Erregung unterwirft sich der Besinnung, Stim-
mung als Beharrliches entsteht und schafft sich ein „Urbild", das letzte ist die
Ausbildung durch das gebildete Organ. So ist die freie Tätigkeit des Sich-affizieren-
lassens, die Phantasie als die Identität von Besinnung und Begeisterung die Quelle.
— Damit tritt das Problem der Verständlichkeit der Kunst auf. Denn allerdings:
die Darstellung muß etwas Allgemeines zum Grunde haben, wenn sie die Funktion
der Mitteilung der Produktivität soll übernehmen können. Vollkommenheit wird
zum Erfordernis: „Elementarische", die erreicht wird, wenn die Besinnung aus der
verworrenen Erregung das „Urbild" des Kunstwerks herausgehoben hat, und
„organische", die das Werk gegen die Welt abschließt, so daß es „selbst sein
eigener Rahmen ist" (S. 138). Zugleich wird eine Art von Soziologie nötig: der
Künstler will verstanden werden; es ist also unerläßlich, daß er in einer Gemein-
schaft steht, die ihm die Mittel verständlichen Ausdrucks an die Hand gibt. Damit
wird der Begriff der Nation in der Entwicklung der Schleiermacherschen Aesthetik
immer wichtiger, mit ihm, teilweise gegen ihn, der Begriff des organischen Vereins
der Kirche, in der Fuhlen-wollen und Wahlanziehung ihre Verkörperung finden.
Die Schwierigkeiten, die sich aus dem Widerstreit dieser beiden Arten der Gemein-
samkeit ergeben, und die bei Odebrecht zu einer ausgezeichneten Darstellung ge-
langen, sollen hier nicht verfolgt werden, wie wir auch darauf verzichten, die
reichhaltigen und aufschlußreichen Bemerkungen zur Geschichte der Schleier-
macherschen Gedanken wiederzugeben.
Das Gesagte genügt vollauf, um zu zeigen, daß Odebrechts hohe Einschätzung
der Schleiermacherschen Lehre durchaus gerechtfertigt ist. Sie scheint sowohl
ihren Fragestellungen wie ihren Lösungsversuchen nach berufen, in die heutigen
Entscheidungen einzugreifen. Ob allerdings Odebrechts Darstellung durchweg end-
gültig ist, bleibt fraglich. Er ist sicherlich im Recht, wenn er die frühen Nieder-
schriften als die maßgeblichen bezeichnet. Aber es wäre zu untersuchen, wie das
BESPRECHUNGEN.
hat in niemandem außer Dilthey Nachfolge gefunden. Zwar betont Odebrecht
— sehr zu Recht — die engen Beziehungen zur vorkantischen Überlieferung,
besonders zu Eberhard, und die Verknüpfung mit der Romantik. Aber das
Orundmoment sieht er in Schleiermachers Lehre von der Spontaneität des bildenden
Gefühls und in der „Lebensnähe" seiner Kunstauffassung. Nur der Rückgang auf
die ursprüngliche, konkrete Aktivität, auf das Hervorbringen selbst kann uns über
das Kunstwerk belehren. Der ästhetische Wert liegt in der schöpferischen Dynamik.
Gefühl ist der Mittelpunkt, aber Gefühl ist nicht alles. So geht die ästhetische
Frage auf die Gesetze der Gefühlsgestaltung. Gefühl und Gedanke zusammen sind
in jeder symbolisierenden, d. h. künstlerischen Tätigkeit. Für das Denken ist die
Vereinigung von Subjekt und Objekt unendliche Aufgabe, aber jede erreichte Er-
kenntnis kann unbeschränkt übertragen werden. Für das Gefühl ist die Identität
des Idealen und des Realen gegeben, aber sie kann, als besondere, nicht vermittelt
werden. Daraus erwachsen die Aufgaben der Kunst: die Relativität der einzelnen
Momente des Gefühls zum Absoluten der beharrenden Stimmung zu steigern und
diese dann in der Darstellung zu offenbaren. Der Schaffende gewinnt aus der
Idee die Darstellung, der Aufnehmende aus der Darstellung die Idee. So tritt an
die Stelle der Kantischen Scheidung von Geschmack und Genie die Lehre von der
Alleinheit der schöpferischen Kraft. Mit modernen Worten gesprochen: aus der
Aesthetik wird eine Poietik, aus der Theorie des Kunstgenusses die Lehre von
dem schöpferischen Vermögen im Menschen, das nicht weniger die Grundlage des
Kunstverstehens als die des Schaffens ist. „Nicht das Werk, das Wirken ist der
Wert" (S. 152). Der ästhetische Gegenstand ist der Schein, in dem die innere
Produktivität sichtbar wird: Die Erregung unterwirft sich der Besinnung, Stim-
mung als Beharrliches entsteht und schafft sich ein „Urbild", das letzte ist die
Ausbildung durch das gebildete Organ. So ist die freie Tätigkeit des Sich-affizieren-
lassens, die Phantasie als die Identität von Besinnung und Begeisterung die Quelle.
— Damit tritt das Problem der Verständlichkeit der Kunst auf. Denn allerdings:
die Darstellung muß etwas Allgemeines zum Grunde haben, wenn sie die Funktion
der Mitteilung der Produktivität soll übernehmen können. Vollkommenheit wird
zum Erfordernis: „Elementarische", die erreicht wird, wenn die Besinnung aus der
verworrenen Erregung das „Urbild" des Kunstwerks herausgehoben hat, und
„organische", die das Werk gegen die Welt abschließt, so daß es „selbst sein
eigener Rahmen ist" (S. 138). Zugleich wird eine Art von Soziologie nötig: der
Künstler will verstanden werden; es ist also unerläßlich, daß er in einer Gemein-
schaft steht, die ihm die Mittel verständlichen Ausdrucks an die Hand gibt. Damit
wird der Begriff der Nation in der Entwicklung der Schleiermacherschen Aesthetik
immer wichtiger, mit ihm, teilweise gegen ihn, der Begriff des organischen Vereins
der Kirche, in der Fuhlen-wollen und Wahlanziehung ihre Verkörperung finden.
Die Schwierigkeiten, die sich aus dem Widerstreit dieser beiden Arten der Gemein-
samkeit ergeben, und die bei Odebrecht zu einer ausgezeichneten Darstellung ge-
langen, sollen hier nicht verfolgt werden, wie wir auch darauf verzichten, die
reichhaltigen und aufschlußreichen Bemerkungen zur Geschichte der Schleier-
macherschen Gedanken wiederzugeben.
Das Gesagte genügt vollauf, um zu zeigen, daß Odebrechts hohe Einschätzung
der Schleiermacherschen Lehre durchaus gerechtfertigt ist. Sie scheint sowohl
ihren Fragestellungen wie ihren Lösungsversuchen nach berufen, in die heutigen
Entscheidungen einzugreifen. Ob allerdings Odebrechts Darstellung durchweg end-
gültig ist, bleibt fraglich. Er ist sicherlich im Recht, wenn er die frühen Nieder-
schriften als die maßgeblichen bezeichnet. Aber es wäre zu untersuchen, wie das