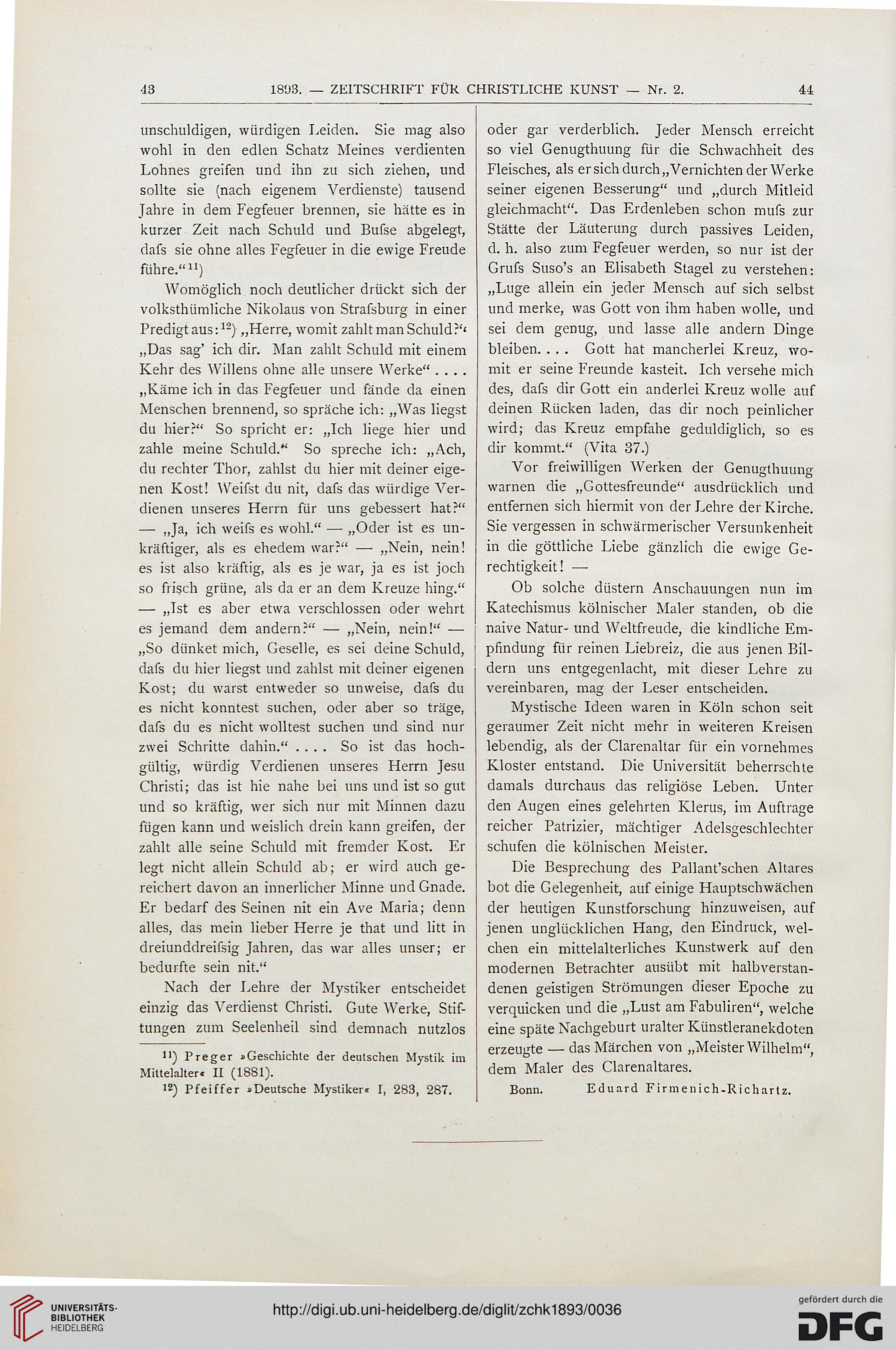13
1803. — ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST — Nr. 2.
44
unschuldigen, würdigen Leiden. Sie mag also
wohl in den edlen Schatz Meines verdienten
Lohnes greifen und ihn zu sich ziehen, und
sollte sie (nach eigenem Verdienste) tausend
Jahre in dem Fegfeuer brennen, sie hätte es in
kurzer Zeit nach Schuld und Bufse abgelegt,
dafs sie ohne alles Fegfeuer in die ewige Freude
führe."11)
Womöglich noch deutlicher drückt sich der
volksthümliche Nikolaus von Strafsburg in einer
Predigtaus:12) „Herre, womit zahlt man Schuld:''
„Das sag' ich dir. Man zahlt Schuld mit einem
Kehr des Willens ohne alle unsere Werke" ....
„Käme ich in das Fegfeuer und fände da einen
Menschen brennend, so spräche ich: „Was liegst
du hier?" So spricht er: „Ich liege hier und
zahle meine Schuld." So spreche ich: „Ach,
du rechter Thor, zahlst du hier mit deiner eige-
nen Kost! Weifst du nit, dafs das würdige Ver-
dienen unseres Herrn für uns gebessert hat?"
— „Ja, ich weifs es wohl." — „Oder ist es un-
kräftiger, als es ehedem war?" — „Nein, nein!
es ist also kräftig, als es je war, ja es ist joch
so frisch grüne, als da er an dem Kreuze hing."
— „Ist es aber etwa verschlossen oder wehrt
es jemand dem andern?" —■ „Nein, nein!" —
„So dünket mich, Geselle, es sei deine Schuld,
dafs du hier liegst und zahlst mit deiner eigenen
Kost; du warst entweder so unweise, dafs du
es nicht konntest suchen, oder aber so träge,
dafs du es nicht wolltest suchen und sind nur
zwei Schritte dahin." .... So ist das hoch-
gültig, würdig Verdienen unseres Herrn Jesu
Christi; das ist hie nahe bei uns und ist so gut
und so kräftig, wer sich nur mit Minnen dazu
fügen kann und weislich drein kann greifen, der
zahlt alle seine Schuld mit fremder Kost. Er
legt nicht allein Schuld ab; er wird auch ge-
reichert davon an innerlicher Minne und Gnade.
Er bedarf des Seinen nit ein Ave Maria; denn
alles, das mein lieber Herre je that und litt in
dreiunddreifsig Jahren, das war alles unser; er
bedurfte sein nit."
Nach der Lehre der Mystiker entscheidet
einzig das Verdienst Christi. Gute Werke, Stif-
tungen zum Seelenheil sind demnach nutzlos
n) Preger »Geschichte der deutschen Mystik im
Mittelalter« II (1881).
•2) Pfeiffer »Deutsche Mystiker« I, 283, 287.
oder gar verderblich. Jeder Mensch erreicht
so viel Genugthuung für die Schwachheit des
Fleisches, als er sich durch „Vernichten der Werke
seiner eigenen Besserung" und „durch Mitleid
gleichmacht". Das Erdenleben schon mufs zur
Stätte der Läuterung durch passives Leiden,
d. h. also zum Fegfeuer werden, so nur ist der
Grufs Suso's an Elisabeth Stagel zu verstehen:
„Luge allein ein jeder Mensch auf sich selbst
und merke, was Gott von ihm haben wolle, und
sei dem genug, und lasse alle andern Dinge
bleiben. . . . Gott hat mancherlei Kreuz, wo-
mit er seine Freunde kasteit. Ich versehe mich
des, dafs dir Gott ein anderlei Kreuz wolle auf
deinen Rücken laden, das dir noch peinlicher
wird; das Kreuz empfahe geduldiglicb, so es
dir kommt." (Vita 37.)
Vor freiwilligen Werken der Genugthuung
warnen die „Gottesfreunde" ausdrücklich und
entfernen sich hiermit von der Lehre der Kirche.
Sie vergessen in schwärmerischer Versunkenheit
in die göttliche Liebe gänzlich die ewige Ge-
rechtigkeit! —■
Ob solche düstern Anschauungen nun im
Katechismus kölnischer Maler standen, ob die
naive Natur- und Weltfreude, die kindliche Em-
pfindung für reinen Liebreiz, die aus jenen Bil-
dern uns entgegenlacht, mit dieser Lehre zu
vereinbaren, mag der Leser entscheiden.
Mystische Ideen waren in Köln schon seit
geraumer Zeit nicht mehr in weiteren Kreisen
lebendig, als der Ciarenaltar für ein vornehmes
Kloster entstand. Die Universität beherrschte
damals durchaus das religiöse Leben. Unter
den Augen eines gelehrten Klerus, im Auftrage
reicher Patrizier, mächtiger Adelsgeschlechter
schufen die kölnischen Meisler.
Die Besprechung des Pallant'schen Altares
bot die Gelegenheit, auf einige Hauptschwächen
der heutigen Kunstforschung hinzuweisen, auf
jenen unglücklichen Hang, den Eindruck, wel-
chen ein mittelalterliches Kunstwerk auf den
modernen Betrachter ausübt mit halbverstan-
denen geistigen Strömungen dieser Epoche zu
verquicken und die „Lust am Fabuliren", welche
eine späte Nachgeburt uralter Künstleranekdoten
erzeugte — das Märchen von „Meister Wilhelm",
dem Maler des Clarenaltares.
Bonn. Eduard Firmenich-Richartz.
1803. — ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST — Nr. 2.
44
unschuldigen, würdigen Leiden. Sie mag also
wohl in den edlen Schatz Meines verdienten
Lohnes greifen und ihn zu sich ziehen, und
sollte sie (nach eigenem Verdienste) tausend
Jahre in dem Fegfeuer brennen, sie hätte es in
kurzer Zeit nach Schuld und Bufse abgelegt,
dafs sie ohne alles Fegfeuer in die ewige Freude
führe."11)
Womöglich noch deutlicher drückt sich der
volksthümliche Nikolaus von Strafsburg in einer
Predigtaus:12) „Herre, womit zahlt man Schuld:''
„Das sag' ich dir. Man zahlt Schuld mit einem
Kehr des Willens ohne alle unsere Werke" ....
„Käme ich in das Fegfeuer und fände da einen
Menschen brennend, so spräche ich: „Was liegst
du hier?" So spricht er: „Ich liege hier und
zahle meine Schuld." So spreche ich: „Ach,
du rechter Thor, zahlst du hier mit deiner eige-
nen Kost! Weifst du nit, dafs das würdige Ver-
dienen unseres Herrn für uns gebessert hat?"
— „Ja, ich weifs es wohl." — „Oder ist es un-
kräftiger, als es ehedem war?" — „Nein, nein!
es ist also kräftig, als es je war, ja es ist joch
so frisch grüne, als da er an dem Kreuze hing."
— „Ist es aber etwa verschlossen oder wehrt
es jemand dem andern?" —■ „Nein, nein!" —
„So dünket mich, Geselle, es sei deine Schuld,
dafs du hier liegst und zahlst mit deiner eigenen
Kost; du warst entweder so unweise, dafs du
es nicht konntest suchen, oder aber so träge,
dafs du es nicht wolltest suchen und sind nur
zwei Schritte dahin." .... So ist das hoch-
gültig, würdig Verdienen unseres Herrn Jesu
Christi; das ist hie nahe bei uns und ist so gut
und so kräftig, wer sich nur mit Minnen dazu
fügen kann und weislich drein kann greifen, der
zahlt alle seine Schuld mit fremder Kost. Er
legt nicht allein Schuld ab; er wird auch ge-
reichert davon an innerlicher Minne und Gnade.
Er bedarf des Seinen nit ein Ave Maria; denn
alles, das mein lieber Herre je that und litt in
dreiunddreifsig Jahren, das war alles unser; er
bedurfte sein nit."
Nach der Lehre der Mystiker entscheidet
einzig das Verdienst Christi. Gute Werke, Stif-
tungen zum Seelenheil sind demnach nutzlos
n) Preger »Geschichte der deutschen Mystik im
Mittelalter« II (1881).
•2) Pfeiffer »Deutsche Mystiker« I, 283, 287.
oder gar verderblich. Jeder Mensch erreicht
so viel Genugthuung für die Schwachheit des
Fleisches, als er sich durch „Vernichten der Werke
seiner eigenen Besserung" und „durch Mitleid
gleichmacht". Das Erdenleben schon mufs zur
Stätte der Läuterung durch passives Leiden,
d. h. also zum Fegfeuer werden, so nur ist der
Grufs Suso's an Elisabeth Stagel zu verstehen:
„Luge allein ein jeder Mensch auf sich selbst
und merke, was Gott von ihm haben wolle, und
sei dem genug, und lasse alle andern Dinge
bleiben. . . . Gott hat mancherlei Kreuz, wo-
mit er seine Freunde kasteit. Ich versehe mich
des, dafs dir Gott ein anderlei Kreuz wolle auf
deinen Rücken laden, das dir noch peinlicher
wird; das Kreuz empfahe geduldiglicb, so es
dir kommt." (Vita 37.)
Vor freiwilligen Werken der Genugthuung
warnen die „Gottesfreunde" ausdrücklich und
entfernen sich hiermit von der Lehre der Kirche.
Sie vergessen in schwärmerischer Versunkenheit
in die göttliche Liebe gänzlich die ewige Ge-
rechtigkeit! —■
Ob solche düstern Anschauungen nun im
Katechismus kölnischer Maler standen, ob die
naive Natur- und Weltfreude, die kindliche Em-
pfindung für reinen Liebreiz, die aus jenen Bil-
dern uns entgegenlacht, mit dieser Lehre zu
vereinbaren, mag der Leser entscheiden.
Mystische Ideen waren in Köln schon seit
geraumer Zeit nicht mehr in weiteren Kreisen
lebendig, als der Ciarenaltar für ein vornehmes
Kloster entstand. Die Universität beherrschte
damals durchaus das religiöse Leben. Unter
den Augen eines gelehrten Klerus, im Auftrage
reicher Patrizier, mächtiger Adelsgeschlechter
schufen die kölnischen Meisler.
Die Besprechung des Pallant'schen Altares
bot die Gelegenheit, auf einige Hauptschwächen
der heutigen Kunstforschung hinzuweisen, auf
jenen unglücklichen Hang, den Eindruck, wel-
chen ein mittelalterliches Kunstwerk auf den
modernen Betrachter ausübt mit halbverstan-
denen geistigen Strömungen dieser Epoche zu
verquicken und die „Lust am Fabuliren", welche
eine späte Nachgeburt uralter Künstleranekdoten
erzeugte — das Märchen von „Meister Wilhelm",
dem Maler des Clarenaltares.
Bonn. Eduard Firmenich-Richartz.