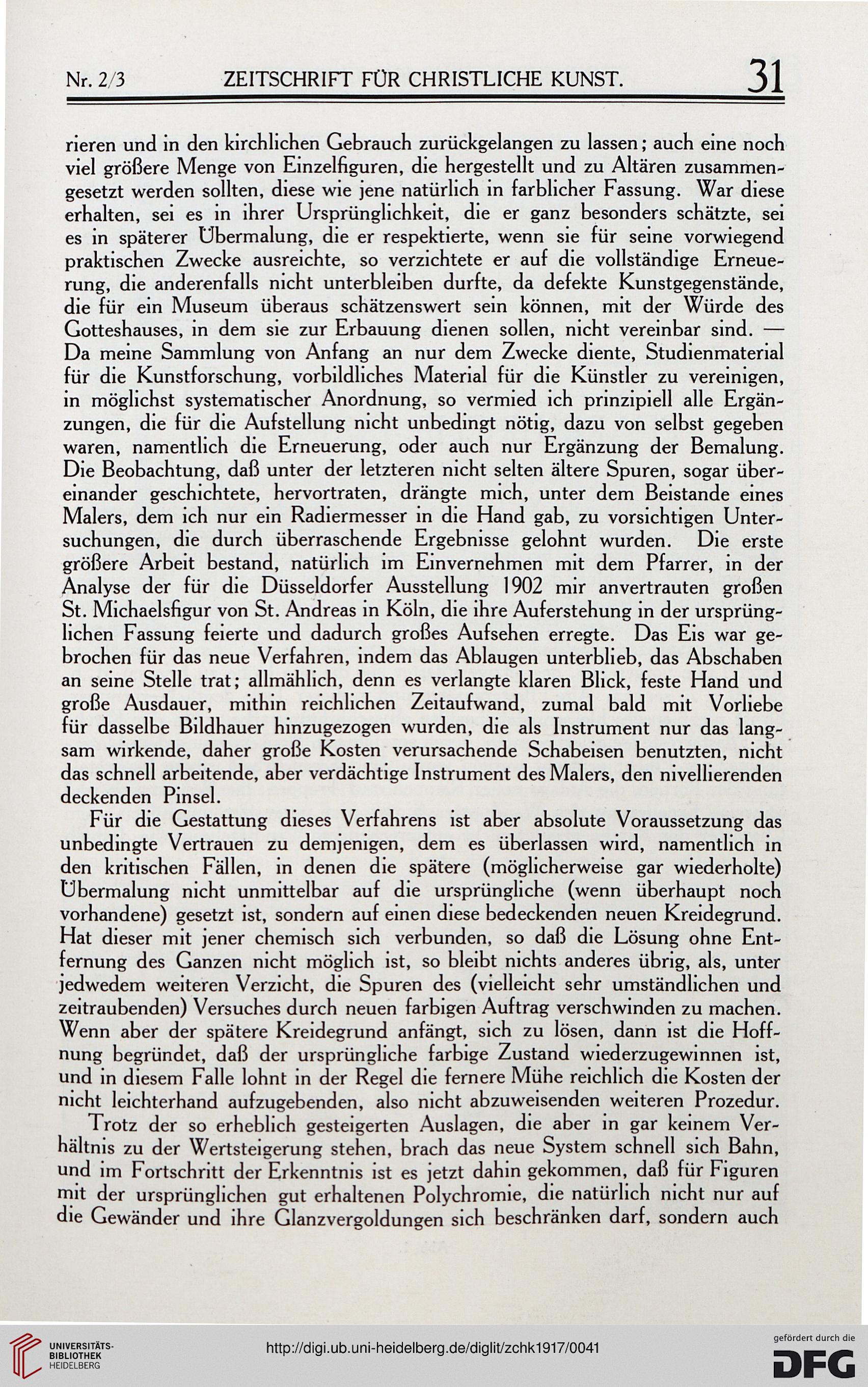Nr. 2/3__________ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST._____________31
rieren und in den kirchlichen Gebrauch zurückgelangen zu lassen; auch eine noch
viel größere Menge von Einzelfiguren, die hergestellt und zu Altären zusammen-
gesetzt werden sollten, diese wie jene natürlich in farblicher Fassung. War diese
erhalten, sei es in ihrer Ursprünglichkeit, die er ganz besonders schätzte, sei
es in späterer Ubermalung, die er respektierte, wenn sie für seine vorwiegend
praktischen Zwecke ausreichte, so verzichtete er auf die vollständige Erneue-
rung, die anderenfalls nicht unterbleiben durfte, da defekte Kunstgegenstände,
die für ein Museum überaus schätzenswert sein können, mit der Würde des
Gotteshauses, in dem sie zur Erbauung dienen sollen, nicht vereinbar sind. —
Da meine Sammlung von Anfang an nur dem Zwecke diente, Studienmaterial
für die Kunstforschung, vorbildliches Material für die Künstler zu vereinigen,
in möglichst systematischer Anordnung, so vermied ich prinzipiell alle Ergän-
zungen, die für die Aufstellung nicht unbedingt nötig, dazu von selbst gegeben
waren, namentlich die Erneuerung, oder auch nur Ergänzung der Bemalung.
Die Beobachtung, daß unter der letzteren nicht selten ältere Spuren, sogar über-
einander geschichtete, hervortraten, drängte mich, unter dem Beistande eines
Malers, dem ich nur ein Radiermesser in die Hand gab, zu vorsichtigen Unter-
suchungen, die durch überraschende Ergebnisse gelohnt wurden. Die erste
größere Arbeit bestand, natürlich im Einvernehmen mit dem Pfarrer, in der
Analyse der für die Düsseldorfer Ausstellung 1902 mir anvertrauten großen
St. Michaelsfigur von St. Andreas in Köln, die ihre Auferstehung in der ursprüng-
lichen Fassung feierte und dadurch großes Aufsehen erregte. Das Eis war ge-
brochen für das neue Verfahren, indem das Ablaugen unterblieb, das Abschaben
an seine Stelle trat; allmählich, denn es verlangte klaren Blick, feste Hand und
große Ausdauer, mithin reichlichen Zeitaufwand, zumal bald mit Vorliebe
für dasselbe Bildhauer hinzugezogen wurden, die als Instrument nur das lang-
sam wirkende, daher große Kosten verursachende Schabeisen benutzten, nicht
das schnell arbeitende, aber verdächtige Instrument des Malers, den nivellierenden
deckenden Pinsel.
Für die Gestattung dieses Verfahrens ist aber absolute Voraussetzung das
unbedingte Vertrauen zu demjenigen, dem es überlassen wird, namentlich in
den kritischen Fällen, in denen die spätere (möglicherweise gar wiederholte)
Ubermalung nicht unmittelbar auf die ursprüngliche (wenn überhaupt noch
vorhandene) gesetzt ist, sondern auf einen diese bedeckenden neuen Kreidegrund.
Hat dieser mit jener chemisch sich verbunden, so daß die Lösung ohne Ent-
fernung des Ganzen nicht möglich ist, so bleibt nichts anderes übrig, als, unter
jedwedem weiteren Verzicht, die Spuren des (vielleicht sehr umständlichen und
zeitraubenden) Versuches durch neuen farbigen Auftrag verschwinden zu machen.
Wenn aber der spätere Kreidegrund anfängt, sich zu lösen, dann ist die Hoff-
nung begründet, daß der ursprüngliche farbige Zustand wiederzugewinnen ist,
und in diesem Falle lohnt in der Regel die fernere Mühe reichlich die Kosten der
nicht leichterhand aufzugebenden, also nicht abzuweisenden weiteren Prozedur.
Trotz der so erheblich gesteigerten Auslagen, die aber in gar keinem Ver-
hältnis zu der Wertsteigerung stehen, brach das neue System schnell sich Bahn,
und im Fortschritt der Erkenntnis ist es jetzt dahin gekommen, daß für Figuren
mit der ursprünglichen gut erhaltenen Polychromie, die natürlich nicht nur auf
die Gewänder und ihre Glanzvergoldungen sich beschränken darf, sondern auch
rieren und in den kirchlichen Gebrauch zurückgelangen zu lassen; auch eine noch
viel größere Menge von Einzelfiguren, die hergestellt und zu Altären zusammen-
gesetzt werden sollten, diese wie jene natürlich in farblicher Fassung. War diese
erhalten, sei es in ihrer Ursprünglichkeit, die er ganz besonders schätzte, sei
es in späterer Ubermalung, die er respektierte, wenn sie für seine vorwiegend
praktischen Zwecke ausreichte, so verzichtete er auf die vollständige Erneue-
rung, die anderenfalls nicht unterbleiben durfte, da defekte Kunstgegenstände,
die für ein Museum überaus schätzenswert sein können, mit der Würde des
Gotteshauses, in dem sie zur Erbauung dienen sollen, nicht vereinbar sind. —
Da meine Sammlung von Anfang an nur dem Zwecke diente, Studienmaterial
für die Kunstforschung, vorbildliches Material für die Künstler zu vereinigen,
in möglichst systematischer Anordnung, so vermied ich prinzipiell alle Ergän-
zungen, die für die Aufstellung nicht unbedingt nötig, dazu von selbst gegeben
waren, namentlich die Erneuerung, oder auch nur Ergänzung der Bemalung.
Die Beobachtung, daß unter der letzteren nicht selten ältere Spuren, sogar über-
einander geschichtete, hervortraten, drängte mich, unter dem Beistande eines
Malers, dem ich nur ein Radiermesser in die Hand gab, zu vorsichtigen Unter-
suchungen, die durch überraschende Ergebnisse gelohnt wurden. Die erste
größere Arbeit bestand, natürlich im Einvernehmen mit dem Pfarrer, in der
Analyse der für die Düsseldorfer Ausstellung 1902 mir anvertrauten großen
St. Michaelsfigur von St. Andreas in Köln, die ihre Auferstehung in der ursprüng-
lichen Fassung feierte und dadurch großes Aufsehen erregte. Das Eis war ge-
brochen für das neue Verfahren, indem das Ablaugen unterblieb, das Abschaben
an seine Stelle trat; allmählich, denn es verlangte klaren Blick, feste Hand und
große Ausdauer, mithin reichlichen Zeitaufwand, zumal bald mit Vorliebe
für dasselbe Bildhauer hinzugezogen wurden, die als Instrument nur das lang-
sam wirkende, daher große Kosten verursachende Schabeisen benutzten, nicht
das schnell arbeitende, aber verdächtige Instrument des Malers, den nivellierenden
deckenden Pinsel.
Für die Gestattung dieses Verfahrens ist aber absolute Voraussetzung das
unbedingte Vertrauen zu demjenigen, dem es überlassen wird, namentlich in
den kritischen Fällen, in denen die spätere (möglicherweise gar wiederholte)
Ubermalung nicht unmittelbar auf die ursprüngliche (wenn überhaupt noch
vorhandene) gesetzt ist, sondern auf einen diese bedeckenden neuen Kreidegrund.
Hat dieser mit jener chemisch sich verbunden, so daß die Lösung ohne Ent-
fernung des Ganzen nicht möglich ist, so bleibt nichts anderes übrig, als, unter
jedwedem weiteren Verzicht, die Spuren des (vielleicht sehr umständlichen und
zeitraubenden) Versuches durch neuen farbigen Auftrag verschwinden zu machen.
Wenn aber der spätere Kreidegrund anfängt, sich zu lösen, dann ist die Hoff-
nung begründet, daß der ursprüngliche farbige Zustand wiederzugewinnen ist,
und in diesem Falle lohnt in der Regel die fernere Mühe reichlich die Kosten der
nicht leichterhand aufzugebenden, also nicht abzuweisenden weiteren Prozedur.
Trotz der so erheblich gesteigerten Auslagen, die aber in gar keinem Ver-
hältnis zu der Wertsteigerung stehen, brach das neue System schnell sich Bahn,
und im Fortschritt der Erkenntnis ist es jetzt dahin gekommen, daß für Figuren
mit der ursprünglichen gut erhaltenen Polychromie, die natürlich nicht nur auf
die Gewänder und ihre Glanzvergoldungen sich beschränken darf, sondern auch