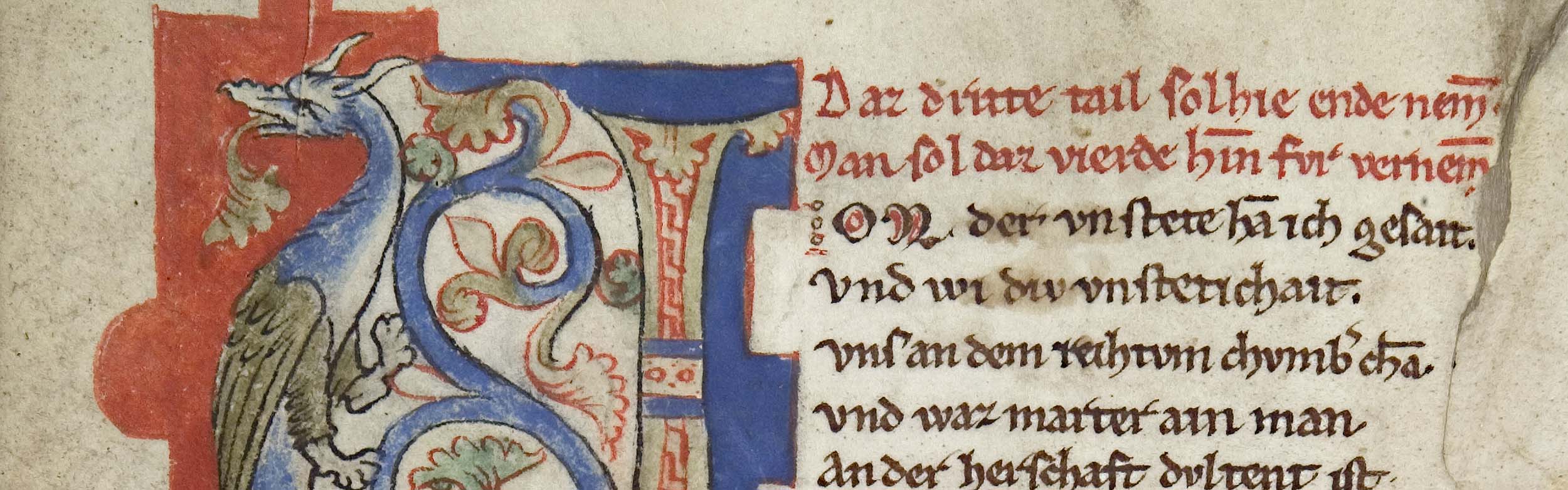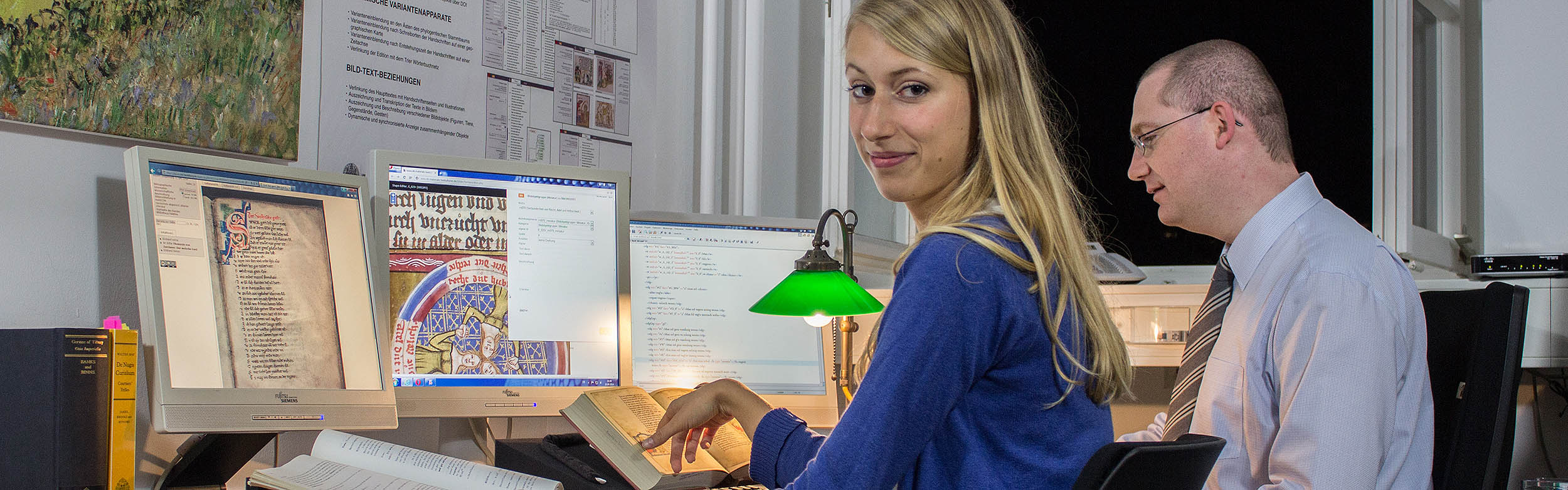Welscher Gast digital
Mehr als eine Textausgabe
Erste umfassende mittelhochdeutsche Verhaltenslehre
in 24 mittelalterlichen Handschriften
Sonderforschungsbereich ›Materiale Textkulturen‹
Ein Kooperationsprojekt
Universitätsbibliothek Heidelberg
Philologie & Kunstgeschichte
Editionswissenschaft & Digital Humanities
Editionswissenschaft & Digital Humanities
Digitale Text-Bild-Ausgabe im Open Access
Ein Kooperationsprojekt des
Sonderforschungsbereichs ›Materiale Textkulturen‹
und der Universitätsbibliothek Heidelberg
Welscher Gast digital