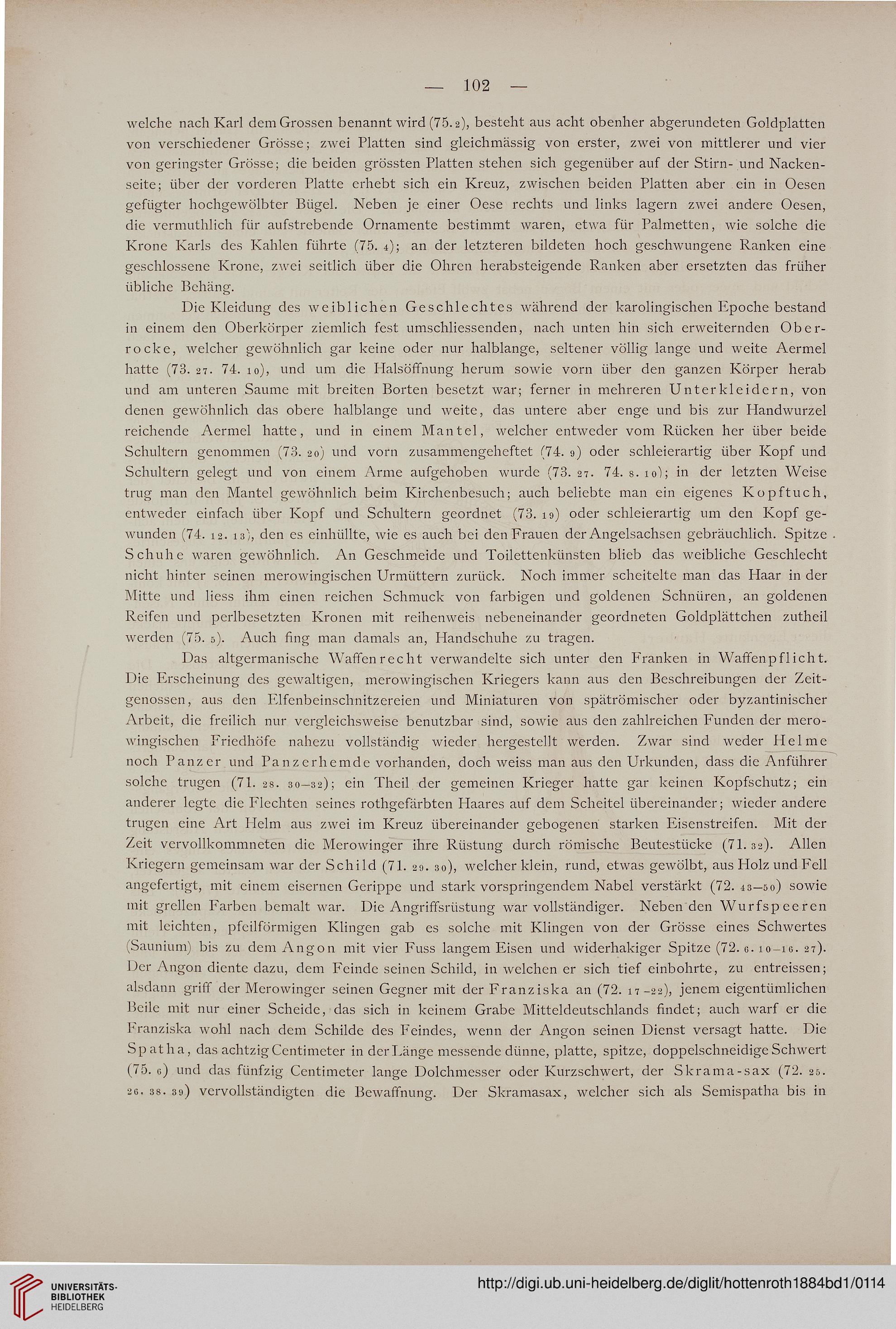— 102 —
welche nach Karl dem Grossen benannt wird (75.2), besteht aus acht obenher abgerundeten Goldplatten
von verschiedener Grösse; zwei Platten sind gleichmässig von erster, zwei von mittlerer und vier
von geringster Grösse; die beiden grössten Platten stehen sich gegenüber auf der Stirn- und Nacken-
seite; über der vorderen Platte erhebt sich ein Kreuz, zwischen beiden Platten aber ein in Oesen
gefügter hochgewölbter Bügel. Neben je einer Oese rechts und links lagern zwei andere Oesen,
die vermuthlich für aufstrebende Ornamente bestimmt waren, etwa für Palmetten, wie solche die
Krone Karls des Kahlen führte (75. i); an der letzteren bildeten hoch geschwungene Ranken eine
geschlossene Krone, zwei seitlich über die Ohren herabsteigende Ranken aber ersetzten das früher
übliche Behäng.
Die Kleidung des weiblichen Geschlechtes während der karolingischen Epoche bestand
in einem den Oberkörper ziemlich fest umschliessenden, nach unten hin sich erweiternden Ober-
rocke, welcher gewöhnlich gar keine oder nur halblange, seltener völlig lange und weite Aermel
hatte (73. 27. 74. 10), und um die Halsöffnung herum sowie vorn über den ganzen Körper herab
und am unteren Saume mit breiten Borten besetzt war; ferner in mehreren Unterkleidern, von
denen gewöhnlich das obere halblange und weite, das untere aber enge und bis zur Handwurzel
reichende Aermel hatte, und in einem Mantel, welcher entweder vom Rücken her über beide
Schultern genommen (73. 20) und vorn zusammengeheftet (74. 9) oder schleierartig über Kopf und
Schultern gelegt und von einem Arme aufgehoben wurde (73. 27. 74. s. 10); in der letzten Weise
trug man den Mantel gewöhnlich beim Kirchenbesuch; auch beliebte man ein eigenes Kopftuch,
entweder einfach über Kopf und Schultern geordnet (73. 19) oder schleierartig um den Kopf ge-
wunden (74. 12. 13), den es einhüllte, wie es auch bei den Frauen der Angelsachsen gebräuchlich. Spitze
Schuhe waren gewöhnlich. An Geschmeide und Toilettenkünsten blieb das weibliche Geschlecht
nicht hinter seinen merowingischen Urmüttern zurück. Noch immer scheitelte man das Haar in der
Mitte und Hess ihm einen reichen Schmuck von farbigen und goldenen Schnüren, an goldenen
Reifen und perlbesetzten Kronen mit reihenweis nebeneinander geordneten Goldplättchen zutheil
werden (75. 5). Auch fing man damals an, Handschuhe zu tragen.
Das altgermanische Waffen recht verwandelte sich unter den Franken in Waffenpflicht.
Die Erscheinung des gewaltigen, merowingischen Kriegers kann aus den Beschreibungen der Zeit-
genossen, aus den Elfenbeinschnitzereien und Miniaturen von spätrömischer oder byzantinischer
Arbeit, die freilich nur vergleichsweise benutzbar sind, sowie aus den zahlreichen Funden der mero-
wingischen Friedhöfe nahezu vollständig wieder hergestellt werden. Zwar sind weder Helme
noch Panzer und Panzerhemde vorhanden, doch weiss man aus den Urkunden, dass die Anführer
solche trugen (71. 28. 30-32); ein Theil der gemeinen Krieger hatte gar keinen Kopfschutz; ein
anderer legte die Flechten seines rothgefärbten Haares auf dem Scheitel übereinander; wieder andere
trugen eine Art Helm aus zwei im Kreuz übereinander gebogenen starken Eisenstreifen. Mit der
Zeit vervollkommneten die Merowinger ihre Rüstung durch römische Beutestücke (71. 32). Allen
Kriegern gemeinsam war der Schild (71. 29. 30), welcher klein, rund, etwas gewölbt, aus Holz und Fell
angefertigt, mit einem eisernen Gerippe und stark vorspringendem Nabel verstärkt (72. 43—so) sowie
mit grellen Farben bemalt war. Die Angriffsrüstung war vollständiger. Nebenden Wurfspeeren
mit leichten, pfeilförmigen Klingen gab es solche mit Klingen von der Grösse eines Schwertes
(Saunium) bis zu dem Angon mit vier Fuss langem Eisen und widerhakiger Spitze (72. g. 10-10. 27).
Der Angon diente dazu, dem Feinde seinen Schild, in welchen er sich tief einbohrte, zu entreissen;
alsdann griff der Merowinger seinen Gegner mit der Franziska an (72. 17-22), jenem eigentümlichen
Beile mit nur einer Scheide, das sich in keinem Grabe Mitteldeutschlands findet; auch warf er die
Franziska wohl nach dem Schilde des Feindes, wenn der Angon seinen Dienst versagt hatte. Die
Spat ha, das achtzig Ccntimctcr in derEänge messende dünne, platte, spitze, doppelschneidige Schwert
(75. 0) und das fünfzig Centimeter lange Dolchmesser oder Kurzschwert, der Skrama-sax (72. 25.
26. 38. 39) vervollständigten die Bewaffnung. Der Skramasax, welcher sich als Semispatha bis in
welche nach Karl dem Grossen benannt wird (75.2), besteht aus acht obenher abgerundeten Goldplatten
von verschiedener Grösse; zwei Platten sind gleichmässig von erster, zwei von mittlerer und vier
von geringster Grösse; die beiden grössten Platten stehen sich gegenüber auf der Stirn- und Nacken-
seite; über der vorderen Platte erhebt sich ein Kreuz, zwischen beiden Platten aber ein in Oesen
gefügter hochgewölbter Bügel. Neben je einer Oese rechts und links lagern zwei andere Oesen,
die vermuthlich für aufstrebende Ornamente bestimmt waren, etwa für Palmetten, wie solche die
Krone Karls des Kahlen führte (75. i); an der letzteren bildeten hoch geschwungene Ranken eine
geschlossene Krone, zwei seitlich über die Ohren herabsteigende Ranken aber ersetzten das früher
übliche Behäng.
Die Kleidung des weiblichen Geschlechtes während der karolingischen Epoche bestand
in einem den Oberkörper ziemlich fest umschliessenden, nach unten hin sich erweiternden Ober-
rocke, welcher gewöhnlich gar keine oder nur halblange, seltener völlig lange und weite Aermel
hatte (73. 27. 74. 10), und um die Halsöffnung herum sowie vorn über den ganzen Körper herab
und am unteren Saume mit breiten Borten besetzt war; ferner in mehreren Unterkleidern, von
denen gewöhnlich das obere halblange und weite, das untere aber enge und bis zur Handwurzel
reichende Aermel hatte, und in einem Mantel, welcher entweder vom Rücken her über beide
Schultern genommen (73. 20) und vorn zusammengeheftet (74. 9) oder schleierartig über Kopf und
Schultern gelegt und von einem Arme aufgehoben wurde (73. 27. 74. s. 10); in der letzten Weise
trug man den Mantel gewöhnlich beim Kirchenbesuch; auch beliebte man ein eigenes Kopftuch,
entweder einfach über Kopf und Schultern geordnet (73. 19) oder schleierartig um den Kopf ge-
wunden (74. 12. 13), den es einhüllte, wie es auch bei den Frauen der Angelsachsen gebräuchlich. Spitze
Schuhe waren gewöhnlich. An Geschmeide und Toilettenkünsten blieb das weibliche Geschlecht
nicht hinter seinen merowingischen Urmüttern zurück. Noch immer scheitelte man das Haar in der
Mitte und Hess ihm einen reichen Schmuck von farbigen und goldenen Schnüren, an goldenen
Reifen und perlbesetzten Kronen mit reihenweis nebeneinander geordneten Goldplättchen zutheil
werden (75. 5). Auch fing man damals an, Handschuhe zu tragen.
Das altgermanische Waffen recht verwandelte sich unter den Franken in Waffenpflicht.
Die Erscheinung des gewaltigen, merowingischen Kriegers kann aus den Beschreibungen der Zeit-
genossen, aus den Elfenbeinschnitzereien und Miniaturen von spätrömischer oder byzantinischer
Arbeit, die freilich nur vergleichsweise benutzbar sind, sowie aus den zahlreichen Funden der mero-
wingischen Friedhöfe nahezu vollständig wieder hergestellt werden. Zwar sind weder Helme
noch Panzer und Panzerhemde vorhanden, doch weiss man aus den Urkunden, dass die Anführer
solche trugen (71. 28. 30-32); ein Theil der gemeinen Krieger hatte gar keinen Kopfschutz; ein
anderer legte die Flechten seines rothgefärbten Haares auf dem Scheitel übereinander; wieder andere
trugen eine Art Helm aus zwei im Kreuz übereinander gebogenen starken Eisenstreifen. Mit der
Zeit vervollkommneten die Merowinger ihre Rüstung durch römische Beutestücke (71. 32). Allen
Kriegern gemeinsam war der Schild (71. 29. 30), welcher klein, rund, etwas gewölbt, aus Holz und Fell
angefertigt, mit einem eisernen Gerippe und stark vorspringendem Nabel verstärkt (72. 43—so) sowie
mit grellen Farben bemalt war. Die Angriffsrüstung war vollständiger. Nebenden Wurfspeeren
mit leichten, pfeilförmigen Klingen gab es solche mit Klingen von der Grösse eines Schwertes
(Saunium) bis zu dem Angon mit vier Fuss langem Eisen und widerhakiger Spitze (72. g. 10-10. 27).
Der Angon diente dazu, dem Feinde seinen Schild, in welchen er sich tief einbohrte, zu entreissen;
alsdann griff der Merowinger seinen Gegner mit der Franziska an (72. 17-22), jenem eigentümlichen
Beile mit nur einer Scheide, das sich in keinem Grabe Mitteldeutschlands findet; auch warf er die
Franziska wohl nach dem Schilde des Feindes, wenn der Angon seinen Dienst versagt hatte. Die
Spat ha, das achtzig Ccntimctcr in derEänge messende dünne, platte, spitze, doppelschneidige Schwert
(75. 0) und das fünfzig Centimeter lange Dolchmesser oder Kurzschwert, der Skrama-sax (72. 25.
26. 38. 39) vervollständigten die Bewaffnung. Der Skramasax, welcher sich als Semispatha bis in