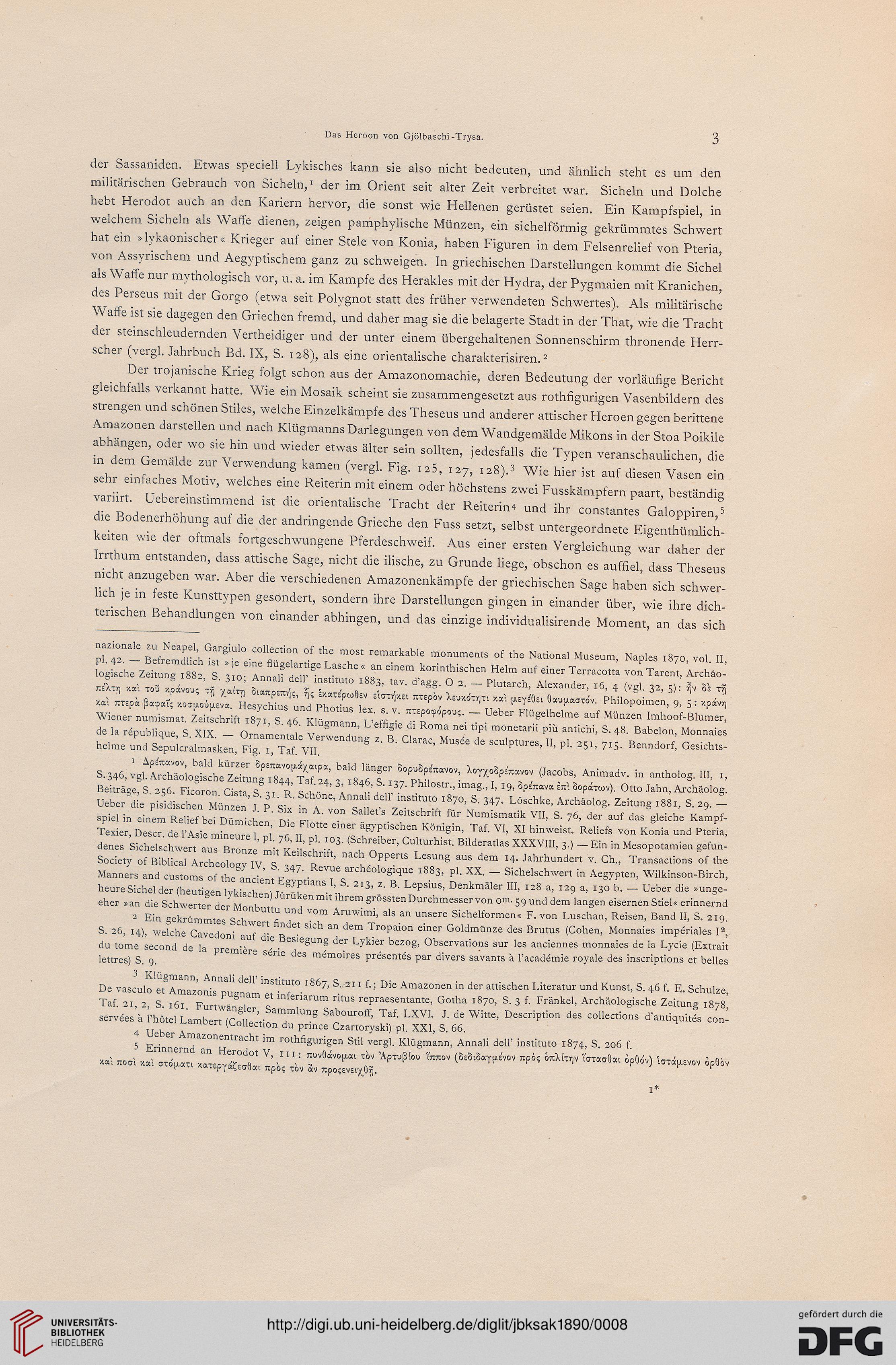Das Hcroon von Gjölbaschi-Trysa.
3
der Sassaniden. Etwas speciell Lykisches kann sie also nicht bedeuten, und ähnlich steht es um den
militärischen Gebrauch von Sicheln,1 der im Orient seit alter Zeit verbreitet war. Sicheln und Dolche
hebt Herodot auch an den Kariern hervor, die sonst wie Hellenen gerüstet seien. Ein Kampfspiel, in
welchem Sicheln als Waffe dienen, zeigen pamphylische Münzen, ein sichelförmig gekrümmtes Schwert
hat ein »lykaonischer « Krieger auf einer Stele von Konia, haben Figuren in dem Felsenrelief von Pteria,
von Assyrischem und Aegypüschem ganz zu schweigen. In griechischen Darstellungen kommt die Sichel
als Waffe nur mythologisch vor, u. a. im Kampfe des Herakles mit der Hydra, der Pygmaien mit Kranichen,
des Perseus mit der Gorgo (etwa seit Polvgnot statt des früher verwendeten Schwertes). Als militärische
Waffe ist sie dagegen den Griechen fremd, und daher mag sie die belagerte Stadt in der That, wie die Tracht
der steinschleudernden Vertheidiger und der unter einem übergehaltenen Sonnenschirm thronende Herr-
scher (vergl. Jahrbuch Bd. IX, S. 128), als eine orientalische charakterisiren.2
Der trojanische Krieg folgt schon aus der Amazonomachie, deren Bedeutung der vorläufige Bericht
gleichfalls verkannt hatte. Wie ein Mosaik scheint sie zusammengesetzt aus rothfigurigen Vasenbildern des
strengen und schönen Stiles, welche Einzelkämpfe des Theseus und anderer attischer Heroen gegen berittene
Amazonen darstellen und nach Klügmanns Darlegungen von dem Wandgemälde Mikons in der Stoa Poikile
abhängen, oder wo sie hin und wieder etwas älter sein sollten, jedesfalls die Typen veranschaulichen, die
in dem Gemälde zur Verwendung kamen (vergl. Fig. 125, 127, 128).3 Wie hier ist auf diesen Vasen ein
sehr einfaches Motiv, welches eine Reiterin mit einem oder höchstens zwei Fusskämpfern paart, beständig
variirt. Uebereinstimmend ist die orientalische Tracht der Reiterin* und ihr constantes Galoppiren,5
die Bodenerhöhung auf die der andringende Grieche den Fuss setzt, selbst untergeordnete Eigenthümlich-
keiten wie der oftmals fortgeschwungene Pferdeschweif. Aus einer ersten Vergleichung war daher der
Irrthum entstanden, dass attische Sage, nicht die ilische, zu Grunde liege, obschon es auffiel, dass Theseus
nicht anzugeben war. Aber die verschiedenen Amazonenkämpfe der griechischen Sage haben sich schwer-
lich je in feste Kunsttypen gesondert, sondern ihre Darstellungen gingen in einander über, wie ihre dich-
terischen Behandlungen von einander abhingen, und das einzige individualisirende Moment, an das sich
nazionale zu Neapel, Gargiulo collection of the most remarkable monuments of the National iVLuseum, Naples 1870, vol. II,
pl. 42- — Befremdlich ist »je eine flügelartige Lasche« an einem korinthischen Helm auf einer Terracotta von Tarent, Archäo-
logische Zeitung 1882, S. 310; Annali dell' instituto 1883, tav. d'agg. O 2. — Plutarch, Alexander, 16, 4 (vgl. 32, 5): 5Jv o'e tt)
jsAtt] xcü tou xpavou; ttj "/_a(t7) 6ia7ipE^7)?, rji; IxaT^pwOev e!aT7]xei jrcepbv Xsuxottiti Xat [as-fE^Ei Oau^asTov. Philopoimen, 9, 5: xpim)
xat r.Tzpa ßa?at; xoajj.ou[j.Evo:. Hesychius und Photius lex. s. v. zTEposöpou?. — Ueber Flügelhelme auf Münzen Imhoof-Blumer,
Wiener numismat. Zeitschrift 1871, S. 46. Klügmann, L'effigie di Roma nei tipi monetarii piü antichi, S. 48. Babelon, Monnaies
de la republique, S. XIX. — Ornamentale Verwendung z. B. Clarac, Musee de sculptures, II, pl. 251, 715. Benndorf, Gesichts-
helme und Sepulcralmasken, Fig. I, Taf. VII.
1 ipsrcctvov, bald kürzer Bpsnavojix/atpa, bald länger SopuBpfeavov, \oyyoopir.mo') (Jacobs, Animadv. in antholog. III, I,
s-346, vgl. Archäologische Zeitung 1844, Taf.24, 3, 1846, S. 137. Philostr., imag., I, 19, Spsnava im Sopimov). Otto Jahn, Archäolog.
Beiträge, S. 256. Ficoron. Cista, S. 31. R. Schöne, Annali dell' instituto 1870, S. 347. Löschke, Archäolog. Zeitung 1881, S. 29. —
Ueber die pisidischen Münzen J. P. Six in A. von Sallet's Zeitschrift für Numismatik VII, S. 76, der auf das gleiche Kampf-
spiel in einem Relief bei Dümichen, Die Flotte einer ägyptischen Königin, Taf. VI, XI hinweist. Reliefs von Konia und Pteria,
Texier, Descr. de l'Asie mineure I, pl. 76, II, pl. 103. (Schreiber, Culturhist. Bilderatlas XXXVIII, 3.) — Ein in Mesopotamien gefun-
denes Sichelschwert aus Bronze mit Keilschrift, nach Opperts Lesung aus dem 14. Jahrhundert v. Ch., Transactions of the
Society of Biblical Archeology IV, S. 347. Revue archeologique 1883, pl. XX. — Sichelschwert in Aegypten, Wilkinson-Birch,
Manners and customs of the ancient Egyptians I, S. 213, z. B. Lepsius, Denkmäler III, 128 a, 129 a, 130 b. — Ueber die »unge-
heure Sichel der (heutigen lykischen) Jürüken mit ihrem grössten Durchmesser von om. 59 und dem langen eisernen Stiel« erinnernd
eher »an die Schwerter der Monbuttu und vom Aruwimi, als an unsere Sichelformen« F. von Luschan, Reisen, Band II, S. 219.
2 Ein gekrümmtes Schwert findet sich an dem Tropaion einer Goldmünze des Brutus (Cohen, Monnaies imperiales I2,
S. 26, 14), welche Cavedoni auf die Besiegung der Lykier bezog, Observations sur les anciennes monnaies de la Lycie (Extrait
du tome second de la premiere sene des memoires präsentes par divers savants ä l'academie royale des inscriptions et belles
lettres) S. 9.
3 Klügmann, Annali dell' instituto 1867, S. 211 f.; Die Amazonen in der attischen Literatur und Kunst, S. 46 f. E. Schulze,
De vasculo et Amazonis pugnam et inferiarum ritus repraesentante, Gotha 1870, S. 3 f. Fränkel, Archäologische Zeitung 1878,
Taf. 21, 2, S. 161. Furtwängler, Sammlung Sabouroff, Taf. LXVI. J. de Witte, Description des collections d'antiquit& con-
servees ä l'hötel Lambert (Collection du prince Czartoryski) pl. XXI, S. 66.
+ Ueber Amazonentracht im rothfigurigen Stil vergl. Klügmann, Annali dell' instituto 1874, S. 206 f.
5 Erinnernd an Herodot V, III: 7tuv9ävou.ai tov 'Aptußfou Vtcjiov (5e8i8«y|j:^vov xpö; cmX(t7|v VaxaaOai opGdv) '.3tix[j.evov opObv
Xat noat xju <jTd[iati xaTsp^EijOai itpo? tov av npojEVEixöfj.
3
der Sassaniden. Etwas speciell Lykisches kann sie also nicht bedeuten, und ähnlich steht es um den
militärischen Gebrauch von Sicheln,1 der im Orient seit alter Zeit verbreitet war. Sicheln und Dolche
hebt Herodot auch an den Kariern hervor, die sonst wie Hellenen gerüstet seien. Ein Kampfspiel, in
welchem Sicheln als Waffe dienen, zeigen pamphylische Münzen, ein sichelförmig gekrümmtes Schwert
hat ein »lykaonischer « Krieger auf einer Stele von Konia, haben Figuren in dem Felsenrelief von Pteria,
von Assyrischem und Aegypüschem ganz zu schweigen. In griechischen Darstellungen kommt die Sichel
als Waffe nur mythologisch vor, u. a. im Kampfe des Herakles mit der Hydra, der Pygmaien mit Kranichen,
des Perseus mit der Gorgo (etwa seit Polvgnot statt des früher verwendeten Schwertes). Als militärische
Waffe ist sie dagegen den Griechen fremd, und daher mag sie die belagerte Stadt in der That, wie die Tracht
der steinschleudernden Vertheidiger und der unter einem übergehaltenen Sonnenschirm thronende Herr-
scher (vergl. Jahrbuch Bd. IX, S. 128), als eine orientalische charakterisiren.2
Der trojanische Krieg folgt schon aus der Amazonomachie, deren Bedeutung der vorläufige Bericht
gleichfalls verkannt hatte. Wie ein Mosaik scheint sie zusammengesetzt aus rothfigurigen Vasenbildern des
strengen und schönen Stiles, welche Einzelkämpfe des Theseus und anderer attischer Heroen gegen berittene
Amazonen darstellen und nach Klügmanns Darlegungen von dem Wandgemälde Mikons in der Stoa Poikile
abhängen, oder wo sie hin und wieder etwas älter sein sollten, jedesfalls die Typen veranschaulichen, die
in dem Gemälde zur Verwendung kamen (vergl. Fig. 125, 127, 128).3 Wie hier ist auf diesen Vasen ein
sehr einfaches Motiv, welches eine Reiterin mit einem oder höchstens zwei Fusskämpfern paart, beständig
variirt. Uebereinstimmend ist die orientalische Tracht der Reiterin* und ihr constantes Galoppiren,5
die Bodenerhöhung auf die der andringende Grieche den Fuss setzt, selbst untergeordnete Eigenthümlich-
keiten wie der oftmals fortgeschwungene Pferdeschweif. Aus einer ersten Vergleichung war daher der
Irrthum entstanden, dass attische Sage, nicht die ilische, zu Grunde liege, obschon es auffiel, dass Theseus
nicht anzugeben war. Aber die verschiedenen Amazonenkämpfe der griechischen Sage haben sich schwer-
lich je in feste Kunsttypen gesondert, sondern ihre Darstellungen gingen in einander über, wie ihre dich-
terischen Behandlungen von einander abhingen, und das einzige individualisirende Moment, an das sich
nazionale zu Neapel, Gargiulo collection of the most remarkable monuments of the National iVLuseum, Naples 1870, vol. II,
pl. 42- — Befremdlich ist »je eine flügelartige Lasche« an einem korinthischen Helm auf einer Terracotta von Tarent, Archäo-
logische Zeitung 1882, S. 310; Annali dell' instituto 1883, tav. d'agg. O 2. — Plutarch, Alexander, 16, 4 (vgl. 32, 5): 5Jv o'e tt)
jsAtt] xcü tou xpavou; ttj "/_a(t7) 6ia7ipE^7)?, rji; IxaT^pwOev e!aT7]xei jrcepbv Xsuxottiti Xat [as-fE^Ei Oau^asTov. Philopoimen, 9, 5: xpim)
xat r.Tzpa ßa?at; xoajj.ou[j.Evo:. Hesychius und Photius lex. s. v. zTEposöpou?. — Ueber Flügelhelme auf Münzen Imhoof-Blumer,
Wiener numismat. Zeitschrift 1871, S. 46. Klügmann, L'effigie di Roma nei tipi monetarii piü antichi, S. 48. Babelon, Monnaies
de la republique, S. XIX. — Ornamentale Verwendung z. B. Clarac, Musee de sculptures, II, pl. 251, 715. Benndorf, Gesichts-
helme und Sepulcralmasken, Fig. I, Taf. VII.
1 ipsrcctvov, bald kürzer Bpsnavojix/atpa, bald länger SopuBpfeavov, \oyyoopir.mo') (Jacobs, Animadv. in antholog. III, I,
s-346, vgl. Archäologische Zeitung 1844, Taf.24, 3, 1846, S. 137. Philostr., imag., I, 19, Spsnava im Sopimov). Otto Jahn, Archäolog.
Beiträge, S. 256. Ficoron. Cista, S. 31. R. Schöne, Annali dell' instituto 1870, S. 347. Löschke, Archäolog. Zeitung 1881, S. 29. —
Ueber die pisidischen Münzen J. P. Six in A. von Sallet's Zeitschrift für Numismatik VII, S. 76, der auf das gleiche Kampf-
spiel in einem Relief bei Dümichen, Die Flotte einer ägyptischen Königin, Taf. VI, XI hinweist. Reliefs von Konia und Pteria,
Texier, Descr. de l'Asie mineure I, pl. 76, II, pl. 103. (Schreiber, Culturhist. Bilderatlas XXXVIII, 3.) — Ein in Mesopotamien gefun-
denes Sichelschwert aus Bronze mit Keilschrift, nach Opperts Lesung aus dem 14. Jahrhundert v. Ch., Transactions of the
Society of Biblical Archeology IV, S. 347. Revue archeologique 1883, pl. XX. — Sichelschwert in Aegypten, Wilkinson-Birch,
Manners and customs of the ancient Egyptians I, S. 213, z. B. Lepsius, Denkmäler III, 128 a, 129 a, 130 b. — Ueber die »unge-
heure Sichel der (heutigen lykischen) Jürüken mit ihrem grössten Durchmesser von om. 59 und dem langen eisernen Stiel« erinnernd
eher »an die Schwerter der Monbuttu und vom Aruwimi, als an unsere Sichelformen« F. von Luschan, Reisen, Band II, S. 219.
2 Ein gekrümmtes Schwert findet sich an dem Tropaion einer Goldmünze des Brutus (Cohen, Monnaies imperiales I2,
S. 26, 14), welche Cavedoni auf die Besiegung der Lykier bezog, Observations sur les anciennes monnaies de la Lycie (Extrait
du tome second de la premiere sene des memoires präsentes par divers savants ä l'academie royale des inscriptions et belles
lettres) S. 9.
3 Klügmann, Annali dell' instituto 1867, S. 211 f.; Die Amazonen in der attischen Literatur und Kunst, S. 46 f. E. Schulze,
De vasculo et Amazonis pugnam et inferiarum ritus repraesentante, Gotha 1870, S. 3 f. Fränkel, Archäologische Zeitung 1878,
Taf. 21, 2, S. 161. Furtwängler, Sammlung Sabouroff, Taf. LXVI. J. de Witte, Description des collections d'antiquit& con-
servees ä l'hötel Lambert (Collection du prince Czartoryski) pl. XXI, S. 66.
+ Ueber Amazonentracht im rothfigurigen Stil vergl. Klügmann, Annali dell' instituto 1874, S. 206 f.
5 Erinnernd an Herodot V, III: 7tuv9ävou.ai tov 'Aptußfou Vtcjiov (5e8i8«y|j:^vov xpö; cmX(t7|v VaxaaOai opGdv) '.3tix[j.evov opObv
Xat noat xju <jTd[iati xaTsp^EijOai itpo? tov av npojEVEixöfj.