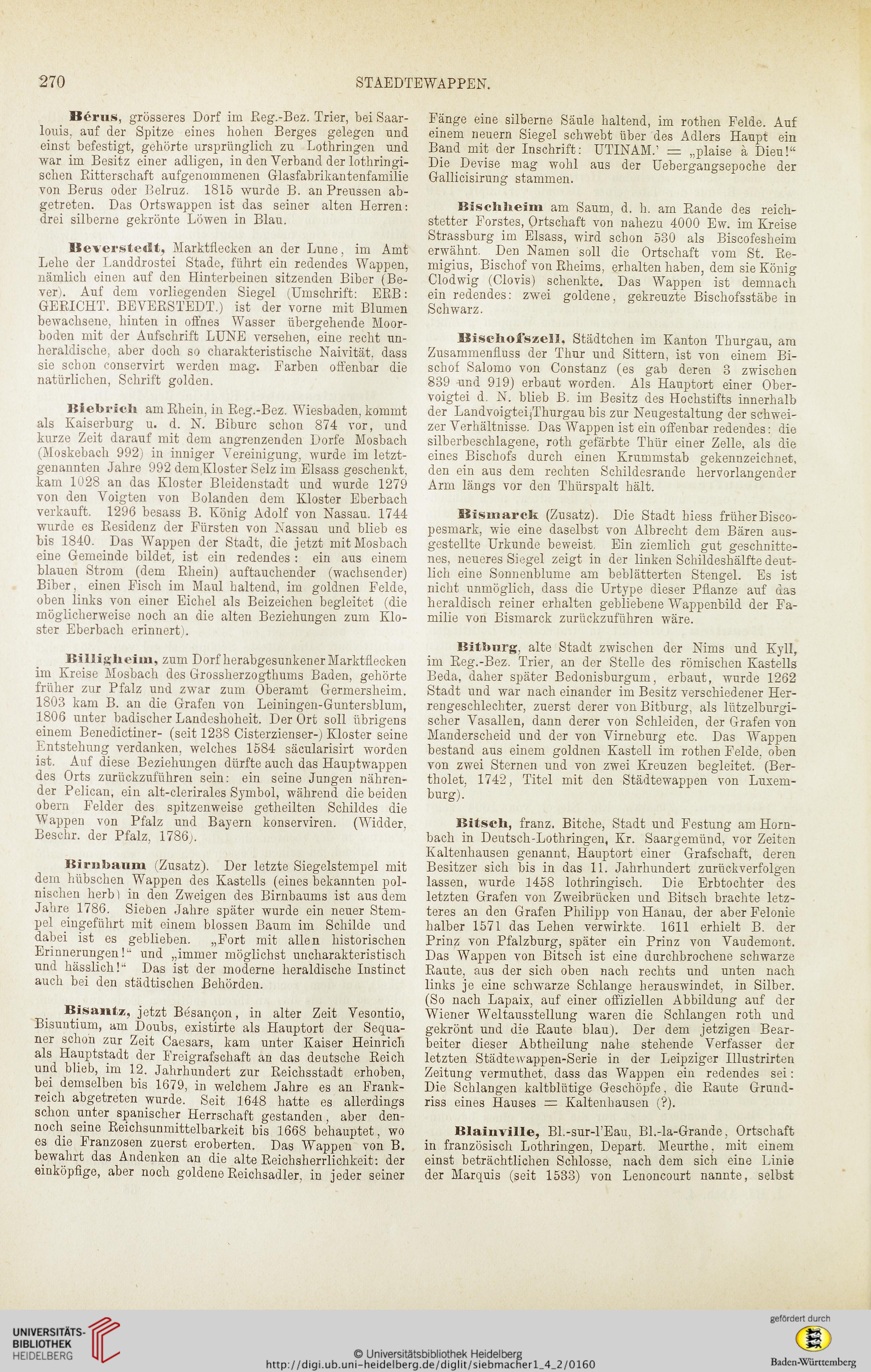270
STAEDTEWAPPEN.
Berus, grösseres Dorf ira ßeg.-Bez. Trier, bei Saar-
louis, auf der Spitze eiues hohen Berges gelegen und
einst hefestigt, gehörte ursprünglich zu Lothringen und
war im Besitz einer adligen, in den Yerband der lothringi-
schen Ritterschaft aufgenommenen Glasfahrikantenfamilie
von Berus oder Belruz. 1815 wurde B. an Preussen ab-
getreten. Das Ortswappen ist das seiner alten Herren:
drei silberne gekrönte Löwen in Blau.
lleversterft, Marktflecken an der Lune, im Amt
Lehe der Landdrostei Stade, führt ein redendes Wappen,
nämlich einen auf den Hinterbeinen sitzenden Biber (Be-
ver). Auf dem vorliegenden Siegel (Umschrift: ERB:
GERICHT. BEVERSTEDT.) ist der vorne mit Blumen
bewaclisene, hinten in offnes Wasser ubergehende Moor-
boden mit der Aufschrift LUNE versehen, eine recht un-
heraldische, aber doch so charakteristische Naivität. dass
sie schon conservirt werden mag. Earben offenbar die
natürlichen, Sclirift golden.
lliebrich am Rhein, in Reg.-Bez. Wiesbaden, kommt
als Kaiserburg u. d. N. Biburc schon 874 vor, und
kurze Zeit darauf mit dem angrenzenden Dorfe Mosbach
(Moskebach 992) in inniger Yereinigung, wurde im letzt-
genannten Jahre 992 dem Kloster Selz im Elsass geschenkt,
kam 1028 an das Kloster Bleidenstadt und wurde 1279
von den Voigten von Bolanden dem Kloster Eberbach
verkauft. 1296 besass B. König Adolf von Nassau. 1744
wurde es Residenz der Pürsten von Nassau und blieb es
bis 1840. Das Wappen der Stadt, die jetzt mit Mosbach
eine Gemeinde bildet, ist ein redendes : ein aus einem
blauen Strom (dem Rhein) auftauchender (wachsender)
Biber, einen Eisch im Maul haltend, im goldnen Felde,
oben links von einer Eichel als Beizeichen begleitet (die
möglicherweise noch an die alten Beziehungen zum Klo-
ster Eberbach erinnert).
Ilillighciiu, zum Dorf herabgesunkener Marktfiecken
im Kreise Mosbach des Grossherzogthums Baden, gehörte
früher zur Pfalz und zwar zum Oberamt Germersheim.
1803 kam B. an die Grafen von Leiningen-Guntersblum,
1806 unter badischer Landeshoheit. Der Ort soll iihrigens
einem Benedictiner- (seit 1238 Cisterzienser-) Kloster seine
Entstehung verdanken, welches 1584 säcularisirt worden
ist. Auf diese Beziehungen diirfte auch das Hauptwappen
des Orts zurückzuführen sein: ein seine Jungen nähren-
der Peiican, ein alt-clerirales Symbol, während die beiden
obern Felder des spitzenweise getheilten Schildes die
Wappen von Pfalz und Bayern konserviren. (Widder,
Beschr. der Pfalz, 1786;.
liirnhaum (Zusatz). Der letzte Siegelstempel mit
dem hübschen Wappen des Kastells (eines bekannten pol-
nischen herb) in den Zweigen des Birnbaums ist aus dem
Jahre 1786. Sieben Jahre später wurde ein neuer Stern-
pel eingeführt mit einem blossen Baum im Scliilde und
dabei ist es geblieben. „Eort mit allen historischen
Erinnerungen ! u und „immer möglichst uncharakteristisch
und hässlich!“ Das ist der moderne heraldische Instinct
auch bei den städtischen Behörden.
Bisantz, jetzt Besan^on, in alter Zeit Vesontio,
Bisuutium, am Doubs, existirte als Hauptort der Sequa-
ner schon zur Zeit Caesars, kam unter Kaiser Heinricii
als Hauptstadt der Freigrafschaft an das deutsche Reich
und blieb, im 12. Jahrhundert zur Reichsstadt erhoben,
bei demselben bis 1679, in welchem Jahre es an Frank-
reich abgetreten wurde. Seit 1648 hatte es allerdings
schon unter spanischer Herrschaft gestanden, aber den-
noch seine Reichsunmittelbarkeit bis 1668 behauptet, wo
es die Franzosen zuerst eroberten. Das Wappen von B.
bewahrt das Andenken an die alte Reichsherrlichkeit: der
einköpfige, aber noch goldene Reichsadler, in jeder seiner
Fänge eine silberne Säule haltend, im rothen Felde. Auf
einem neuern Siegel schwebt über des Adlers Haupt ein
Band mit der Inschrift: UTINAM.’ = „plaise ä Dieu!“
Die Devise mag wohl aus der Uebergangsepoche der
Gallicisirung stammen.
Bischlieim am Saum, d. li. am Rande des reich-
stetter Forstes, Ortschaft von nahezu 4000 Ew. im Kreise
Strassburg im Elsass, wird scbon 580 als Biscofesheim
erwähnt. Den Namen soll die Ortschaft vom St. Re-
migius, Bischof von Rheims, erhalten haben, dem sie König
Clodwig (Clovis) schenkte. Das Wappen ist demnach
ein redendes: zwei goldene, gekreuzte Bischofsstäbe in
Schwarz.
Hiscliolszeil. Städtchen im Kanton Thurgau, am
Zusammenfluss der Thur und Sittern, ist von einem Bi-
schof Salomo von Constanz (es gab deren 3 zwischen
839 -und 919) erbaut worden. Als Hauptort einer Ober-
voigtei d. N. blieb B. im Besitz des Hochstifts innerhalb
der LandvoigteijThurgau bis zur Nengestaltung der schwei-
zer Verhältnisse. Das Wappen ist ein offenbar redendes: die
silberbeschlagene, roth gefärbte Thiir einer ZeRe, als die
eines Bischofs durch einen Krummstab gekennzeichnet,
den ein aus dem rechten Scliildesrande hervorlangender
Arm längs vor den Thürspalt hält.
Slismarclt (Zusatz). Die Stadt hiess friiherBisco-
pesmark, wie eine daselbst von Albrecht dem Bären aus-
gestellte Urkunde beweist. Ein ziemlich gut geschnitte-
nes, neueres Siegel zeigt in der linken Schildeshälfte deut-
lich eine Sonnenblume am beblätterten Stengel. Es ist
nicht unmöglich, dass die Urtype dieser Pflanze auf uas
heraldisch reiner erhalten gebliebene Wappenbild der Fa-
milie von Bismarck zurückzuführen wäre.
BitlMirg, alte Stadt zwischen der Nims und Kyll,
im Reg.-Bez. Trier, an der Stelle des römischen Kastells
Beda, daher später Bedonisburgum, erbaut, wurde 1262
Stadt und war nach einander im Besitz verschiedener Her-
rengeschlechter, zuerst derer vonBitburg, als liitzelburgi-
scher Vasallen, dann derer von Schleiden, der Grafen von
Manderscheid und der von Virneburg etc. Das Wappen
bestand aus einem goldnen Kastell im rothen Felde, oben
von zwei Sternen und von zwei Kreuzen begleitet. (Ber-
tholet, 1742, Titel mit den Städtewappen von Luxem-
burg).
Bitscli, franz. Bitche, Stadt und Festung am Horn-
bach in Deut-sch-Lothringen, Kr. Saargemünd, vor Zeiten
Kaltenhausen genannt, Hauptort einer Grafschaft, deren
Besitzer sich bis in das 11. Jahrhundert zurückverfolgen
lassen, wurde 1458 lothringisch. Die Erbtochter des
letzten Grafen von Zweibrücken und Bitsch brachte letz-
teres an den Grafen Philipp von Hanau, der aber Felonie
halber 1571 das Lehen verwirkte. 1611 erhielt B. der
Prinz von Pfalzburg, später ein Prinz von Vaudemont.
Das Wappen von Bitsch ist eine durclibrochene schwarze
Raute, aus der sich oben nach rechts und unten nach
links je eine schwarze Schlange herauswindet, in Silber.
(So nach Lapaix, auf einer offiziellen Abbildung auf der
Wiener Weltausstellung waren die Schlangen roth und
gekrönt und die Raute blau). Der dem jetzigen Bear-
beiter dieser Abtheilung nahe stehende Verfasser der
letzten Städtewappen-Serie in der Leipziger Illustrirten
Zeitung vermuthet, dass das Wappen ein redendes sei:
Die Schlangen kaltblütige Gescliöpfe, die Raute Grund-
riss eines Hauses = Kaltenhausen (?).
Blaiuville, Bl.-sur-l !Eau, Bl.-la-Grande, Ortschaft
in französiscli Lothringen, Depart. Meurthe, mit einem
einst beträchtlichen Schlosse, nach dem sich eine Linie
der Marquis (seit 1533) von Lenoncourt nannte, selbst
STAEDTEWAPPEN.
Berus, grösseres Dorf ira ßeg.-Bez. Trier, bei Saar-
louis, auf der Spitze eiues hohen Berges gelegen und
einst hefestigt, gehörte ursprünglich zu Lothringen und
war im Besitz einer adligen, in den Yerband der lothringi-
schen Ritterschaft aufgenommenen Glasfahrikantenfamilie
von Berus oder Belruz. 1815 wurde B. an Preussen ab-
getreten. Das Ortswappen ist das seiner alten Herren:
drei silberne gekrönte Löwen in Blau.
lleversterft, Marktflecken an der Lune, im Amt
Lehe der Landdrostei Stade, führt ein redendes Wappen,
nämlich einen auf den Hinterbeinen sitzenden Biber (Be-
ver). Auf dem vorliegenden Siegel (Umschrift: ERB:
GERICHT. BEVERSTEDT.) ist der vorne mit Blumen
bewaclisene, hinten in offnes Wasser ubergehende Moor-
boden mit der Aufschrift LUNE versehen, eine recht un-
heraldische, aber doch so charakteristische Naivität. dass
sie schon conservirt werden mag. Earben offenbar die
natürlichen, Sclirift golden.
lliebrich am Rhein, in Reg.-Bez. Wiesbaden, kommt
als Kaiserburg u. d. N. Biburc schon 874 vor, und
kurze Zeit darauf mit dem angrenzenden Dorfe Mosbach
(Moskebach 992) in inniger Yereinigung, wurde im letzt-
genannten Jahre 992 dem Kloster Selz im Elsass geschenkt,
kam 1028 an das Kloster Bleidenstadt und wurde 1279
von den Voigten von Bolanden dem Kloster Eberbach
verkauft. 1296 besass B. König Adolf von Nassau. 1744
wurde es Residenz der Pürsten von Nassau und blieb es
bis 1840. Das Wappen der Stadt, die jetzt mit Mosbach
eine Gemeinde bildet, ist ein redendes : ein aus einem
blauen Strom (dem Rhein) auftauchender (wachsender)
Biber, einen Eisch im Maul haltend, im goldnen Felde,
oben links von einer Eichel als Beizeichen begleitet (die
möglicherweise noch an die alten Beziehungen zum Klo-
ster Eberbach erinnert).
Ilillighciiu, zum Dorf herabgesunkener Marktfiecken
im Kreise Mosbach des Grossherzogthums Baden, gehörte
früher zur Pfalz und zwar zum Oberamt Germersheim.
1803 kam B. an die Grafen von Leiningen-Guntersblum,
1806 unter badischer Landeshoheit. Der Ort soll iihrigens
einem Benedictiner- (seit 1238 Cisterzienser-) Kloster seine
Entstehung verdanken, welches 1584 säcularisirt worden
ist. Auf diese Beziehungen diirfte auch das Hauptwappen
des Orts zurückzuführen sein: ein seine Jungen nähren-
der Peiican, ein alt-clerirales Symbol, während die beiden
obern Felder des spitzenweise getheilten Schildes die
Wappen von Pfalz und Bayern konserviren. (Widder,
Beschr. der Pfalz, 1786;.
liirnhaum (Zusatz). Der letzte Siegelstempel mit
dem hübschen Wappen des Kastells (eines bekannten pol-
nischen herb) in den Zweigen des Birnbaums ist aus dem
Jahre 1786. Sieben Jahre später wurde ein neuer Stern-
pel eingeführt mit einem blossen Baum im Scliilde und
dabei ist es geblieben. „Eort mit allen historischen
Erinnerungen ! u und „immer möglichst uncharakteristisch
und hässlich!“ Das ist der moderne heraldische Instinct
auch bei den städtischen Behörden.
Bisantz, jetzt Besan^on, in alter Zeit Vesontio,
Bisuutium, am Doubs, existirte als Hauptort der Sequa-
ner schon zur Zeit Caesars, kam unter Kaiser Heinricii
als Hauptstadt der Freigrafschaft an das deutsche Reich
und blieb, im 12. Jahrhundert zur Reichsstadt erhoben,
bei demselben bis 1679, in welchem Jahre es an Frank-
reich abgetreten wurde. Seit 1648 hatte es allerdings
schon unter spanischer Herrschaft gestanden, aber den-
noch seine Reichsunmittelbarkeit bis 1668 behauptet, wo
es die Franzosen zuerst eroberten. Das Wappen von B.
bewahrt das Andenken an die alte Reichsherrlichkeit: der
einköpfige, aber noch goldene Reichsadler, in jeder seiner
Fänge eine silberne Säule haltend, im rothen Felde. Auf
einem neuern Siegel schwebt über des Adlers Haupt ein
Band mit der Inschrift: UTINAM.’ = „plaise ä Dieu!“
Die Devise mag wohl aus der Uebergangsepoche der
Gallicisirung stammen.
Bischlieim am Saum, d. li. am Rande des reich-
stetter Forstes, Ortschaft von nahezu 4000 Ew. im Kreise
Strassburg im Elsass, wird scbon 580 als Biscofesheim
erwähnt. Den Namen soll die Ortschaft vom St. Re-
migius, Bischof von Rheims, erhalten haben, dem sie König
Clodwig (Clovis) schenkte. Das Wappen ist demnach
ein redendes: zwei goldene, gekreuzte Bischofsstäbe in
Schwarz.
Hiscliolszeil. Städtchen im Kanton Thurgau, am
Zusammenfluss der Thur und Sittern, ist von einem Bi-
schof Salomo von Constanz (es gab deren 3 zwischen
839 -und 919) erbaut worden. Als Hauptort einer Ober-
voigtei d. N. blieb B. im Besitz des Hochstifts innerhalb
der LandvoigteijThurgau bis zur Nengestaltung der schwei-
zer Verhältnisse. Das Wappen ist ein offenbar redendes: die
silberbeschlagene, roth gefärbte Thiir einer ZeRe, als die
eines Bischofs durch einen Krummstab gekennzeichnet,
den ein aus dem rechten Scliildesrande hervorlangender
Arm längs vor den Thürspalt hält.
Slismarclt (Zusatz). Die Stadt hiess friiherBisco-
pesmark, wie eine daselbst von Albrecht dem Bären aus-
gestellte Urkunde beweist. Ein ziemlich gut geschnitte-
nes, neueres Siegel zeigt in der linken Schildeshälfte deut-
lich eine Sonnenblume am beblätterten Stengel. Es ist
nicht unmöglich, dass die Urtype dieser Pflanze auf uas
heraldisch reiner erhalten gebliebene Wappenbild der Fa-
milie von Bismarck zurückzuführen wäre.
BitlMirg, alte Stadt zwischen der Nims und Kyll,
im Reg.-Bez. Trier, an der Stelle des römischen Kastells
Beda, daher später Bedonisburgum, erbaut, wurde 1262
Stadt und war nach einander im Besitz verschiedener Her-
rengeschlechter, zuerst derer vonBitburg, als liitzelburgi-
scher Vasallen, dann derer von Schleiden, der Grafen von
Manderscheid und der von Virneburg etc. Das Wappen
bestand aus einem goldnen Kastell im rothen Felde, oben
von zwei Sternen und von zwei Kreuzen begleitet. (Ber-
tholet, 1742, Titel mit den Städtewappen von Luxem-
burg).
Bitscli, franz. Bitche, Stadt und Festung am Horn-
bach in Deut-sch-Lothringen, Kr. Saargemünd, vor Zeiten
Kaltenhausen genannt, Hauptort einer Grafschaft, deren
Besitzer sich bis in das 11. Jahrhundert zurückverfolgen
lassen, wurde 1458 lothringisch. Die Erbtochter des
letzten Grafen von Zweibrücken und Bitsch brachte letz-
teres an den Grafen Philipp von Hanau, der aber Felonie
halber 1571 das Lehen verwirkte. 1611 erhielt B. der
Prinz von Pfalzburg, später ein Prinz von Vaudemont.
Das Wappen von Bitsch ist eine durclibrochene schwarze
Raute, aus der sich oben nach rechts und unten nach
links je eine schwarze Schlange herauswindet, in Silber.
(So nach Lapaix, auf einer offiziellen Abbildung auf der
Wiener Weltausstellung waren die Schlangen roth und
gekrönt und die Raute blau). Der dem jetzigen Bear-
beiter dieser Abtheilung nahe stehende Verfasser der
letzten Städtewappen-Serie in der Leipziger Illustrirten
Zeitung vermuthet, dass das Wappen ein redendes sei:
Die Schlangen kaltblütige Gescliöpfe, die Raute Grund-
riss eines Hauses = Kaltenhausen (?).
Blaiuville, Bl.-sur-l !Eau, Bl.-la-Grande, Ortschaft
in französiscli Lothringen, Depart. Meurthe, mit einem
einst beträchtlichen Schlosse, nach dem sich eine Linie
der Marquis (seit 1533) von Lenoncourt nannte, selbst