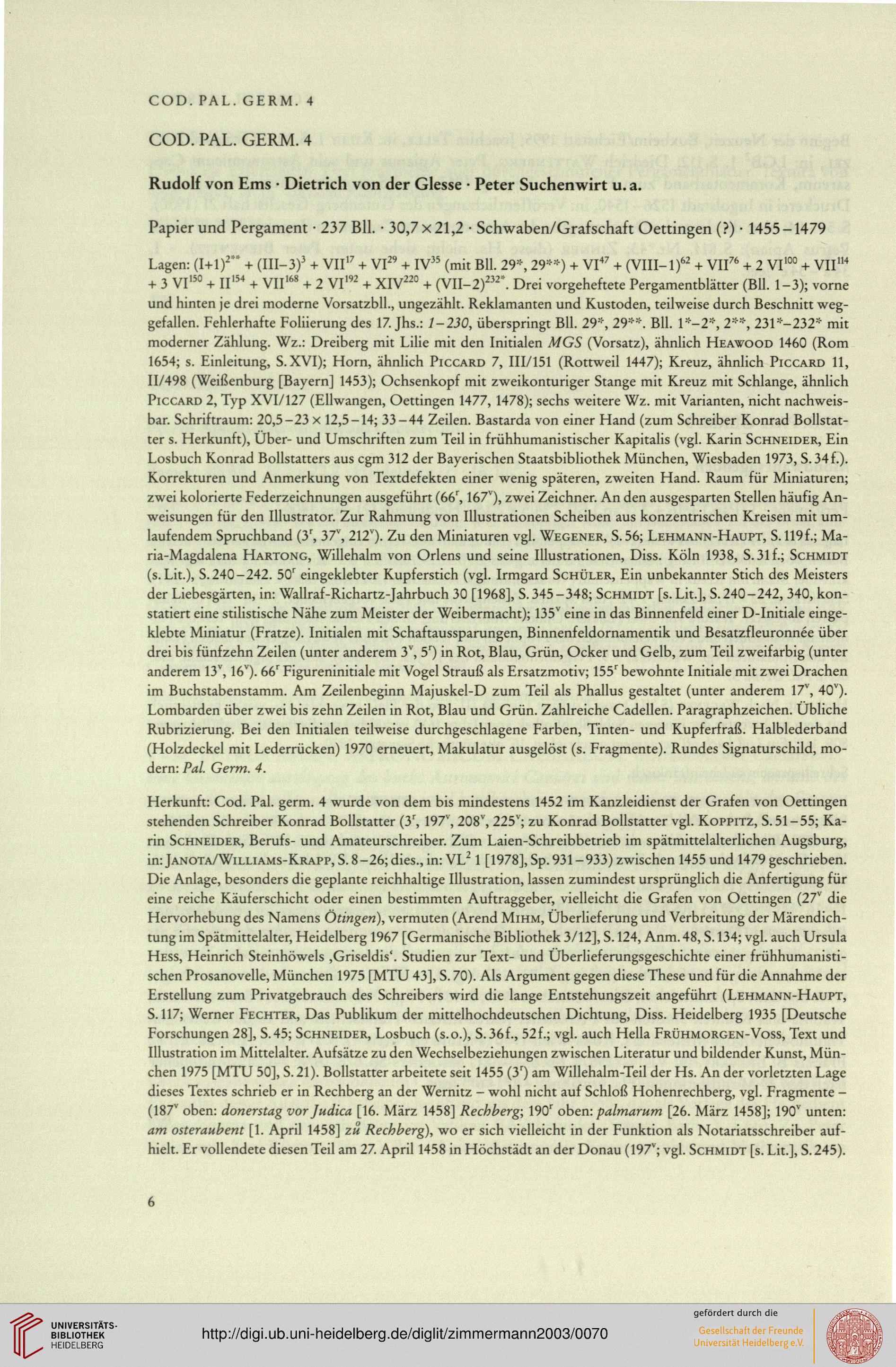COD. PAL. GERM. 4
COD. PAL. GERM. 4
Rudolf von Ems • Dietrich von der Glesse • Peter Suchenwirt u. a.
Papier und Pergament • 237 Bll. • 30,7x21,2 • Schwaben/Grafschaft Oettingen (?) ■ 1455-1479
114
Lagen: (I+l)2" + (III-3)3 + VII17 + VI29 + IV35 (mit Bll. 29*, 29«") + VI47 + (VIII-1)62 + VII76 + 2 VI100 + VII
+ 3 VI150 + II154 + VII168 + 2 VI192 + XIV220 + (VII-2)232". Drei vorgeheftete Pergamentblätter (Bll. 1-3); vorne
und hinten je drei moderne Vorsatzbll., ungezählt. Reklamanten und Kustoden, teilweise durch Beschnitt weg-
gefallen. Fehlerhafte Foliierung des 17. Jhs.: 1-230, überspringt Bll. 29*, 29»». Bll. l»-2», 2»», 231*-232* mit
moderner Zählung. Wz.: Dreiberg mit Lilie mit den Initialen MGS (Vorsatz), ähnlich Heawood 1460 (Rom
1654; s. Einleitung, S. XVI); Hörn, ähnlich Piccard 7, III/151 (Rottweil 1447); Kreuz, ähnlich Piccard 11,
11/498 (Weißenburg [Bayern] 1453); Ochsenkopf mit zweikonturiger Stange mit Kreuz mit Schlange, ähnlich
Piccard 2, Typ XVI/127 (Ellwangen, Oettingen 1477, 1478); sechs weitere Wz. mit Varianten, nicht nachweis-
bar. Schriftraum: 20,5-23 x 12,5-14; 33-44 Zeilen. Bastarda von einer Hand (zum Schreiber Konrad Bollstat-
ter s. Herkunft), Über- und Umschriften zum Teil in frühhumanistischer Kapitalis (vgl. Karin Schneider, Ein
Losbuch Konrad Bollstatters aus cgm 312 der Bayerischen Staatsbibliothek München, Wiesbaden 1973, S. 34 f.).
Korrekturen und Anmerkung von Textdefekten einer wenig späteren, zweiten Hand. Raum für Miniaturen;
zwei kolorierte Federzeichnungen ausgeführt (66r, 167"), zwei Zeichner. An den ausgesparten Stellen häufig An-
weisungen für den Illustrator. Zur Rahmung von Illustrationen Scheiben aus konzentrischen Kreisen mit um-
laufendem Spruchband (3r, 37", 212v). Zu den Miniaturen vgl. Wegener, S. 56; Lehmann-Haupt, S. 119f; Ma-
ria-Magdalena Hartong, Willehalm von Orlens und seine Illustrationen, Diss. Köln 1938, S. 31 f.; Schmidt
(s. Lit.), S.240-242. 50r eingeklebter Kupferstich (vgl. Irmgard Schüler, Ein unbekannter Stich des Meisters
der Liebesgärten, in: Wallraf-Richartz-Jahrbuch 30 [1968], S.345-348; Schmidt [s.Lit.], S.240-242, 340, kon-
statiert eine stilistische Nähe zum Meister der Weibermacht); 135v eine in das Binnenfeld einer D-Initiale einge-
klebte Miniatur (Fratze). Initialen mit Schaftaussparungen, Binnenfeldornamentik und Besatzfleuronnee über
drei bis fünfzehn Zeilen (unter anderem 3V, 5r) in Rot, Blau, Grün, Ocker und Gelb, zum Teil zweifarbig (unter
anderem 13v, 16v). 66r Figureninitiale mit Vogel Strauß als Ersatzmotiv; 155r bewohnte Initiale mit zwei Drachen
im Buchstabenstamm. Am Zeilenbeginn Majuskel-D zum Teil als Phallus gestaltet (unter anderem 17v, 40v).
Lombarden über zwei bis zehn Zeilen in Rot, Blau und Grün. Zahlreiche Cadellen. Paragraphzeichen. Übliche
Rubrizierung. Bei den Initialen teilweise durchgeschlagene Farben, Tinten- und Kupferfraß. Halblederband
(Holzdeckel mit Lederrücken) 1970 erneuert, Makulatur ausgelöst (s. Fragmente). Rundes Signaturschild, mo-
dern: Pal. Germ. 4.
Herkunft: Cod. Pal. germ. 4 wurde von dem bis mindestens 1452 im Kanzleidienst der Grafen von Oettingen
stehenden Schreiber Konrad Bollstatter (3r, 197v, 208v, 225v; zu Konrad Bollstatter vgl. Koppitz, S. 51-55; Ka-
rin Schneider, Berufs- und Amateurschreiber. Zum Laien-Schreibbetrieb im spätmittelalterlichen Augsburg,
in: Janota/Williams-Krapp, S. 8-26; dies., in: VL21 [1978], Sp. 931-933) zwischen 1455 und 1479 geschrieben.
Die Anlage, besonders die geplante reichhaltige Illustration, lassen zumindest ursprünglich die Anfertigung für
eine reiche Käuferschicht oder einen bestimmten Auftraggeber, vielleicht die Grafen von Oettingen (27v die
Hervorhebung des Namens Ötingen), vermuten (Arend Mihm, Überlieferung und Verbreitung der Märendich-
tung im Spätmittelalter, Heidelberg 1967 [Germanische Bibliothek 3/12], S. 124, Anra. 48, S. 134; vgl. auch Ursula
Hess, Heinrich Steinhöwels ,Griseldis'. Studien zur Text- und Überlieferungsgeschichte einer frühhumanisti-
schen Prosanovelle, München 1975 [MTU 43], S. 70). Als Argument gegen diese These und für die Annahme der
Erstellung zum Privatgebrauch des Schreibers wird die lange Entstehungszeit angeführt (Lehmann-Haupt,
S. 117; Werner Fechter, Das Publikum der mittelhochdeutschen Dichtung, Diss. Heidelberg 1935 [Deutsche
Forschungen 28], S.45; Schneider, Losbuch (s.o.), S.36f., 52f.; vgl. auch Hella Frühmorgen-Voss, Text und
Illustration im Mittelalter. Aufsätze zu den Wechselbeziehungen zwischen Literatur und bildender Kunst, Mün-
chen 1975 [MTU 50], S. 21). Bollstatter arbeitete seit 1455 (3r) am Willehalm-Teil der Hs. An der vorletzten Lage
dieses Textes schrieb er in Rechberg an der Wernitz - wohl nicht auf Schloß Hohenrechberg, vgl. Fragmente -
(187v oben: donerstag vor Judica [16. März 1458] Rechberg; 190r oben: palmarum [26. März 1458]; 190v unten:
am osteraubent [1. April 1458] zu Rechberg), wo er sich vielleicht in der Funktion als Notariatsschreiber auf-
hielt. Er vollendete diesen Teil am 27. April 1458 in Höchstädt an der Donau (197"; vgl. Schmidt [s. Lit.], S. 245).
COD. PAL. GERM. 4
Rudolf von Ems • Dietrich von der Glesse • Peter Suchenwirt u. a.
Papier und Pergament • 237 Bll. • 30,7x21,2 • Schwaben/Grafschaft Oettingen (?) ■ 1455-1479
114
Lagen: (I+l)2" + (III-3)3 + VII17 + VI29 + IV35 (mit Bll. 29*, 29«") + VI47 + (VIII-1)62 + VII76 + 2 VI100 + VII
+ 3 VI150 + II154 + VII168 + 2 VI192 + XIV220 + (VII-2)232". Drei vorgeheftete Pergamentblätter (Bll. 1-3); vorne
und hinten je drei moderne Vorsatzbll., ungezählt. Reklamanten und Kustoden, teilweise durch Beschnitt weg-
gefallen. Fehlerhafte Foliierung des 17. Jhs.: 1-230, überspringt Bll. 29*, 29»». Bll. l»-2», 2»», 231*-232* mit
moderner Zählung. Wz.: Dreiberg mit Lilie mit den Initialen MGS (Vorsatz), ähnlich Heawood 1460 (Rom
1654; s. Einleitung, S. XVI); Hörn, ähnlich Piccard 7, III/151 (Rottweil 1447); Kreuz, ähnlich Piccard 11,
11/498 (Weißenburg [Bayern] 1453); Ochsenkopf mit zweikonturiger Stange mit Kreuz mit Schlange, ähnlich
Piccard 2, Typ XVI/127 (Ellwangen, Oettingen 1477, 1478); sechs weitere Wz. mit Varianten, nicht nachweis-
bar. Schriftraum: 20,5-23 x 12,5-14; 33-44 Zeilen. Bastarda von einer Hand (zum Schreiber Konrad Bollstat-
ter s. Herkunft), Über- und Umschriften zum Teil in frühhumanistischer Kapitalis (vgl. Karin Schneider, Ein
Losbuch Konrad Bollstatters aus cgm 312 der Bayerischen Staatsbibliothek München, Wiesbaden 1973, S. 34 f.).
Korrekturen und Anmerkung von Textdefekten einer wenig späteren, zweiten Hand. Raum für Miniaturen;
zwei kolorierte Federzeichnungen ausgeführt (66r, 167"), zwei Zeichner. An den ausgesparten Stellen häufig An-
weisungen für den Illustrator. Zur Rahmung von Illustrationen Scheiben aus konzentrischen Kreisen mit um-
laufendem Spruchband (3r, 37", 212v). Zu den Miniaturen vgl. Wegener, S. 56; Lehmann-Haupt, S. 119f; Ma-
ria-Magdalena Hartong, Willehalm von Orlens und seine Illustrationen, Diss. Köln 1938, S. 31 f.; Schmidt
(s. Lit.), S.240-242. 50r eingeklebter Kupferstich (vgl. Irmgard Schüler, Ein unbekannter Stich des Meisters
der Liebesgärten, in: Wallraf-Richartz-Jahrbuch 30 [1968], S.345-348; Schmidt [s.Lit.], S.240-242, 340, kon-
statiert eine stilistische Nähe zum Meister der Weibermacht); 135v eine in das Binnenfeld einer D-Initiale einge-
klebte Miniatur (Fratze). Initialen mit Schaftaussparungen, Binnenfeldornamentik und Besatzfleuronnee über
drei bis fünfzehn Zeilen (unter anderem 3V, 5r) in Rot, Blau, Grün, Ocker und Gelb, zum Teil zweifarbig (unter
anderem 13v, 16v). 66r Figureninitiale mit Vogel Strauß als Ersatzmotiv; 155r bewohnte Initiale mit zwei Drachen
im Buchstabenstamm. Am Zeilenbeginn Majuskel-D zum Teil als Phallus gestaltet (unter anderem 17v, 40v).
Lombarden über zwei bis zehn Zeilen in Rot, Blau und Grün. Zahlreiche Cadellen. Paragraphzeichen. Übliche
Rubrizierung. Bei den Initialen teilweise durchgeschlagene Farben, Tinten- und Kupferfraß. Halblederband
(Holzdeckel mit Lederrücken) 1970 erneuert, Makulatur ausgelöst (s. Fragmente). Rundes Signaturschild, mo-
dern: Pal. Germ. 4.
Herkunft: Cod. Pal. germ. 4 wurde von dem bis mindestens 1452 im Kanzleidienst der Grafen von Oettingen
stehenden Schreiber Konrad Bollstatter (3r, 197v, 208v, 225v; zu Konrad Bollstatter vgl. Koppitz, S. 51-55; Ka-
rin Schneider, Berufs- und Amateurschreiber. Zum Laien-Schreibbetrieb im spätmittelalterlichen Augsburg,
in: Janota/Williams-Krapp, S. 8-26; dies., in: VL21 [1978], Sp. 931-933) zwischen 1455 und 1479 geschrieben.
Die Anlage, besonders die geplante reichhaltige Illustration, lassen zumindest ursprünglich die Anfertigung für
eine reiche Käuferschicht oder einen bestimmten Auftraggeber, vielleicht die Grafen von Oettingen (27v die
Hervorhebung des Namens Ötingen), vermuten (Arend Mihm, Überlieferung und Verbreitung der Märendich-
tung im Spätmittelalter, Heidelberg 1967 [Germanische Bibliothek 3/12], S. 124, Anra. 48, S. 134; vgl. auch Ursula
Hess, Heinrich Steinhöwels ,Griseldis'. Studien zur Text- und Überlieferungsgeschichte einer frühhumanisti-
schen Prosanovelle, München 1975 [MTU 43], S. 70). Als Argument gegen diese These und für die Annahme der
Erstellung zum Privatgebrauch des Schreibers wird die lange Entstehungszeit angeführt (Lehmann-Haupt,
S. 117; Werner Fechter, Das Publikum der mittelhochdeutschen Dichtung, Diss. Heidelberg 1935 [Deutsche
Forschungen 28], S.45; Schneider, Losbuch (s.o.), S.36f., 52f.; vgl. auch Hella Frühmorgen-Voss, Text und
Illustration im Mittelalter. Aufsätze zu den Wechselbeziehungen zwischen Literatur und bildender Kunst, Mün-
chen 1975 [MTU 50], S. 21). Bollstatter arbeitete seit 1455 (3r) am Willehalm-Teil der Hs. An der vorletzten Lage
dieses Textes schrieb er in Rechberg an der Wernitz - wohl nicht auf Schloß Hohenrechberg, vgl. Fragmente -
(187v oben: donerstag vor Judica [16. März 1458] Rechberg; 190r oben: palmarum [26. März 1458]; 190v unten:
am osteraubent [1. April 1458] zu Rechberg), wo er sich vielleicht in der Funktion als Notariatsschreiber auf-
hielt. Er vollendete diesen Teil am 27. April 1458 in Höchstädt an der Donau (197"; vgl. Schmidt [s. Lit.], S. 245).