Einführung
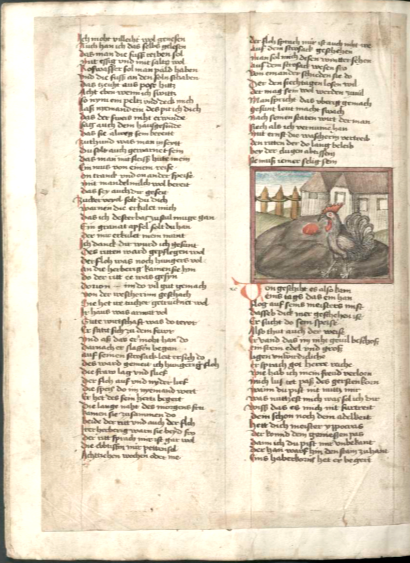
Bonerius nennt sich der Verfasser eines dem erwirdigen man / von Ringgenberg hern Johan gewidmeten büechlin[s], das er als der edelstein betitelte und dessen Inhalt er mit hundert bischaft angab. Nicht all diese in Pro- und Epilog mitgeteilten 'Realien' sind jedoch zweifelsfrei verifizierbar. So steht dahin, ob das sprachlich in den Berner Dialektraum weisende und von dominikanischen Exempelsammlungen mitgespeiste Werk de fratre vͦlrico Boner stammt, der zwischen 1324 und 1350 mehrfach als Berner Dominikaner urkundet, oder von Conrado ejus fratre, der unikal (als leiblicher und/oder Ordensbruder?) gemeinsam mit Ulrich Boner bezeugt ist. Als Widmungsaddressat dürfte eher der als Spruchdichter in die Manessische Handschrift eingegangene und politisch eng mit Bern verflochtene Freiherr Johann I. von Ringgenberg ( ꝉ nach 15.10.1350) anzusehen sein, als dessen öffentlich kaum in Erscheinung getretener, letztmalig im März 1349 urkundender Sohn Johann II. Sollte die darin uneindeutige Widmung des Epilogs anders als die der Vorrede dem bereits verstorbenen Freiherrn gegolten haben, dürfte der Edelstein um 1350/51 vollendet worden sein. Sein Titel rekurriert auf die Eingangsfabel Von einem hanen und einem edelen steine, in der der Hahn das auf dem Mist gefundene Kleinod geringer schätzt als ein Gerstenkorn und damit als Negativbeispiel für Rezipienten fungiert, die des steines kraft in den bischaft voller guoter sinnen und hoher list erkennen sollen. Der im Epilog reklamierte Umfang von 100 solcher Beispielgeschichten ist jedoch nur für gerade mal eine (1870 verbrannte) der drei Dutzend nachweisbaren Handschriften der Sammlung bezeugt.
Die erste, auktorial als geschlossenes buoch konzipierte Kollektion äsopischer Fabeln und funktionsgleicher Exempla deutscher Sprache war sehr erfolgreich. Davon zeugt ihr beträchtlicher Überlieferungsumfang von heute 36 bekannten Codices – 32 davon Corpus-Handschriften, 20 illustriert und 5 weitere dazu eingerichtet. Hinzu kommt, dass die auf gangbarste deutsche Literatur spezialisierte Hagenauer Handschriftenmanufaktur Diebold Laubers den Edelstein von ca. 1443 bis 1465 im Sortiment führte, auch wenn sie ihn in ihren Werbeanzeigen aufgrund einer prologlosen Kopiervorlage nicht unter seinem Originaltitel listen konnte, sondern als bispyl buoch genant der welt louff gemault anpries sowie unter dem Namen des Gattungsstifters als ysopus gemolt. Und auch ein anderer Vorreiter der technischen Buchreproduktion hatte das Werk im Programm: der Bamberger Druckerverleger Albrecht Pfister, der im Februar 1461 mit dem Edelstein nicht nur das Investitionsrisiko des ersten mit Typen gedruckten deutschen Buches einging, sondern auch das Experiment einer erstmaligen Kombination von Typen- und Holzschnitt-Druck wagte und bereits ca. ein Jahr später in einer Zweitauflage wiederholte.
"Das erste gedruckte deutsche Buch sind Aesopische Fabeln: und die ersten gedruckten [...] sind deutsche", wusste daher schon Gotthold E. Lessing, dem sich wie seinen Literatenkollegen Christian F. Gellert und Johann Ch. Gottsched erste überlieferungs- und weitere realienkundliche Edelstein-Studien verdankten, nachdem der Jurist J. G. Scherz von 1704-10 Teilabdrucke eines Straßburger Codex vorgelegt hatte. Neue Trouvaillen und Abdrucke von Specimina regten J. J. Bodmer und J. J. Breitinger 1757 zu einer ersten Gesamtausgabe an, die 94 Texte aus drei pro- und epiloglosen Codices zusammenbrachte, aber daher weder mit dem Autornamen noch dem Werktitel aufwarten konnte und das Ganze so als anonyme 'Fabeln aus den Zeiten der Minnesinger' ausgehen ließ. Aus den seinerzeit dann 15 bekannten Textzeugen montierte J. J. Eschenburg methodisch undurchsichtig 1810 eine zweite, sprachlich modernisierte Ausgabe, der Georg F. Benecke bereits 1816 eine dritte folgen ließ. Sie legte, wo immer möglich, einen Zürcher Pergamentcodex zugrunde, der zwar als ältester und textlich bester galt, aber nicht nur stark fragmentiert war, sondern seit seinem unverlässlichen Abdruck durch Bodmer/Breitinger längst auch verschollen. Beneckes Edition provozierte editionsmethodischen Dissens, da Jacob Grimm ihr überlieferungsnahes Leithandschriftenprinzip begrüßte, während Karl Lachmann mit Verweis auf seine Methode einen textkritisch-rekonstruktiven Angang bevorzugt sehen wollte, weil er der Überlieferung einen "doch vermuthlich [...] ziemlich ächte[n] Bonerius" (90) abgewonnen hätte. Lachmanns petitio principii machte sich 1844 Franz Pfeiffer zueigen und gründete eine vierte Ausgabe auf im wesentlichen zwei (heute verlorene) Codices, die im Verein mit zwei weiteren "allein den echten ursprünglichen Text" (188) begründen könnten. Basis seines Urteils war die Aufgliederung der 17 ihm bekannten Textzeugen "in drei streng geschiedene Famlien", von denen Klasse I "alle hundert Fabeln samt der Vor- und Nachrede" enthalte und daher die editorisch allein maßgebliche sein könne, während Kl. II "für gewöhnlich 90 Fabeln" nebst Epilog überliefere, Kl. III hingegen nur 84 ohne Rahmentexte, aber in gleicher, von Kl. I abweichender Anfangsreihung (187f.). Pfeiffers vielfach gegen alle Zeugen und mitunter auch gegen Boners lateinische Quellen konjizierter Text nach den nur unterstelltermaßen einst vollständigen vier Kl. I-Codices hielt der Kritik nicht stand. 1875 komprimierte Anton Schönbach sie in der spitzen Bemerkung "Wir dürfen den dichter nicht besser machen wollen als er war" (267), und untermauerte seine Forderung nach einer überlieferungskonformen Neuausgabe mit 18seitigen Besserungsvorschlägen. Gleichwohl ist die bald 180 Jahre alte und 2016 von Manfred Stange geschlimmbessert und ohne Apparat neu aufgelegte Ausgabe Pfeiffers bis heute die editio citanda und bliebe es wohl, hätte das Dictum ihres Editors noch Gültigkeit: "Bei einer etwaigen neuen Ausgabe, wenn eine solche je wieder für nœthig erachtet werden sollte, werden nur neue [...], das volle Hundert umfassend[e] Hss. von Nutzen sein" (188). Zwar kamen seither immerhin 21 Textzeugen neu hinzu, aber nicht einer mit vollem Hundert, was die Nötigerachtung – anders als Pfeiffer sie meinte – zweifellos bestärkt.
Betreffs der Gründe für den in Zahl, Abfolge und paratextuellem Beiwerk so unfesten Sammlungsbestand – der Prolog z. B. ist lediglich vier-, Nr. 12 dagegen in verschiedenster Position 21mal und Nr. 74 30mal überliefert – forcierte Klaus Grubmüller 1987 eine schon von Benecke (1816, XIII) und später von Docen ventilierte Hypothese möglicher Entstehungs- bzw. Autorvarianz. Docen schien es wahrscheinlich, dass Boner selbst eine eigene "frühere Ausgabe [...] hier und da änderte oder anders ordnete, und, nebst Vor- und Schlußrede, bis auf 100 vermehrte" (1821, 54). Ex aequo empfahl Grubmüller zu klären, ob der instabile Bestand "allein auf Verstümmelungen im Überlieferungsablauf zurückgeht oder ob sich darin von B[oner] zu verantwortende Editionsschritte spiegeln" (1987, 949), wie im Hinblick auf letztere kürzlich nochmal Cordula Kropik mutmaßte, nämlich, "dass der Kern der Sammlung bereits vorhanden und im Umlauf war, bevor Boner sie von letzter Hand zum geschlossenen Ganzen formte" (2021, 19). Die auf die Frage 'Aufwuchs oder Zerfall?' hinauslaufende Alternative ist hinsichtlich einer Neuedition insofern von konzepthafter Relevanz, als diese textgenetisch anzugehen wäre, sollte sie Ausgangs- und Endfassung möglicher Autorvarianz eines 'work in progress' dokumentieren, bzw. vice versa einen leithandschriftlich archetypnahen Autortext und seine Wirkformen anzielen müsste, sollte Überlieferungsvarianz die Heterogenitäten verursacht haben. Zwischenzeitliche stemmatologische Bemühungen (Bodemann/Dicke 1988) konnten die Frage nicht klären, da ihre Kollationsbasis auch allzu varianten Werkteilen wie Textüberschriften und Epimythien Rechnung trug, die beständiger mouvance durch individuelle Umformung, Auslassung oder Ergänzung ausgesetzt waren. Beschränkt man die Kollation indes – wie mittlerweile in einem zweiten Anlauf geschehen – auf die stabilsten Texteinheiten, nämlich die Erzählteile der Fabeln und Exempla, zeigt sich stemmatisch eine klar vertikale Deszendenz. In ihrem Verlauf ging das auktoriale Buchwerk, das Boner erst als fertiges, paratextuell planvoll zusammengehaltenes und geschlossenes in die Überlieferung einspeiste, bereits auf frühen Tradierungsstufen seiner kohärenzstiftenden Komponenten verlustig und entwickelte sich sukzezzive zu einer offenen, anonymen und desorganisierten 'lose-Text-Sammlung', der zwei Textzeugen daher auch nicht-bonersche Fabeln inserierten. Während Boner den Werkstatus durch den numerus perfectus mit 100 von Pro- und Epilog gerahmten Texten, durch Werktitel, Widmung und Selbstnennung befestigte, die vier ersten Fabeln als rezeptionsanleitende ausdeutete, zudem jedem Text erstens eine zweiteilige Überschrift beigab, die Akteure und Thema benannte, und zweitens ein aus den Quellen bezogenes lateinisches Distichon, das die 'Moral' sentenzartig komprimierte, kamen der Sammlung schon in Hyparchetypen der Kl. I erste Texte und sämtliche Tituli abhanden und in solchen der Kl. II und III neben weiteren Nummern dann auch die programmatische Anfangsabfolge sowie alle Distichen. Dabei kristallisierten sich zwei Wirkformate heraus: durch häufigen Verzicht auf Resümeeverse am Erzählteil-Ende und ausgedünnte Epimythien brachte Kl. III einen 'reduzierten' Edelstein ohne weiteren signifikanten Gestaltungswillen hervor, den Kl. II zwar wieder um einige Kl. I-Texte aufstockte, stilistisch aber insofern simplifizierte, als sich hier viele planes Verständnis hemmende Enjambements Boners getilgt finden – ein Bearbeitungsskopus, der häufig neue Reime, Versfolgen, Zusätze und Auslassungen bedingte und mit gelegentlichen Sinneinbußen einherging. Beide dieser Derivate sind Vulgatfassungen, die zusammengenommen gut vier Fünftel der Textzeugen ausmachen und das selbststolze Autorœuvre in den Hintergrund drängten.
Wodurch kam es zur beschriebenen Auflösung bzw. Überformung des auktorialen Sammelwerks? Nun, anders als in lateinischer Tradition, die Boner mit den im Schulunterricht verwendeten Aesop-Corpora des mittelalterlichen sog. Anonymus Neveleti und des spätantiken Avian die Hauptquellen vermittelte, waren Aesopica vor Boner deutsch nie planvoll gesammelt und auktorial corpushaft organisiert. Vielmehr waren sie vermischt etwa mit sonstiger Kleinepik des Strickers und/oder wie im Wiener Fabel- und Bîspelcorpus zu anonymen form- und funktionsähnlichen Textverbünden aggregiert, waren in Exempelfunktion eingestreut in die Kaiserchronik, in Hartmanns Erec, in deutsche Predigt, in Großdidaxe wie Thomasins Welscher Gast oder Hugos von Trimberg Renner, oder auch wie etwa bei Walther von der Vogelweide als spruchdichterisches Situationsargument beigezogen. Zwar mochte auch der Predigerbruder Boner seinen um Exempla aus vorwiegend dominikanischen Sammlungen ergänzten Fabelfundus zu solch eklektisch-selektivem Eigen- und Wiedergebrauch zusammengetragen haben, knüpfte daran aber jenen zusätzlichen Wirkanspruch der Bearbeitungs- und Organisationsleistung einer Verfasserautorität, der vom eingeschliffenen Gebrauchsprofil dieses Textmaterials wenig honoriert wurde. Jedenfalls geriet die Sammlung bereits auf frühen Stufen ihrer Weitergabe an Nutzer, die sich das werkkonstitutive Beiwerk ihres Urhebers zusehends ersparten und darüber des Autor- und Gönnernamens, des Titels und centenarischen Werkumfangs sowie seiner paratextuellen Organisation verlustig gingen. So überlebte den Medienwechsel ins gedruckte illustrierte Buch mit dem Pfisters von 1461 nur noch ein aus der Fassung gebrochener Edelstein – ein prolog- und damit anonymer und titelloser von nurmehr 86 überschriftslosen Texten, auch wenn sein gekürzter Epilog ein anonymes Ich behaupten lässt, es habe hundert peispil an dis puchlein geleit. Von dessen erhaltenen Handschriften überliefert diese allerdings keine mehr.
