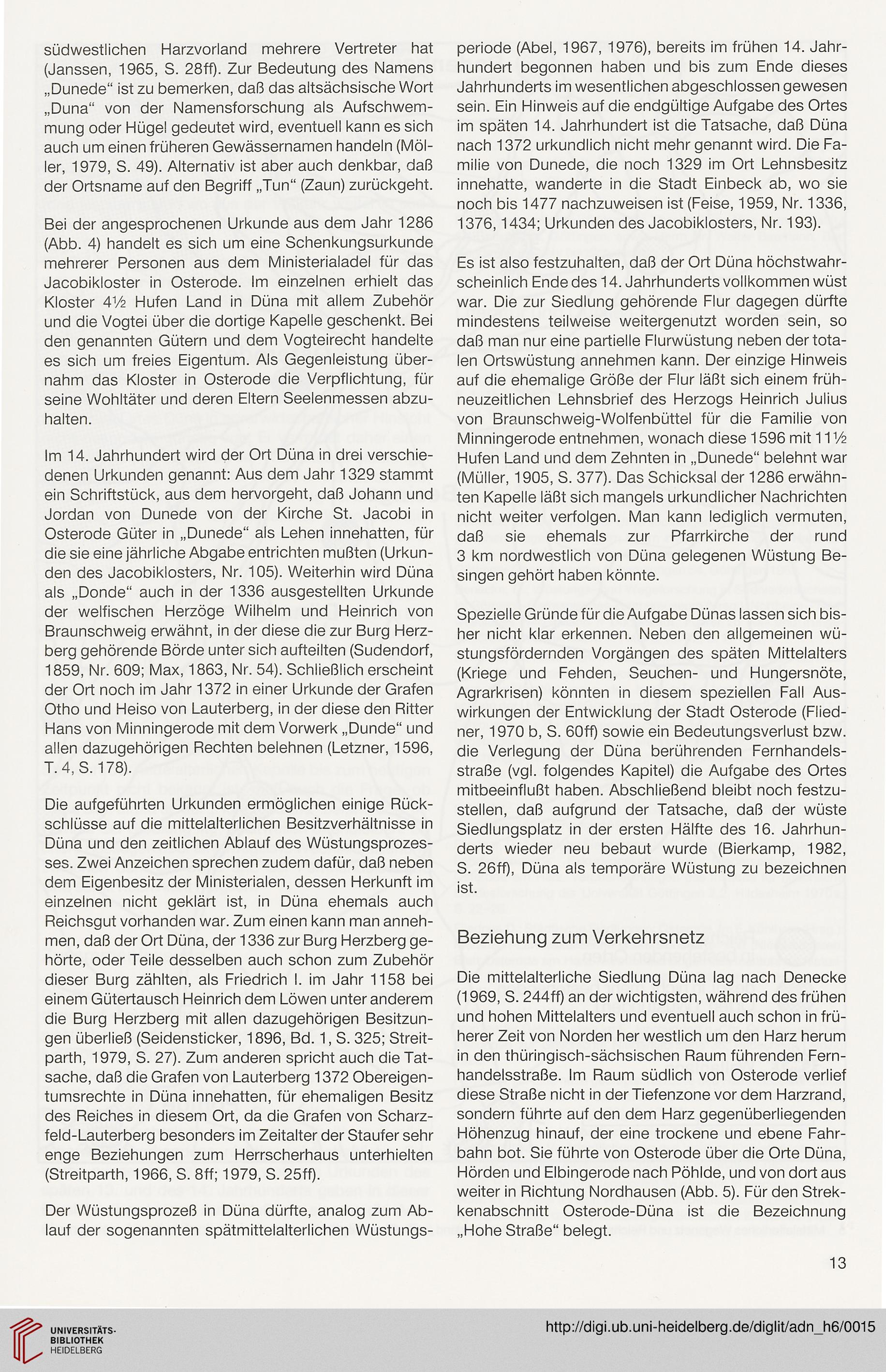südwestlichen Harzvorland mehrere Vertreter hat
(Janssen, 1965, S. 28ff). Zur Bedeutung des Namens
„Dunede“ ist zu bemerken, daß das altsächsische Wort
„Duna“ von der Namensforschung als Aufschwem-
mung oder Hügel gedeutet wird, eventuell kann es sich
auch um einen früheren Gewässernamen handeln (Möl-
ler, 1979, S. 49). Alternativ ist aber auch denkbar, daß
der Ortsname auf den Begriff „Tun“ (Zaun) zurückgeht.
Bei der angesprochenen Urkunde aus dem Jahr 1286
(Abb. 4) handelt es sich um eine Schenkungsurkunde
mehrerer Personen aus dem Ministerialadel für das
Jacobikloster in Osterode. Im einzelnen erhielt das
Kloster 41/2 Hufen Land in Düna mit allem Zubehör
und die Vogtei über die dortige Kapelle geschenkt. Bei
den genannten Gütern und dem Vogteirecht handelte
es sich um freies Eigentum. Als Gegenleistung über-
nahm das Kloster in Osterode die Verpflichtung, für
seine Wohltäter und deren Eltern Seelenmessen abzu-
halten.
Im 14. Jahrhundert wird der Ort Düna in drei verschie-
denen Urkunden genannt: Aus dem Jahr 1329 stammt
ein Schriftstück, aus dem hervorgeht, daß Johann und
Jordan von Dunede von der Kirche St. Jacobi in
Osterode Güter in „Dunede“ als Lehen innehatten, für
die sie eine jährliche Abgabe entrichten mußten (Urkun-
den des Jacobiklosters, Nr. 105). Weiterhin wird Düna
als „Donde“ auch in der 1336 ausgestellten Urkunde
der welfischen Herzöge Wilhelm und Heinrich von
Braunschweig erwähnt, in der diese die zur Burg Herz-
berg gehörende Börde unter sich aufteilten (Sudendorf,
1859, Nr. 609; Max, 1863, Nr. 54). Schließlich erscheint
der Ort noch im Jahr 1372 in einer Urkunde der Grafen
Otho und Heiso von Lauterberg, in der diese den Ritter
Hans von Minningerode mit dem Vorwerk „Dunde“ und
allen dazugehörigen Rechten belehnen (Letzner, 1596,
T.4, S. 178).
Die aufgeführten Urkunden ermöglichen einige Rück-
schlüsse auf die mittelalterlichen Besitzverhältnisse in
Düna und den zeitlichen Ablauf des Wüstungsprozes-
ses. Zwei Anzeichen sprechen zudem dafür, daß neben
dem Eigenbesitz der Ministerialen, dessen Herkunft im
einzelnen nicht geklärt ist, in Düna ehemals auch
Reichsgut vorhanden war. Zum einen kann man anneh-
men, daß der Ort Düna, der 1336 zur Burg Herzberg ge-
hörte, oder Teile desselben auch schon zum Zubehör
dieser Burg zählten, als Friedrich I. im Jahr 1158 bei
einem Gütertausch Heinrich dem Löwen unteranderem
die Burg Herzberg mit allen dazugehörigen Besitzun-
gen überließ (Seidensticker, 1896, Bd. 1, S. 325; Streit-
parth, 1979, S. 27). Zum anderen spricht auch die Tat-
sache, daß die Grafen von Lauterberg 1372 Obereigen-
tumsrechte in Düna innehatten, für ehemaligen Besitz
des Reiches in diesem Ort, da die Grafen von Scharz-
feld-Lauterberg besonders im Zeitalter der Staufer sehr
enge Beziehungen zum Herrscherhaus unterhielten
(Streitparth, 1966, S. 8ff; 1979, S. 25ff).
Der Wüstungsprozeß in Düna dürfte, analog zum Ab-
lauf der sogenannten spätmittelalterlichen Wüstungs-
periode (Abel, 1967, 1976), bereits im frühen 14. Jahr-
hundert begonnen haben und bis zum Ende dieses
Jahrhunderts im wesentlichen abgeschlossen gewesen
sein. Ein Hinweis auf die endgültige Aufgabe des Ortes
im späten 14. Jahrhundert ist die Tatsache, daß Düna
nach 1372 urkundlich nicht mehr genannt wird. Die Fa-
milie von Dunede, die noch 1329 im Ort Lehnsbesitz
innehatte, wanderte in die Stadt Einbeck ab, wo sie
noch bis 1477 nachzuweisen ist (Feise, 1959, Nr. 1336,
1376,1434; Urkunden des Jacobiklosters, Nr. 193).
Es ist also festzuhalten, daß der Ort Düna höchstwahr-
scheinlich Ende des 14. Jahrhunderts vollkommen wüst
war. Die zur Siedlung gehörende Flur dagegen dürfte
mindestens teilweise weitergenutzt worden sein, so
daß man nur eine partielle Flurwüstung neben der tota-
len Ortswüstung annehmen kann. Der einzige Hinweis
auf die ehemalige Größe der Flur läßt sich einem früh-
neuzeitlichen Lehnsbrief des Herzogs Heinrich Julius
von Braunschweig-Wolfenbüttel für die Familie von
Minningerode entnehmen, wonach diese 1596 mit 111/2
Hufen Land und dem Zehnten in „Dunede“ belehnt war
(Müller, 1905, S. 377). Das Schicksal der 1286 erwähn-
ten Kapelle läßt sich mangels urkundlicher Nachrichten
nicht weiter verfolgen. Man kann lediglich vermuten,
daß sie ehemals zur Pfarrkirche der rund
3 km nordwestlich von Düna gelegenen Wüstung Be-
singen gehört haben könnte.
Spezielle Gründe für die Aufgabe Dünas lassen sich bis-
her nicht klar erkennen. Neben den allgemeinen wü-
stungsfördernden Vorgängen des späten Mittelalters
(Kriege und Fehden, Seuchen- und Hungersnöte,
Agrarkrisen) könnten in diesem speziellen Fall Aus-
wirkungen der Entwicklung der Stadt Osterode (Flied-
ner, 1970 b, S. 60ff) sowie ein Bedeutungsverlust bzw.
die Verlegung der Düna berührenden Fernhandels-
straße (vgl. folgendes Kapitel) die Aufgabe des Ortes
mitbeeinflußt haben. Abschließend bleibt noch festzu-
steilen, daß aufgrund der Tatsache, daß der wüste
Siedlungsplatz in der ersten Hälfte des 16. Jahrhun-
derts wieder neu bebaut wurde (Bierkamp, 1982,
S. 26ff), Düna als temporäre Wüstung zu bezeichnen
ist.
Beziehung zum Verkehrsnetz
Die mittelalterliche Siedlung Düna lag nach Denecke
(1969, S. 244ff) an der wichtigsten, während des frühen
und hohen Mittelalters und eventuell auch schon in frü-
herer Zeit von Norden her westlich um den Harz herum
in den thüringisch-sächsischen Raum führenden Fern-
handelsstraße. Im Raum südlich von Osterode verlief
diese Straße nicht in der Tiefenzone vor dem Harzrand,
sondern führte auf den dem Harz gegenüberliegenden
Höhenzug hinauf, der eine trockene und ebene Fahr-
bahn bot. Sie führte von Osterode über die Orte Düna,
Hörden und Elbingerode nach Pöhlde, und von dort aus
weiter in Richtung Nordhausen (Abb. 5). Für den Strek-
kenabschnitt Osterode-Düna ist die Bezeichnung
„Hohe Straße“ belegt.
13
(Janssen, 1965, S. 28ff). Zur Bedeutung des Namens
„Dunede“ ist zu bemerken, daß das altsächsische Wort
„Duna“ von der Namensforschung als Aufschwem-
mung oder Hügel gedeutet wird, eventuell kann es sich
auch um einen früheren Gewässernamen handeln (Möl-
ler, 1979, S. 49). Alternativ ist aber auch denkbar, daß
der Ortsname auf den Begriff „Tun“ (Zaun) zurückgeht.
Bei der angesprochenen Urkunde aus dem Jahr 1286
(Abb. 4) handelt es sich um eine Schenkungsurkunde
mehrerer Personen aus dem Ministerialadel für das
Jacobikloster in Osterode. Im einzelnen erhielt das
Kloster 41/2 Hufen Land in Düna mit allem Zubehör
und die Vogtei über die dortige Kapelle geschenkt. Bei
den genannten Gütern und dem Vogteirecht handelte
es sich um freies Eigentum. Als Gegenleistung über-
nahm das Kloster in Osterode die Verpflichtung, für
seine Wohltäter und deren Eltern Seelenmessen abzu-
halten.
Im 14. Jahrhundert wird der Ort Düna in drei verschie-
denen Urkunden genannt: Aus dem Jahr 1329 stammt
ein Schriftstück, aus dem hervorgeht, daß Johann und
Jordan von Dunede von der Kirche St. Jacobi in
Osterode Güter in „Dunede“ als Lehen innehatten, für
die sie eine jährliche Abgabe entrichten mußten (Urkun-
den des Jacobiklosters, Nr. 105). Weiterhin wird Düna
als „Donde“ auch in der 1336 ausgestellten Urkunde
der welfischen Herzöge Wilhelm und Heinrich von
Braunschweig erwähnt, in der diese die zur Burg Herz-
berg gehörende Börde unter sich aufteilten (Sudendorf,
1859, Nr. 609; Max, 1863, Nr. 54). Schließlich erscheint
der Ort noch im Jahr 1372 in einer Urkunde der Grafen
Otho und Heiso von Lauterberg, in der diese den Ritter
Hans von Minningerode mit dem Vorwerk „Dunde“ und
allen dazugehörigen Rechten belehnen (Letzner, 1596,
T.4, S. 178).
Die aufgeführten Urkunden ermöglichen einige Rück-
schlüsse auf die mittelalterlichen Besitzverhältnisse in
Düna und den zeitlichen Ablauf des Wüstungsprozes-
ses. Zwei Anzeichen sprechen zudem dafür, daß neben
dem Eigenbesitz der Ministerialen, dessen Herkunft im
einzelnen nicht geklärt ist, in Düna ehemals auch
Reichsgut vorhanden war. Zum einen kann man anneh-
men, daß der Ort Düna, der 1336 zur Burg Herzberg ge-
hörte, oder Teile desselben auch schon zum Zubehör
dieser Burg zählten, als Friedrich I. im Jahr 1158 bei
einem Gütertausch Heinrich dem Löwen unteranderem
die Burg Herzberg mit allen dazugehörigen Besitzun-
gen überließ (Seidensticker, 1896, Bd. 1, S. 325; Streit-
parth, 1979, S. 27). Zum anderen spricht auch die Tat-
sache, daß die Grafen von Lauterberg 1372 Obereigen-
tumsrechte in Düna innehatten, für ehemaligen Besitz
des Reiches in diesem Ort, da die Grafen von Scharz-
feld-Lauterberg besonders im Zeitalter der Staufer sehr
enge Beziehungen zum Herrscherhaus unterhielten
(Streitparth, 1966, S. 8ff; 1979, S. 25ff).
Der Wüstungsprozeß in Düna dürfte, analog zum Ab-
lauf der sogenannten spätmittelalterlichen Wüstungs-
periode (Abel, 1967, 1976), bereits im frühen 14. Jahr-
hundert begonnen haben und bis zum Ende dieses
Jahrhunderts im wesentlichen abgeschlossen gewesen
sein. Ein Hinweis auf die endgültige Aufgabe des Ortes
im späten 14. Jahrhundert ist die Tatsache, daß Düna
nach 1372 urkundlich nicht mehr genannt wird. Die Fa-
milie von Dunede, die noch 1329 im Ort Lehnsbesitz
innehatte, wanderte in die Stadt Einbeck ab, wo sie
noch bis 1477 nachzuweisen ist (Feise, 1959, Nr. 1336,
1376,1434; Urkunden des Jacobiklosters, Nr. 193).
Es ist also festzuhalten, daß der Ort Düna höchstwahr-
scheinlich Ende des 14. Jahrhunderts vollkommen wüst
war. Die zur Siedlung gehörende Flur dagegen dürfte
mindestens teilweise weitergenutzt worden sein, so
daß man nur eine partielle Flurwüstung neben der tota-
len Ortswüstung annehmen kann. Der einzige Hinweis
auf die ehemalige Größe der Flur läßt sich einem früh-
neuzeitlichen Lehnsbrief des Herzogs Heinrich Julius
von Braunschweig-Wolfenbüttel für die Familie von
Minningerode entnehmen, wonach diese 1596 mit 111/2
Hufen Land und dem Zehnten in „Dunede“ belehnt war
(Müller, 1905, S. 377). Das Schicksal der 1286 erwähn-
ten Kapelle läßt sich mangels urkundlicher Nachrichten
nicht weiter verfolgen. Man kann lediglich vermuten,
daß sie ehemals zur Pfarrkirche der rund
3 km nordwestlich von Düna gelegenen Wüstung Be-
singen gehört haben könnte.
Spezielle Gründe für die Aufgabe Dünas lassen sich bis-
her nicht klar erkennen. Neben den allgemeinen wü-
stungsfördernden Vorgängen des späten Mittelalters
(Kriege und Fehden, Seuchen- und Hungersnöte,
Agrarkrisen) könnten in diesem speziellen Fall Aus-
wirkungen der Entwicklung der Stadt Osterode (Flied-
ner, 1970 b, S. 60ff) sowie ein Bedeutungsverlust bzw.
die Verlegung der Düna berührenden Fernhandels-
straße (vgl. folgendes Kapitel) die Aufgabe des Ortes
mitbeeinflußt haben. Abschließend bleibt noch festzu-
steilen, daß aufgrund der Tatsache, daß der wüste
Siedlungsplatz in der ersten Hälfte des 16. Jahrhun-
derts wieder neu bebaut wurde (Bierkamp, 1982,
S. 26ff), Düna als temporäre Wüstung zu bezeichnen
ist.
Beziehung zum Verkehrsnetz
Die mittelalterliche Siedlung Düna lag nach Denecke
(1969, S. 244ff) an der wichtigsten, während des frühen
und hohen Mittelalters und eventuell auch schon in frü-
herer Zeit von Norden her westlich um den Harz herum
in den thüringisch-sächsischen Raum führenden Fern-
handelsstraße. Im Raum südlich von Osterode verlief
diese Straße nicht in der Tiefenzone vor dem Harzrand,
sondern führte auf den dem Harz gegenüberliegenden
Höhenzug hinauf, der eine trockene und ebene Fahr-
bahn bot. Sie führte von Osterode über die Orte Düna,
Hörden und Elbingerode nach Pöhlde, und von dort aus
weiter in Richtung Nordhausen (Abb. 5). Für den Strek-
kenabschnitt Osterode-Düna ist die Bezeichnung
„Hohe Straße“ belegt.
13