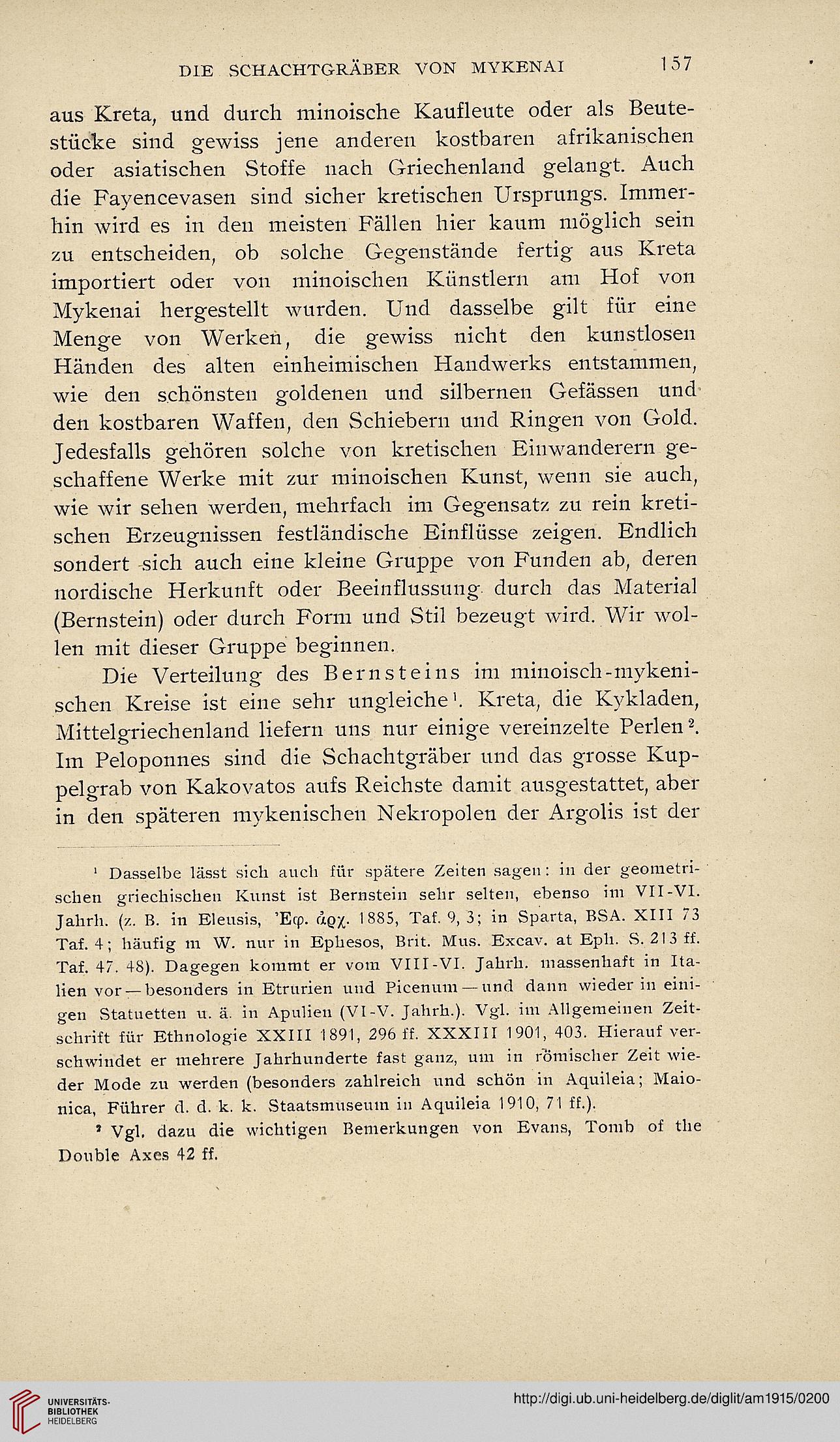DIE SCHACHTGRÄBER VON MYKENAI
157
aus Kreta, und durch minoische Kaufleute oder als Beute-
stücke sind gewiss jene anderen kostbaren afrikanischen
oder asiatischen Stoffe nach Griechenland gelangt. Auch
die Fayencevasen sind sicher kretischen Ursprungs. Immer-
hin wird es in den meisten Fällen hier kaum möglich sein
zu entscheiden, ob solche Gegenstände fertig aus Kreta
importiert oder von minoischen Künstlern am Hof von
Mykenai hergestellt wurden. Und dasselbe gilt für eine
Menge von Werken, die gewiss nicht den kunstlosen
Händen des alten einheimischen Handwerks entstammen,
wie den schönsten goldenen und silbernen Gefässen und
den kostbaren Waffen, den Schiebern und Ringen von Gold.
Jedesfalls gehören solche von kretischen Einwanderern ge-
schaffene Werke mit zur minoischen Kunst, wenn sie auch,
wie wir sehen werden, mehrfach im Gegensatz zu rein kreti-
schen Erzeugnissen festländische Einflüsse zeigen. Endlich
sondert sich auch eine kleine Gruppe von Funden ab, deren
nordische Herkunft oder Beeinflussung durch das Material
(Bernstein) oder durch Form und Stil bezeugt wird. Wir wol-
len mit dieser Gruppe beginnen.
Die Verteilung des Bernsteins im minoisch-mykeni-
schen Kreise ist eine sehr ungleiche1. Kreta, die Kykladen,
Mittelgriechenland liefern uns nur einige vereinzelte Perlen2.
Im Peloponnes sind die Schachtgräber und das grosse Kup-
pelgrab von Kakovatos aufs Reichste damit ausgestattet, aber
in den späteren mykenischen Nekropolen der Argolis ist der
1 Dasselbe lässt sich auch für spätere Zeiten sagen: in der geometri-
schen griechischen Kunst ist Bernstein sehr selten, ebenso im VII-Vl.
Jahrh. (z. B. in Eleusis, ’Erp. <ig^. 1885, Taf. 9, 3; in Sparta, BSA. XIII 73
Taf. 4; häufig m W. nur in Ephesos, Brit. Mus. Excav. at Eph. S. 213 ff.
Taf. 47. 48). Dagegen kommt er vom VIII-VI. Jahrh. massenhaft in Ita-
lien vor — besonders in Etrurien und Picenum — und dann wieder in eini-
gen Statuetten u. ä. in Apulien (VI-V. Jahrh.). Vgl. im Allgemeinen Zeit-
schrift für Ethnologie XXIII 1891, 296 ff. XXXIII 1901, 403. Hierauf ver-
schwindet er mehrere Jahrhunderte fast ganz, um in römischer Zeit wie-
der Mode zu werden (besonders zahlreich und schön in Aquileia; Maio-
nica, Führer d. d. k. k. Staatsmuseum in Aquileia 1910, 71 ff.).
’ Vgl, dazu die wichtigen Bemerkungen von Evans, Tomb of the
Double Axes 42 ff.
157
aus Kreta, und durch minoische Kaufleute oder als Beute-
stücke sind gewiss jene anderen kostbaren afrikanischen
oder asiatischen Stoffe nach Griechenland gelangt. Auch
die Fayencevasen sind sicher kretischen Ursprungs. Immer-
hin wird es in den meisten Fällen hier kaum möglich sein
zu entscheiden, ob solche Gegenstände fertig aus Kreta
importiert oder von minoischen Künstlern am Hof von
Mykenai hergestellt wurden. Und dasselbe gilt für eine
Menge von Werken, die gewiss nicht den kunstlosen
Händen des alten einheimischen Handwerks entstammen,
wie den schönsten goldenen und silbernen Gefässen und
den kostbaren Waffen, den Schiebern und Ringen von Gold.
Jedesfalls gehören solche von kretischen Einwanderern ge-
schaffene Werke mit zur minoischen Kunst, wenn sie auch,
wie wir sehen werden, mehrfach im Gegensatz zu rein kreti-
schen Erzeugnissen festländische Einflüsse zeigen. Endlich
sondert sich auch eine kleine Gruppe von Funden ab, deren
nordische Herkunft oder Beeinflussung durch das Material
(Bernstein) oder durch Form und Stil bezeugt wird. Wir wol-
len mit dieser Gruppe beginnen.
Die Verteilung des Bernsteins im minoisch-mykeni-
schen Kreise ist eine sehr ungleiche1. Kreta, die Kykladen,
Mittelgriechenland liefern uns nur einige vereinzelte Perlen2.
Im Peloponnes sind die Schachtgräber und das grosse Kup-
pelgrab von Kakovatos aufs Reichste damit ausgestattet, aber
in den späteren mykenischen Nekropolen der Argolis ist der
1 Dasselbe lässt sich auch für spätere Zeiten sagen: in der geometri-
schen griechischen Kunst ist Bernstein sehr selten, ebenso im VII-Vl.
Jahrh. (z. B. in Eleusis, ’Erp. <ig^. 1885, Taf. 9, 3; in Sparta, BSA. XIII 73
Taf. 4; häufig m W. nur in Ephesos, Brit. Mus. Excav. at Eph. S. 213 ff.
Taf. 47. 48). Dagegen kommt er vom VIII-VI. Jahrh. massenhaft in Ita-
lien vor — besonders in Etrurien und Picenum — und dann wieder in eini-
gen Statuetten u. ä. in Apulien (VI-V. Jahrh.). Vgl. im Allgemeinen Zeit-
schrift für Ethnologie XXIII 1891, 296 ff. XXXIII 1901, 403. Hierauf ver-
schwindet er mehrere Jahrhunderte fast ganz, um in römischer Zeit wie-
der Mode zu werden (besonders zahlreich und schön in Aquileia; Maio-
nica, Führer d. d. k. k. Staatsmuseum in Aquileia 1910, 71 ff.).
’ Vgl, dazu die wichtigen Bemerkungen von Evans, Tomb of the
Double Axes 42 ff.