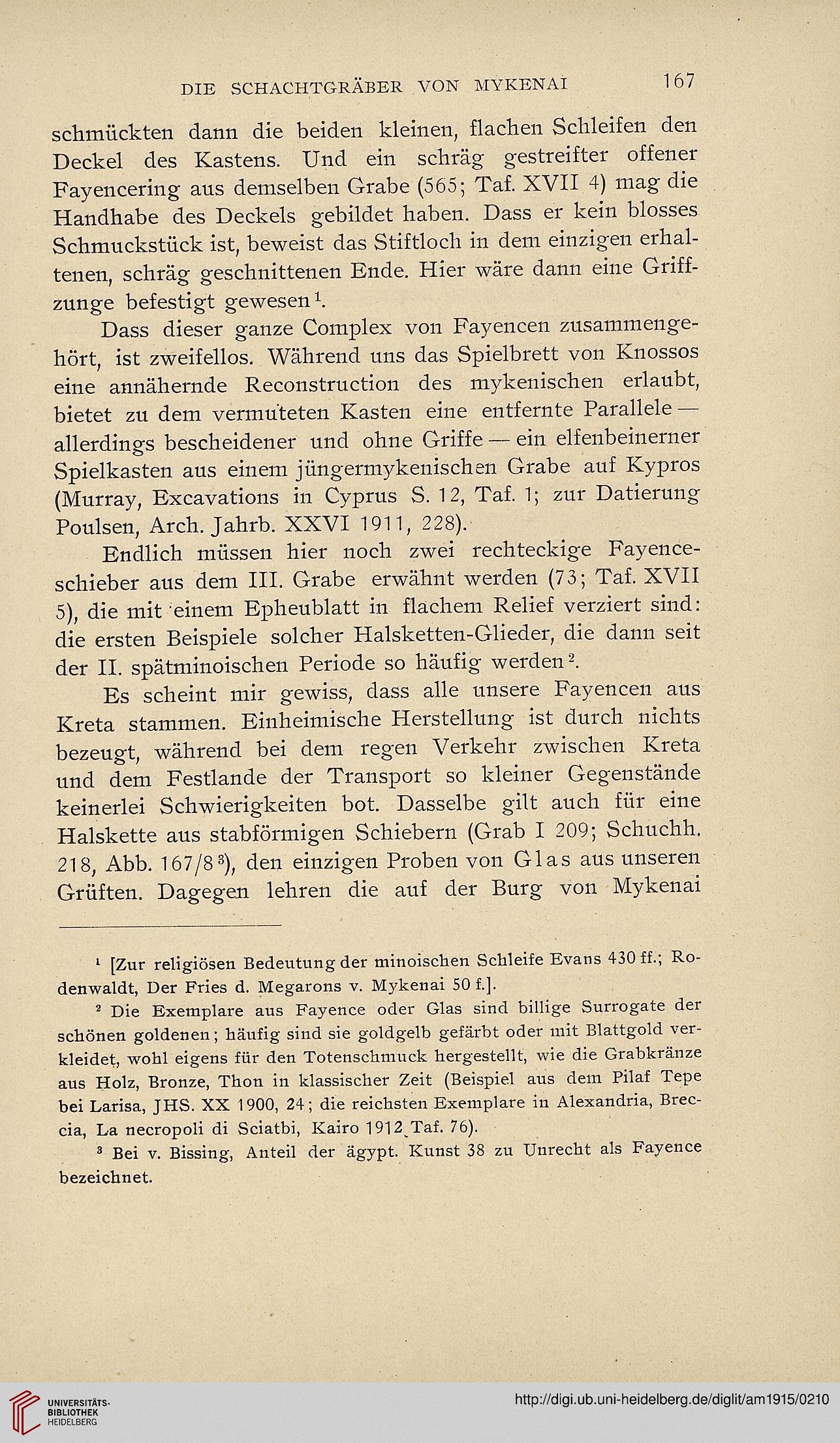DIE SCHACHTGRÄBER VON MYKENAI
167
schmückten dann die beiden kleinen, flachen Schleifen den
Deckel des Kastens. Und ein schräg gestreifter offener
Fayencering aus demselben Grabe (565; Taf. XVII 4) mag die
Handhabe des Deckels gebildet haben. Dass er kein blosses
Schmuckstück ist, beweist das Stiftloch in dem einzigen erhal-
tenen, schräg geschnittenen Ende. Hier wäre dann eine Griff-
zunge befestigt gewesen1.
Dass dieser ganze Complex von Fayencen zusammenge-
hört, ist zweifellos. Während uns das Spielbrett von Knossos
eine annähernde Reconstruction des mykenischen erlaubt,
bietet zu dem vermuteten Kasten eine entfernte Parallele —
allerdings bescheidener und ohne Griffe — ein elfenbeinerner
Spielkasten aus einem jüngermykenischen Grabe auf Kypros
(Murray, Excavations in Cyprus S. 12, Taf. 1; zur Datierung
Poulsen, Arch. Jahrb. XXVI 191 1, 228).
Endlich müssen hier noch zwei rechteckige Fayence-
schieber aus dem III. Grabe erwähnt werden (73; Taf. XVII
5), die mit einem Epheublatt in flachem Relief verziert sind:
die ersten Beispiele solcher Halsketten-Glieder, die dann seit
der II. spätminoischen Periode so häufig werden2.
Es scheint mir gewiss, dass alle unsere Fayencen aus
Kreta stammen. Einheimische Herstellung ist durch nichts
bezeugt, während bei dem regen Verkehr zwischen Kreta
und dem Festlande der Transport so kleiner Gegenstände
keinerlei Schwierigkeiten bot. Dasselbe gilt auch für eine
Halskette aus stabförmigen Schiebern (Grab I 209; Schuchh.
218, Abb. 167/83), den einzigen Proben von Glas aus unseren
Grüften. Dagegen lehren die auf der Burg von Mykenai
1 [Zur religiösen Bedeutung der minoischen Schleife Evans 430 ff.; Ro-
denwaldt, Der Fries d. Megarons v. Mykenai 50 f.].
2 Die Exemplare aus Fayence oder Glas sind billige Surrogate der
schönen goldenen; häufig sind sie goldgelb gefärbt oder mit Blattgold ver-
kleidet, wohl eigens für den Totenschmuck hergestellt, wie die Grabkränze
aus Holz, Bronze, Thon in klassischer Zeit (Beispiel aus dem Pilaf Tepe
bei Larisa, JHS. XX 1 900, 24; die reichsten Exemplare in Alexandria, Brec-
cia, La necropoli di Sciatbi, Kairo 1912 Taf. 76).
3 Bei v. Bissing, Anteil der ägypt. Kunst 38 zu Unrecht als Fayence
bezeichnet.
167
schmückten dann die beiden kleinen, flachen Schleifen den
Deckel des Kastens. Und ein schräg gestreifter offener
Fayencering aus demselben Grabe (565; Taf. XVII 4) mag die
Handhabe des Deckels gebildet haben. Dass er kein blosses
Schmuckstück ist, beweist das Stiftloch in dem einzigen erhal-
tenen, schräg geschnittenen Ende. Hier wäre dann eine Griff-
zunge befestigt gewesen1.
Dass dieser ganze Complex von Fayencen zusammenge-
hört, ist zweifellos. Während uns das Spielbrett von Knossos
eine annähernde Reconstruction des mykenischen erlaubt,
bietet zu dem vermuteten Kasten eine entfernte Parallele —
allerdings bescheidener und ohne Griffe — ein elfenbeinerner
Spielkasten aus einem jüngermykenischen Grabe auf Kypros
(Murray, Excavations in Cyprus S. 12, Taf. 1; zur Datierung
Poulsen, Arch. Jahrb. XXVI 191 1, 228).
Endlich müssen hier noch zwei rechteckige Fayence-
schieber aus dem III. Grabe erwähnt werden (73; Taf. XVII
5), die mit einem Epheublatt in flachem Relief verziert sind:
die ersten Beispiele solcher Halsketten-Glieder, die dann seit
der II. spätminoischen Periode so häufig werden2.
Es scheint mir gewiss, dass alle unsere Fayencen aus
Kreta stammen. Einheimische Herstellung ist durch nichts
bezeugt, während bei dem regen Verkehr zwischen Kreta
und dem Festlande der Transport so kleiner Gegenstände
keinerlei Schwierigkeiten bot. Dasselbe gilt auch für eine
Halskette aus stabförmigen Schiebern (Grab I 209; Schuchh.
218, Abb. 167/83), den einzigen Proben von Glas aus unseren
Grüften. Dagegen lehren die auf der Burg von Mykenai
1 [Zur religiösen Bedeutung der minoischen Schleife Evans 430 ff.; Ro-
denwaldt, Der Fries d. Megarons v. Mykenai 50 f.].
2 Die Exemplare aus Fayence oder Glas sind billige Surrogate der
schönen goldenen; häufig sind sie goldgelb gefärbt oder mit Blattgold ver-
kleidet, wohl eigens für den Totenschmuck hergestellt, wie die Grabkränze
aus Holz, Bronze, Thon in klassischer Zeit (Beispiel aus dem Pilaf Tepe
bei Larisa, JHS. XX 1 900, 24; die reichsten Exemplare in Alexandria, Brec-
cia, La necropoli di Sciatbi, Kairo 1912 Taf. 76).
3 Bei v. Bissing, Anteil der ägypt. Kunst 38 zu Unrecht als Fayence
bezeichnet.