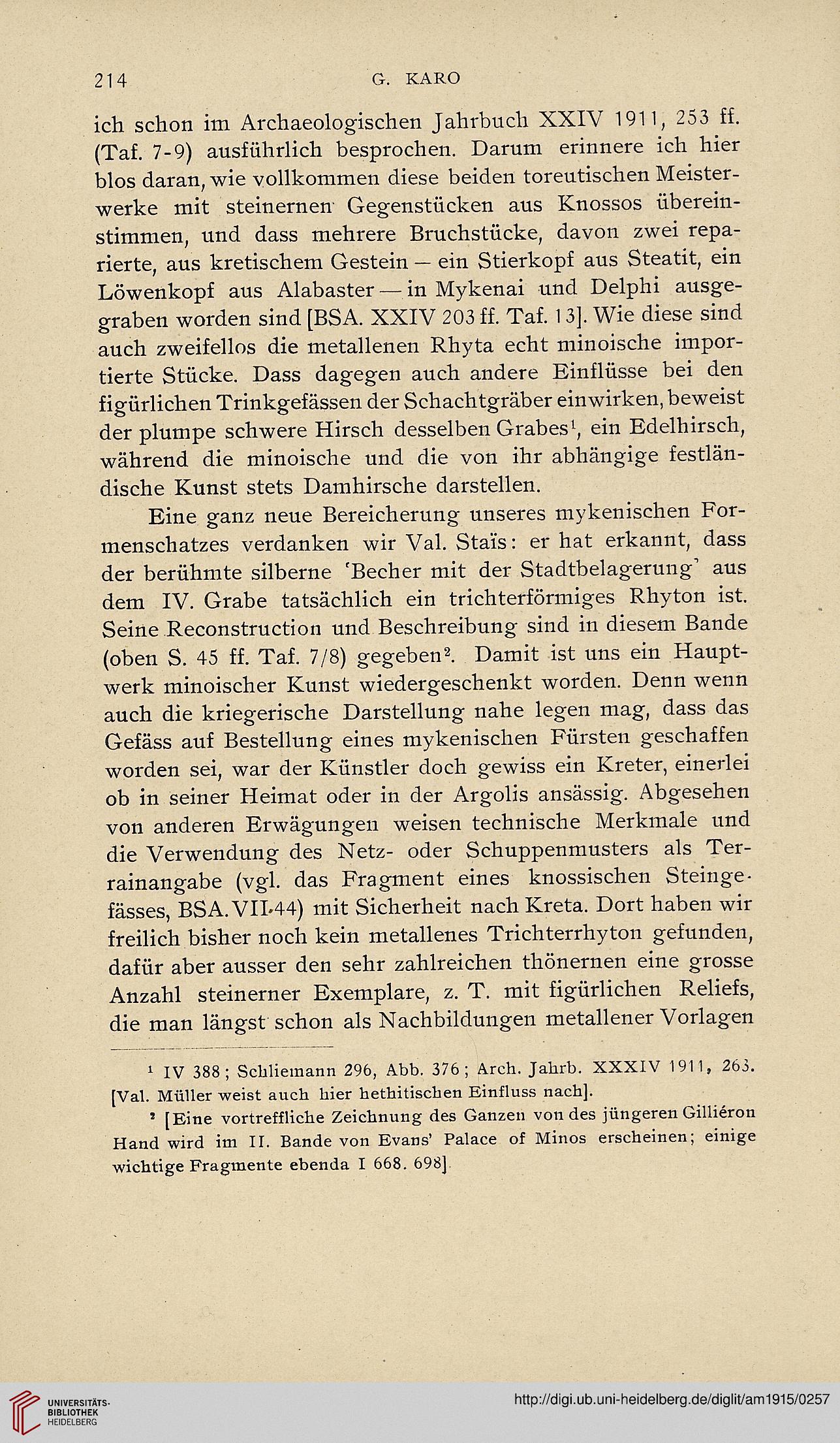214
G. KARO
ich schon im Archaeologischen Jahrbuch XXIV 1911, 253 ff.
(Taf. 7-9) ausführlich besprochen. Darum erinnere ich hier
blos daran, wie vollkommen diese beiden toreutischen Meister-
werke mit steinernen Gegenstücken aus Knossos überein-
stimmen, und dass mehrere Bruchstücke, davon zwei repa-
rierte, aus kretischem Gestein — ein Stierkopf aus Steatit, ein
Löwenkopf aus Alabaster — in Mykenai und Delphi ausge-
graben worden sind [BSA. XXIV 203 ff. Taf. 13]. Wie diese sind
auch zweifellos die metallenen Rhyta echt minoische impor-
tierte Stücke. Dass dagegen auch andere Einflüsse bei den
figürlichen Trinkgefässen der Schachtgräber einwirken, beweist
der plumpe schwere Hirsch desselben Grabes1, ein Edelhirsch,
während die minoische und die von ihr abhängige festlän-
dische Kunst stets Damhirsche darstellen.
Eine ganz neue Bereicherung unseres mykenischen For-
menschatzes verdanken wir Val. Stais: er hat erkannt, dass
der berühmte silberne 'Becher mit der Stadtbelagerung’ aus
dem IV. Grabe tatsächlich ein trichterförmiges Rhyton ist.
Seine Reconstruction und Beschreibung sind in diesem Bande
(oben S. 45 ff. Taf. 7/8) gegeben2. Damit ist uns ein Haupt-
werk minoischer Kunst wiedergeschenkt worden. Denn wenn
auch die kriegerische Darstellung nahe legen mag, dass das
Gefäss auf Bestellung eines mykenischen Fürsten geschaffen
worden sei, war der Künstler doch gewiss ein Kreter, einerlei
ob in seiner Heimat oder in der Argolis ansässig. Abgesehen
von anderen Erwägungen weisen technische Merkmale und
die Verwendung des Netz- oder Schuppenmusters als Ter-
rainangabe (vgl. das Fragment eines knossischen Steinge-
fässes, BSA.VIF44) mit Sicherheit nach Kreta. Dort haben wir
freilich bisher noch kein metallenes Trichterrhyton gefunden,
dafür aber ausser den sehr zahlreichen thönernen eine grosse
Anzahl steinerner Exemplare, z. T. mit figürlichen Reliefs,
die man längst schon als Nachbildungen metallener Vorlagen
1 IV 388; Schliemann 296, Abb. 376; Arch. Jalirb. XXXIV 1911, 263.
[Val. Müller weist auch hier hethitischen Einfluss nach],
! [Eine vortreffliche Zeichnung des Ganzen von des jüngeren Gillieron
Hand wird im II. Bande von Evans’ Palace of Minos erscheinen; einige
wichtige Fragmente ebenda I 668. 698]
G. KARO
ich schon im Archaeologischen Jahrbuch XXIV 1911, 253 ff.
(Taf. 7-9) ausführlich besprochen. Darum erinnere ich hier
blos daran, wie vollkommen diese beiden toreutischen Meister-
werke mit steinernen Gegenstücken aus Knossos überein-
stimmen, und dass mehrere Bruchstücke, davon zwei repa-
rierte, aus kretischem Gestein — ein Stierkopf aus Steatit, ein
Löwenkopf aus Alabaster — in Mykenai und Delphi ausge-
graben worden sind [BSA. XXIV 203 ff. Taf. 13]. Wie diese sind
auch zweifellos die metallenen Rhyta echt minoische impor-
tierte Stücke. Dass dagegen auch andere Einflüsse bei den
figürlichen Trinkgefässen der Schachtgräber einwirken, beweist
der plumpe schwere Hirsch desselben Grabes1, ein Edelhirsch,
während die minoische und die von ihr abhängige festlän-
dische Kunst stets Damhirsche darstellen.
Eine ganz neue Bereicherung unseres mykenischen For-
menschatzes verdanken wir Val. Stais: er hat erkannt, dass
der berühmte silberne 'Becher mit der Stadtbelagerung’ aus
dem IV. Grabe tatsächlich ein trichterförmiges Rhyton ist.
Seine Reconstruction und Beschreibung sind in diesem Bande
(oben S. 45 ff. Taf. 7/8) gegeben2. Damit ist uns ein Haupt-
werk minoischer Kunst wiedergeschenkt worden. Denn wenn
auch die kriegerische Darstellung nahe legen mag, dass das
Gefäss auf Bestellung eines mykenischen Fürsten geschaffen
worden sei, war der Künstler doch gewiss ein Kreter, einerlei
ob in seiner Heimat oder in der Argolis ansässig. Abgesehen
von anderen Erwägungen weisen technische Merkmale und
die Verwendung des Netz- oder Schuppenmusters als Ter-
rainangabe (vgl. das Fragment eines knossischen Steinge-
fässes, BSA.VIF44) mit Sicherheit nach Kreta. Dort haben wir
freilich bisher noch kein metallenes Trichterrhyton gefunden,
dafür aber ausser den sehr zahlreichen thönernen eine grosse
Anzahl steinerner Exemplare, z. T. mit figürlichen Reliefs,
die man längst schon als Nachbildungen metallener Vorlagen
1 IV 388; Schliemann 296, Abb. 376; Arch. Jalirb. XXXIV 1911, 263.
[Val. Müller weist auch hier hethitischen Einfluss nach],
! [Eine vortreffliche Zeichnung des Ganzen von des jüngeren Gillieron
Hand wird im II. Bande von Evans’ Palace of Minos erscheinen; einige
wichtige Fragmente ebenda I 668. 698]