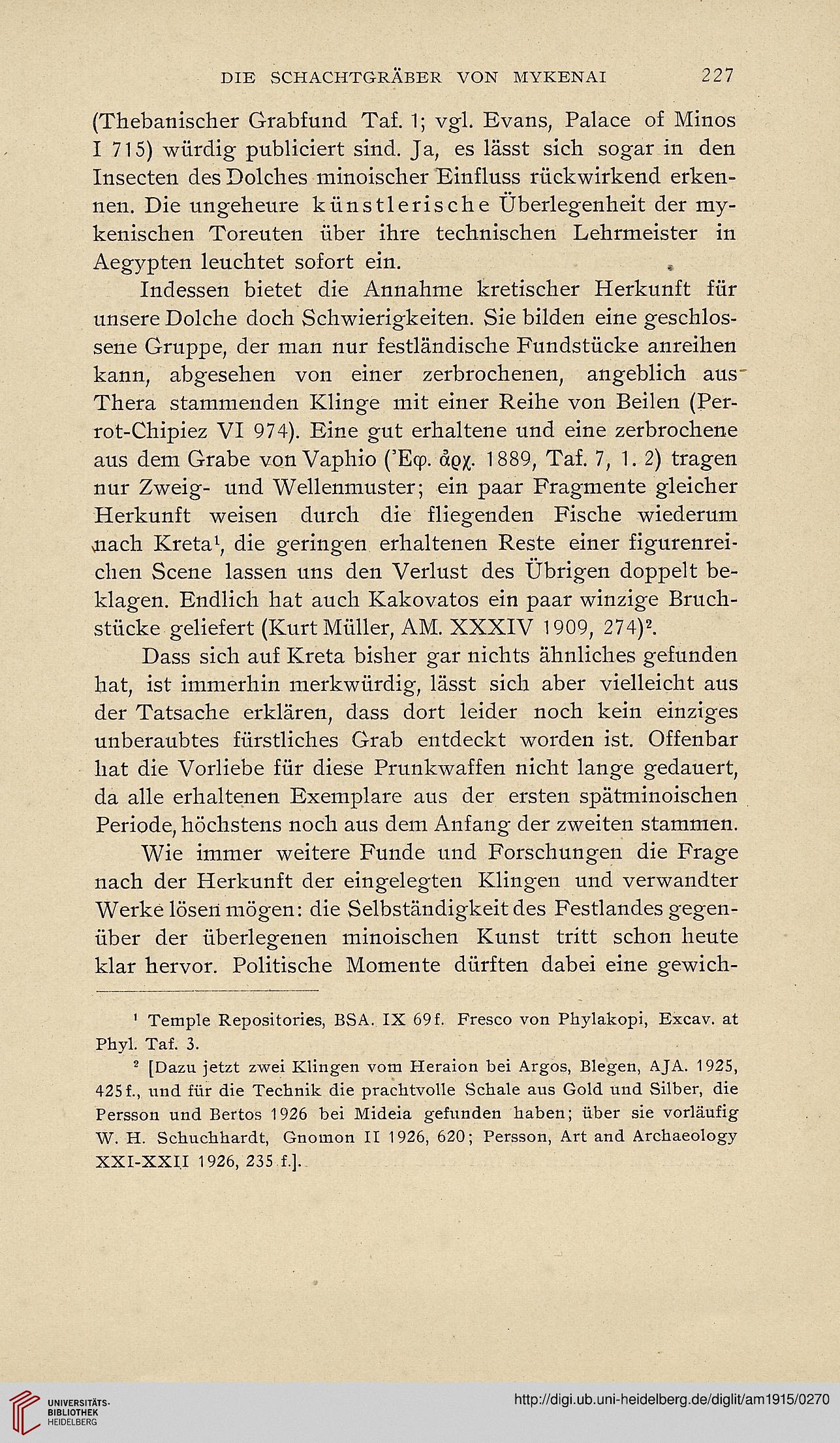DIE SCHACHTGRÄBER VON MYKENAI
227
(Thebatiischer Grabfund Taf. 1; vgl. Evans, Palace of Minos
1715) würdig publiciert sind. Ja, es lässt sich sogar in den
Insecten des Dolches minoischer Einfluss rückwirkend erken-
nen. Die ungeheure künstlerische Überlegenheit der my-
kenischen Toreuten über ihre technischen Lehrmeister in
Aegypten leuchtet sofort ein. «
Indessen bietet die Annahme kretischer Herkunft für
unsere Dolche doch Schwierigkeiten. Sie bilden eine geschlos-
sene Gruppe, der man nur festländische Fundstücke anreihen
kann, abgesehen von einer zerbrochenen, angeblich aus"
Thera stammenden Klinge mit einer Reihe von Beilen (Per-
rot-Chipiez VI 974). Eine gut erhaltene und eine zerbrochene
aus dem Grabe von Vapliio (’Eqp. apx- 1889, Taf. 7, 1.2) tragen
nur Zweig- und Wellenmuster; ein paar Fragmente gleicher
Herkunft weisen durch die fliegenden Fische wiederum
aiach Kreta1, die geringen erhaltenen Reste einer figurenrei-
chen Scene lassen uns den Verlust des Übrigen doppelt be-
klagen. Endlich hat auch Kakovatos ein paar winzige Bruch-
stücke geliefert (Kurt Müller, AM. XXXIV 1909, 274)2.
Dass sich auf Kreta bisher gar nichts ähnliches gefunden
hat, ist immerhin merkwürdig, lässt sich aber vielleicht aus
der Tatsache erklären, dass dort leider noch kein einziges
unberaubtes fürstliches Grab entdeckt worden ist. Offenbar
hat die Vorliebe für diese Prunkwaffen nicht lange gedauert,
da alle erhaltenen Exemplare aus der ersten spätminoischen
Periode, höchstens noch aus dem Anfang der zweiten stammen.
Wie immer weitere Funde und Forschungen die Frage
nach der Herkunft der eingelegten Klingen und verwandter
Werke lösen mögen: die Selbständigkeit des Festlandes gegen-
über der überlegenen minoischen Kunst tritt schon heute
klar hervor. Politische Momente dürften dabei eine gewich-
1 Temple Repositories, BSA. IX 69 f. Fresco von Phylakopi, Excav. at
Phyl. Taf. 3.
2 [Dazu jetzt zwei Klingen vom Pleraion bei Argos, Biegen, AJA. 1925,
425 f., und für die Technik die prachtvolle Schale aus Gold und Silber, die
Persson und Bertos 1926 bei Mideia gefunden haben; über sie vorläufig
W. H. Schuchhardt, Gnomon II 1926, 620; Persson, Art and Archaeology
XXI-XXII 1926, 235 f.[.
227
(Thebatiischer Grabfund Taf. 1; vgl. Evans, Palace of Minos
1715) würdig publiciert sind. Ja, es lässt sich sogar in den
Insecten des Dolches minoischer Einfluss rückwirkend erken-
nen. Die ungeheure künstlerische Überlegenheit der my-
kenischen Toreuten über ihre technischen Lehrmeister in
Aegypten leuchtet sofort ein. «
Indessen bietet die Annahme kretischer Herkunft für
unsere Dolche doch Schwierigkeiten. Sie bilden eine geschlos-
sene Gruppe, der man nur festländische Fundstücke anreihen
kann, abgesehen von einer zerbrochenen, angeblich aus"
Thera stammenden Klinge mit einer Reihe von Beilen (Per-
rot-Chipiez VI 974). Eine gut erhaltene und eine zerbrochene
aus dem Grabe von Vapliio (’Eqp. apx- 1889, Taf. 7, 1.2) tragen
nur Zweig- und Wellenmuster; ein paar Fragmente gleicher
Herkunft weisen durch die fliegenden Fische wiederum
aiach Kreta1, die geringen erhaltenen Reste einer figurenrei-
chen Scene lassen uns den Verlust des Übrigen doppelt be-
klagen. Endlich hat auch Kakovatos ein paar winzige Bruch-
stücke geliefert (Kurt Müller, AM. XXXIV 1909, 274)2.
Dass sich auf Kreta bisher gar nichts ähnliches gefunden
hat, ist immerhin merkwürdig, lässt sich aber vielleicht aus
der Tatsache erklären, dass dort leider noch kein einziges
unberaubtes fürstliches Grab entdeckt worden ist. Offenbar
hat die Vorliebe für diese Prunkwaffen nicht lange gedauert,
da alle erhaltenen Exemplare aus der ersten spätminoischen
Periode, höchstens noch aus dem Anfang der zweiten stammen.
Wie immer weitere Funde und Forschungen die Frage
nach der Herkunft der eingelegten Klingen und verwandter
Werke lösen mögen: die Selbständigkeit des Festlandes gegen-
über der überlegenen minoischen Kunst tritt schon heute
klar hervor. Politische Momente dürften dabei eine gewich-
1 Temple Repositories, BSA. IX 69 f. Fresco von Phylakopi, Excav. at
Phyl. Taf. 3.
2 [Dazu jetzt zwei Klingen vom Pleraion bei Argos, Biegen, AJA. 1925,
425 f., und für die Technik die prachtvolle Schale aus Gold und Silber, die
Persson und Bertos 1926 bei Mideia gefunden haben; über sie vorläufig
W. H. Schuchhardt, Gnomon II 1926, 620; Persson, Art and Archaeology
XXI-XXII 1926, 235 f.[.