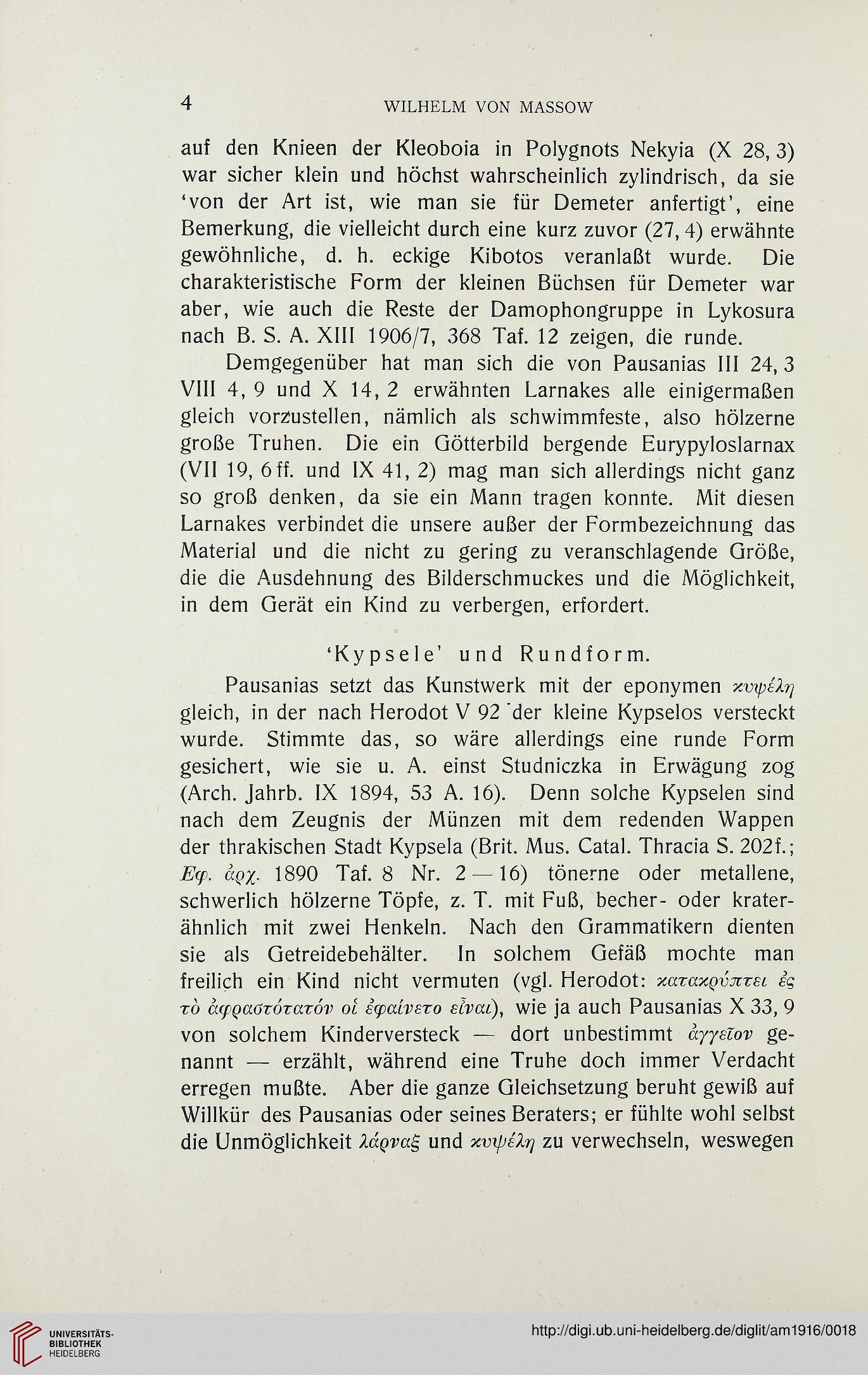4
WILHELM VON MASSOW
auf den Knieen der Kleoboia in Polygnots Nekyia (X 28,3)
war sicher klein und höchst wahrscheinlich zylindrisch, da sie
‘von der Art ist, wie man sie für Demeter anfertigt’, eine
Bemerkung, die vielleicht durch eine kurz zuvor (27,4) erwähnte
gewöhnliche, d. h. eckige Kibotos veranlaßt wurde. Die
charakteristische Form der kleinen Büchsen für Demeter war
aber, wie auch die Reste der Damophongruppe in Lykosura
nach B. S. A. XIII 1906/7, 368 Taf. 12 zeigen, die runde.
Demgegenüber hat man sich die von Pausanias III 24, 3
VIII 4, 9 und X 14, 2 erwähnten Larnakes alle einigermaßen
gleich vorzustellen, nämlich als schwimmfeste, also hölzerne
große Truhen. Die ein Götterbild bergende Eurypyloslarnax
(VII 19, 6 ff. und IX 41, 2) mag man sich allerdings nicht ganz
so groß denken, da sie ein Mann tragen konnte. Mit diesen
Larnakes verbindet die unsere außer der Formbezeichnung das
Material und die nicht zu gering zu veranschlagende Größe,
die die Ausdehnung des Bilderschmuckes und die Möglichkeit,
in dem Gerät ein Kind zu verbergen, erfordert.
‘Kypsele’ und Rundform.
Pausanias setzt das Kunstwerk mit der eponymen xwpeXrj
gleich, in der nach Herodot V 92 'der kleine Kypselos versteckt
wurde. Stimmte das, so wäre allerdings eine runde Form
gesichert, wie sie u. A. einst Studniczka in Erwägung zog
(Arch. Jahrb. IX 1894, 53 A. 16). Denn solche Kypselen sind
nach dem Zeugnis der Münzen mit dem redenden Wappen
der thrakischen Stadt Kypsela (Brit. Mus. Catal. Thracia S. 202f.;
E(f. ccqx. 1890 Taf. 8 Nr. 2 —16) tönerne oder metallene,
schwerlich hölzerne Töpfe, z. T. mit Fuß, becher- oder krater-
ähnlich mit zwei Henkeln. Nach den Grammatikern dienten
sie als Getreidebehälter, ln solchem Gefäß mochte man
freilich ein Kind nicht vermuten (vgl. Herodot: xaraxQvjtrei eg
to äcf QaöTÖTavov ot etpaivevo etvcu), wie ja auch Pausanias X 33, 9
von solchem Kinderversteck — dort unbestimmt cv/yelov ge-
nannt — erzählt, während eine Truhe doch immer Verdacht
erregen mußte. Aber die ganze Gleichsetzung beruht gewiß auf
Willkür des Pausanias oder seines Beraters; er fühlte wohl selbst
die Unmöglichkeit Xagva^ und xvxpeXrj zu verwechseln, weswegen
WILHELM VON MASSOW
auf den Knieen der Kleoboia in Polygnots Nekyia (X 28,3)
war sicher klein und höchst wahrscheinlich zylindrisch, da sie
‘von der Art ist, wie man sie für Demeter anfertigt’, eine
Bemerkung, die vielleicht durch eine kurz zuvor (27,4) erwähnte
gewöhnliche, d. h. eckige Kibotos veranlaßt wurde. Die
charakteristische Form der kleinen Büchsen für Demeter war
aber, wie auch die Reste der Damophongruppe in Lykosura
nach B. S. A. XIII 1906/7, 368 Taf. 12 zeigen, die runde.
Demgegenüber hat man sich die von Pausanias III 24, 3
VIII 4, 9 und X 14, 2 erwähnten Larnakes alle einigermaßen
gleich vorzustellen, nämlich als schwimmfeste, also hölzerne
große Truhen. Die ein Götterbild bergende Eurypyloslarnax
(VII 19, 6 ff. und IX 41, 2) mag man sich allerdings nicht ganz
so groß denken, da sie ein Mann tragen konnte. Mit diesen
Larnakes verbindet die unsere außer der Formbezeichnung das
Material und die nicht zu gering zu veranschlagende Größe,
die die Ausdehnung des Bilderschmuckes und die Möglichkeit,
in dem Gerät ein Kind zu verbergen, erfordert.
‘Kypsele’ und Rundform.
Pausanias setzt das Kunstwerk mit der eponymen xwpeXrj
gleich, in der nach Herodot V 92 'der kleine Kypselos versteckt
wurde. Stimmte das, so wäre allerdings eine runde Form
gesichert, wie sie u. A. einst Studniczka in Erwägung zog
(Arch. Jahrb. IX 1894, 53 A. 16). Denn solche Kypselen sind
nach dem Zeugnis der Münzen mit dem redenden Wappen
der thrakischen Stadt Kypsela (Brit. Mus. Catal. Thracia S. 202f.;
E(f. ccqx. 1890 Taf. 8 Nr. 2 —16) tönerne oder metallene,
schwerlich hölzerne Töpfe, z. T. mit Fuß, becher- oder krater-
ähnlich mit zwei Henkeln. Nach den Grammatikern dienten
sie als Getreidebehälter, ln solchem Gefäß mochte man
freilich ein Kind nicht vermuten (vgl. Herodot: xaraxQvjtrei eg
to äcf QaöTÖTavov ot etpaivevo etvcu), wie ja auch Pausanias X 33, 9
von solchem Kinderversteck — dort unbestimmt cv/yelov ge-
nannt — erzählt, während eine Truhe doch immer Verdacht
erregen mußte. Aber die ganze Gleichsetzung beruht gewiß auf
Willkür des Pausanias oder seines Beraters; er fühlte wohl selbst
die Unmöglichkeit Xagva^ und xvxpeXrj zu verwechseln, weswegen