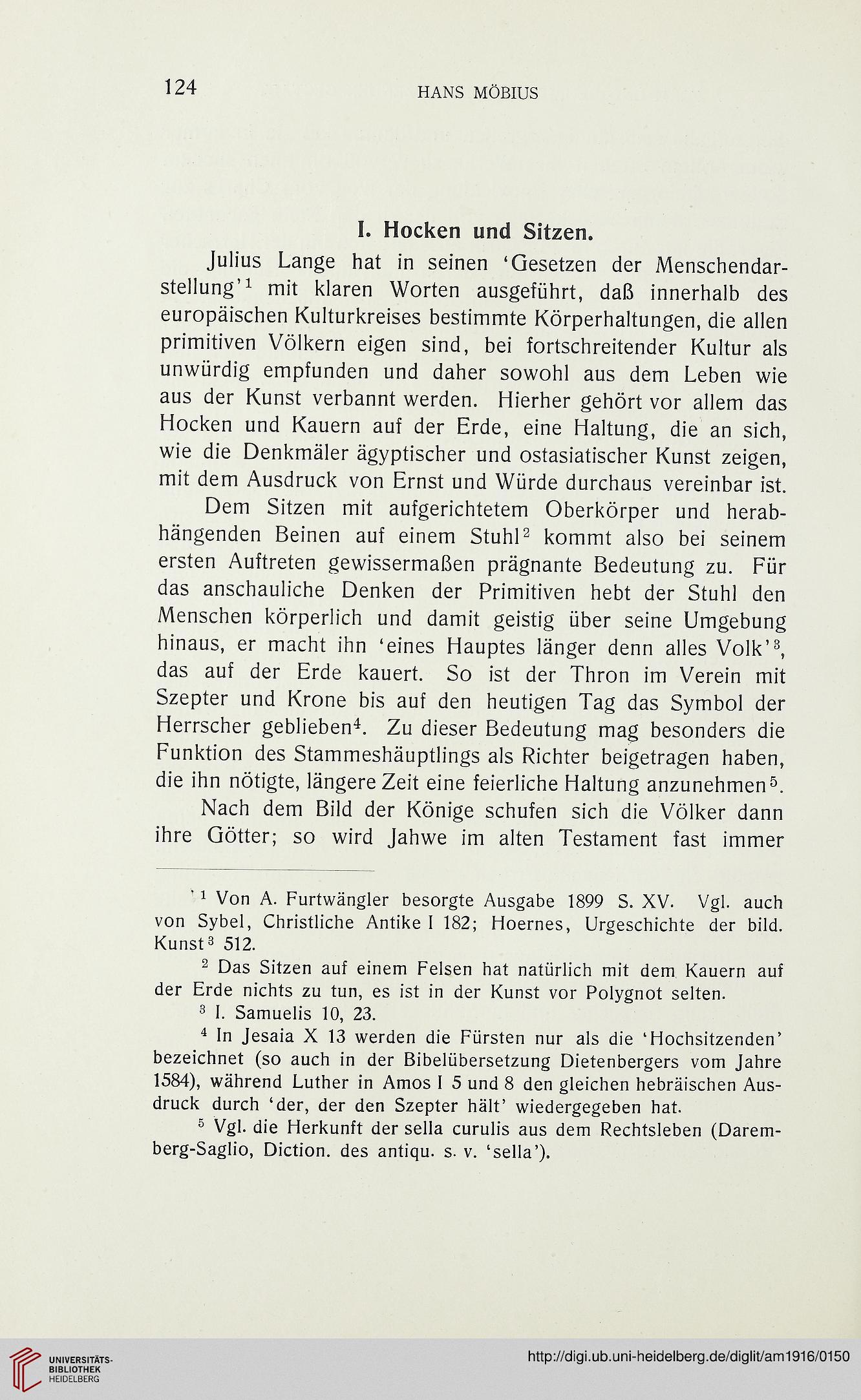124
HANS MÖBIUS
I. Hocken und Sitzen.
Julius Lange hat in seinen ‘Gesetzen der Menschendar-
stellung’1 mit klaren Worten ausgeführt, daß innerhalb des
europäischen Kulturkreises bestimmte Körperhaltungen, die allen
primitiven Völkern eigen sind, bei fortschreitender Kultur als
unwürdig empfunden und daher sowohl aus dem Leben wie
aus der Kunst verbannt werden. Hierher gehört vor allem das
Hocken und Kauern auf der Erde, eine Haltung, die an sich,
wie die Denkmäler ägyptischer und ostasiatischer Kunst zeigen,
mit dem Ausdruck von Ernst und Würde durchaus vereinbar ist.
Dem Sitzen mit aufgerichtetem Oberkörper und herab-
hängenden Beinen auf einem Stuhl2 kommt also bei seinem
ersten Auftreten gewissermaßen prägnante Bedeutung zu. Für
das anschauliche Denken der Primitiven hebt der Stuhl den
Menschen körperlich und damit geistig über seine Umgebung
hinaus, er macht ihn ‘eines Hauptes länger denn alles Volk’3,
das auf der Erde kauert. So ist der Thron im Verein mit
Szepter und Krone bis auf den heutigen Tag das Symbol der
Herrscher geblieben4. Zu dieser Bedeutung mag besonders die
Funktion des Stammeshäuptlings als Richter beigetragen haben,
die ihn nötigte, längere Zeit eine feierliche Haltung anzunehmen5.
Nach dem Bild der Könige schufen sich die Völker dann
ihre Götter; so wird Jahwe im alten Testament fast immer
'1 Von A. Furtwängler besorgte Ausgabe 1899 S. XV. Vgl. auch
von Sybel, Christliche Antike I 182; Hoernes, Urgeschichte der bild.
Kunst3 512.
2 Das Sitzen auf einem Felsen hat natürlich mit dem Kauern auf
der Erde nichts zu tun, es ist in der Kunst vor Polygnot selten.
3 1. Samuelis 10, 23.
4 ln Jesaia X 13 werden die Fürsten nur als die ‘Hochsitzenden’
bezeichnet (so auch in der Bibelübersetzung Dietenbergers vom Jahre
1584), während Luther in Arnos I 5 und 8 den gleichen hebräischen Aus-
druck durch ‘der, der den Szepter hält’ wiedergegeben hat.
5 Vgl. die Herkunft der sella curulis aus dem Rechtsleben (Darem-
berg-Saglio, Diction. des antiqu. s. v. ‘sella’).
HANS MÖBIUS
I. Hocken und Sitzen.
Julius Lange hat in seinen ‘Gesetzen der Menschendar-
stellung’1 mit klaren Worten ausgeführt, daß innerhalb des
europäischen Kulturkreises bestimmte Körperhaltungen, die allen
primitiven Völkern eigen sind, bei fortschreitender Kultur als
unwürdig empfunden und daher sowohl aus dem Leben wie
aus der Kunst verbannt werden. Hierher gehört vor allem das
Hocken und Kauern auf der Erde, eine Haltung, die an sich,
wie die Denkmäler ägyptischer und ostasiatischer Kunst zeigen,
mit dem Ausdruck von Ernst und Würde durchaus vereinbar ist.
Dem Sitzen mit aufgerichtetem Oberkörper und herab-
hängenden Beinen auf einem Stuhl2 kommt also bei seinem
ersten Auftreten gewissermaßen prägnante Bedeutung zu. Für
das anschauliche Denken der Primitiven hebt der Stuhl den
Menschen körperlich und damit geistig über seine Umgebung
hinaus, er macht ihn ‘eines Hauptes länger denn alles Volk’3,
das auf der Erde kauert. So ist der Thron im Verein mit
Szepter und Krone bis auf den heutigen Tag das Symbol der
Herrscher geblieben4. Zu dieser Bedeutung mag besonders die
Funktion des Stammeshäuptlings als Richter beigetragen haben,
die ihn nötigte, längere Zeit eine feierliche Haltung anzunehmen5.
Nach dem Bild der Könige schufen sich die Völker dann
ihre Götter; so wird Jahwe im alten Testament fast immer
'1 Von A. Furtwängler besorgte Ausgabe 1899 S. XV. Vgl. auch
von Sybel, Christliche Antike I 182; Hoernes, Urgeschichte der bild.
Kunst3 512.
2 Das Sitzen auf einem Felsen hat natürlich mit dem Kauern auf
der Erde nichts zu tun, es ist in der Kunst vor Polygnot selten.
3 1. Samuelis 10, 23.
4 ln Jesaia X 13 werden die Fürsten nur als die ‘Hochsitzenden’
bezeichnet (so auch in der Bibelübersetzung Dietenbergers vom Jahre
1584), während Luther in Arnos I 5 und 8 den gleichen hebräischen Aus-
druck durch ‘der, der den Szepter hält’ wiedergegeben hat.
5 Vgl. die Herkunft der sella curulis aus dem Rechtsleben (Darem-
berg-Saglio, Diction. des antiqu. s. v. ‘sella’).