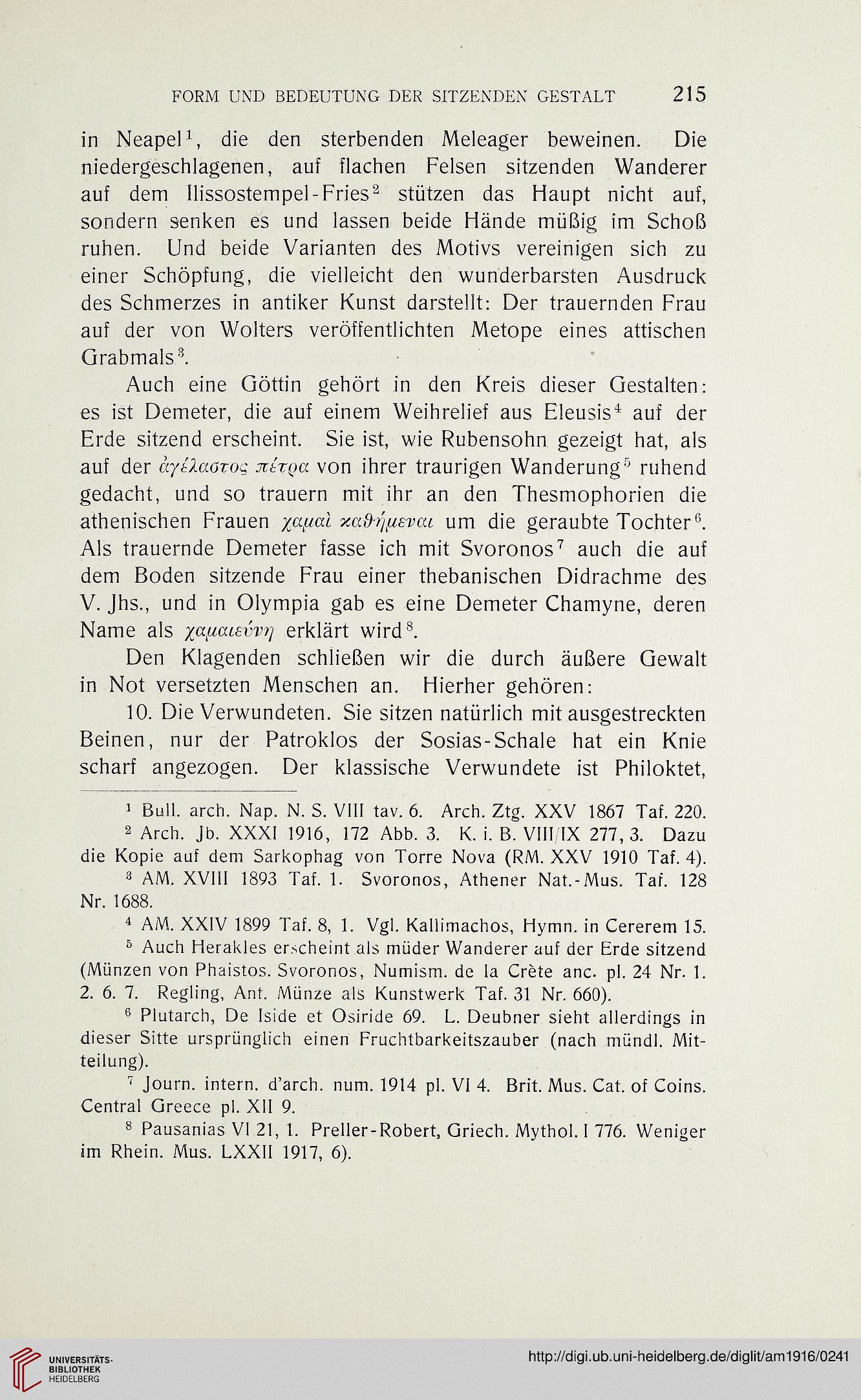FORM UND BEDEUTUNG DER SITZENDEN GESTALT
215
in Neapel1, die den sterbenden Meleager beweinen. Die
niedergeschlagenen, auf flachen Felsen sitzenden Wanderer
auf dem Ilissostempel-Fries2 stützen das Haupt nicht auf,
sondern senken es und lassen beide Hände müßig im Schoß
ruhen. Und beide Varianten des Motivs vereinigen sich zu
einer Schöpfung, die vielleicht den wunderbarsten Ausdruck
des Schmerzes in antiker Kunst darstellt: Der trauernden Frau
auf der von Wolters veröffentlichten Metope eines attischen
Grabmals3.
Auch eine Göttin gehört in den Kreis dieser Gestalten:
es ist Demeter, die auf einem Weihrelief aus Eleusis4 auf der
Erde sitzend erscheint. Sie ist, wie Rubensohn gezeigt hat, als
auf der aytlaorog jitzga von ihrer traurigen Wanderung5 ruhend
gedacht, und so trauern mit ihr an den Thesmophorien die
athenischen Frauen yaiiai xafrrjfievcu um die geraubte Tochter6.
Als trauernde Demeter fasse ich mit Svoronos7 auch die auf
dem Boden sitzende Frau einer thebanischen Didrachme des
V. Jhs., und in Olympia gab es eine Demeter Chamyne, deren
Name als yafiaisvvrj erklärt wird8.
Den Klagenden schließen wir die durch äußere Gewalt
in Not versetzten Menschen an. Hierher gehören:
10. Die Verwundeten. Sie sitzen natürlich mit ausgestreckten
Beinen, nur der Patroklos der Sosias-Schale hat ein Knie
scharf angezogen. Der klassische Verwundete ist Philoktet,
1 Bull. arch. Nap. N. S. VIII tav. 6. Arch. Ztg. XXV 1867 Taf. 220.
2 Arch. Jb. XXXI 1916, 172 Abb. 3. K. i. B. VIII IX 277, 3. Dazu
die Kopie auf dem Sarkophag von Torre Nova (RM. XXV 1910 Taf. 4).
3 AM. XVIII 1893 Taf. 1. Svoronos, Athener Nat.-Mus. Taf. 128
Nr. 1688.
4 AM. XXIV 1899 Taf. 8, 1. Vgl. Kallimachos, Hymn. in Cererem 15.
5 Auch Herakles erscheint als müder Wanderer auf der Erde sitzend
(Münzen von Phaistos. Svoronos, Numism. de la Crete anc. pl. 24 Nr. 1.
2. 6. 7. Regling, Ant. Münze als Kunstwerk Taf. 31 Nr. 660).
6 Plutarch, De Iside et Osiride 69. L. Deubner sieht allerdings in
dieser Sitte ursprünglich einen Fruchtbarkeitszauber (nach mündl. Mit-
teilung).
7 Journ. intern, d’arch. num. 1914 pl. VI 4. Brit. Mus. Cat. of Coins.
Central Greece pl. XII 9.
8 Pausanias VI 21, 1. Preller-Robert, Griech. Mythol. I 776. Weniger
im Rhein. Mus. LXXII 1917, 6).
215
in Neapel1, die den sterbenden Meleager beweinen. Die
niedergeschlagenen, auf flachen Felsen sitzenden Wanderer
auf dem Ilissostempel-Fries2 stützen das Haupt nicht auf,
sondern senken es und lassen beide Hände müßig im Schoß
ruhen. Und beide Varianten des Motivs vereinigen sich zu
einer Schöpfung, die vielleicht den wunderbarsten Ausdruck
des Schmerzes in antiker Kunst darstellt: Der trauernden Frau
auf der von Wolters veröffentlichten Metope eines attischen
Grabmals3.
Auch eine Göttin gehört in den Kreis dieser Gestalten:
es ist Demeter, die auf einem Weihrelief aus Eleusis4 auf der
Erde sitzend erscheint. Sie ist, wie Rubensohn gezeigt hat, als
auf der aytlaorog jitzga von ihrer traurigen Wanderung5 ruhend
gedacht, und so trauern mit ihr an den Thesmophorien die
athenischen Frauen yaiiai xafrrjfievcu um die geraubte Tochter6.
Als trauernde Demeter fasse ich mit Svoronos7 auch die auf
dem Boden sitzende Frau einer thebanischen Didrachme des
V. Jhs., und in Olympia gab es eine Demeter Chamyne, deren
Name als yafiaisvvrj erklärt wird8.
Den Klagenden schließen wir die durch äußere Gewalt
in Not versetzten Menschen an. Hierher gehören:
10. Die Verwundeten. Sie sitzen natürlich mit ausgestreckten
Beinen, nur der Patroklos der Sosias-Schale hat ein Knie
scharf angezogen. Der klassische Verwundete ist Philoktet,
1 Bull. arch. Nap. N. S. VIII tav. 6. Arch. Ztg. XXV 1867 Taf. 220.
2 Arch. Jb. XXXI 1916, 172 Abb. 3. K. i. B. VIII IX 277, 3. Dazu
die Kopie auf dem Sarkophag von Torre Nova (RM. XXV 1910 Taf. 4).
3 AM. XVIII 1893 Taf. 1. Svoronos, Athener Nat.-Mus. Taf. 128
Nr. 1688.
4 AM. XXIV 1899 Taf. 8, 1. Vgl. Kallimachos, Hymn. in Cererem 15.
5 Auch Herakles erscheint als müder Wanderer auf der Erde sitzend
(Münzen von Phaistos. Svoronos, Numism. de la Crete anc. pl. 24 Nr. 1.
2. 6. 7. Regling, Ant. Münze als Kunstwerk Taf. 31 Nr. 660).
6 Plutarch, De Iside et Osiride 69. L. Deubner sieht allerdings in
dieser Sitte ursprünglich einen Fruchtbarkeitszauber (nach mündl. Mit-
teilung).
7 Journ. intern, d’arch. num. 1914 pl. VI 4. Brit. Mus. Cat. of Coins.
Central Greece pl. XII 9.
8 Pausanias VI 21, 1. Preller-Robert, Griech. Mythol. I 776. Weniger
im Rhein. Mus. LXXII 1917, 6).