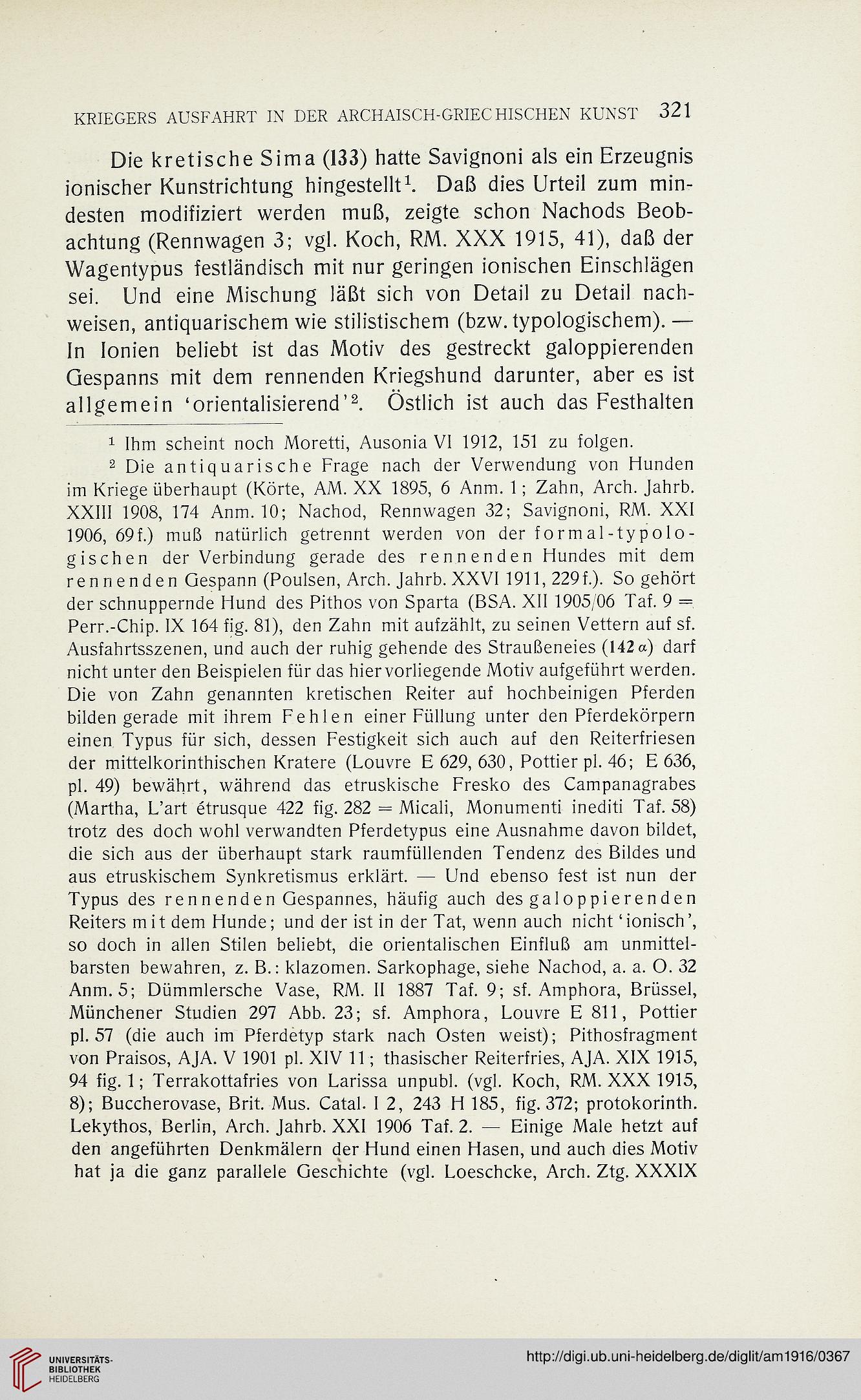KRIEGERS AUSFAHRT IN DER ARCHAISCH-GRIECHISCHEN KUNST 321
Die kretische Sima (133) hatte Savignoni als ein Erzeugnis
ionischer Kunstrichtung hingestellt1. Daß dies Urteil zum min-
desten modifiziert werden muß, zeigte schon Nachods Beob-
achtung (Rennwagen 3; vgl. Koch, RM. XXX 1915, 41), daß der
Wagentypus festländisch mit nur geringen ionischen Einschlägen
sei. Und eine Mischung läßt sich von Detail zu Detail nach-
weisen, antiquarischem wie stilistischem (bzw. typologischem). —
In lonien beliebt ist das Motiv des gestreckt galoppierenden
Gespanns mit dem rennenden Kriegshund darunter, aber es ist
allgemein ‘orientalisierend’2. Östlich ist auch das Festhalten
1 Ihm scheint noch Moretti, Ausonia VI 1912, 151 zu folgen.
2 Die antiquarische Frage nach der Verwendung von Hunden
im Kriege überhaupt (Körte, AM. XX 1895, 6 Anm. 1; Zahn, Arch. Jahrb.
XXI11 1908, 174 Anm. 10; Nachod, Rennwagen 32; Savignoni, RM. XXI
1906, 69f.) muß natürlich getrennt werden von der formal-typolo-
gischen der Verbindung gerade des rennenden Hundes mit dem
rennenden Gespann (Poulsen, Arch. Jahrb. XXVI 1911, 229 f.). So gehört
der schnuppernde Hund des Pithos von Sparta (BSA. XII 1905/06 Taf. 9 -
Perr.-Chip. IX 164 fig. 81), den Zahn mit aufzählt, zu seinen Vettern auf sf.
Ausfahrtsszenen, und auch der ruhig gehende des Straußeneies (142 a) darf
nicht unter den Beispielen für das hier vorliegende Motiv aufgeführt werden.
Die von Zahn genannten kretischen Reiter auf hochbeinigen Pferden
bilden gerade mit ihrem Fehlen einer Füllung unter den Pferdekörpern
einen Typus für sich, dessen Festigkeit sich auch auf den Reiterfriesen
der mittelkorinthischen Kratere (Louvre E 629, 630, Pottier pl. 46; E 636,
pl. 49) bewährt, während das etruskische Fresko des Campanagrabes
(Martha, L’art etrusque 422 fig. 282 = Micali, Monumenti inediti Taf. 58)
trotz des doch wohl verwandten Pferdetypus eine Ausnahme davon bildet,
die sich aus der überhaupt stark raumfüllenden Tendenz des Bildes und
aus etruskischem Synkretismus erklärt. — Und ebenso fest ist nun der
Typus des rennenden Gespannes, häufig auch des galoppierenden
Reiters m it dem Hunde; und der ist in der Tat, wenn auch nicht‘ionisch’,
so doch in allen Stilen beliebt, die orientalischen Einfluß am unmittel-
barsten bewahren, z. B.: klazomen. Sarkophage, siehe Nachod, a. a. O. 32
Anm. 5; Dümmlersche Vase, RM. II 1887 Taf. 9; sf. Amphora, Brüssel,
Münchener Studien 297 Abb. 23; sf. Amphora, Louvre E 811, Pottier
pl. 57 (die auch im Pferdetyp stark nach Osten weist); Pithosfragment
von Praisos, AJA. V 1901 pl. XIV 11; thasischer Reiterfries, AJA. XIX 1915,
94 fig. 1; Terrakottafries von Larissa unpubl. (vgl. Koch, RM. XXX 1915,
8); Buccherovase, Brit. Mus. Catal. 1 2, 243 H 185, fig. 372; protokorinth.
Lekythos, Berlin, Arch. Jahrb. XXI 1906 Taf. 2. — Einige Male hetzt auf
den angeführten Denkmälern der Hund einen Hasen, und auch dies Motiv
hat ja die ganz parallele Geschichte (vgl. Loeschcke, Arch. Ztg. XXXIX
Die kretische Sima (133) hatte Savignoni als ein Erzeugnis
ionischer Kunstrichtung hingestellt1. Daß dies Urteil zum min-
desten modifiziert werden muß, zeigte schon Nachods Beob-
achtung (Rennwagen 3; vgl. Koch, RM. XXX 1915, 41), daß der
Wagentypus festländisch mit nur geringen ionischen Einschlägen
sei. Und eine Mischung läßt sich von Detail zu Detail nach-
weisen, antiquarischem wie stilistischem (bzw. typologischem). —
In lonien beliebt ist das Motiv des gestreckt galoppierenden
Gespanns mit dem rennenden Kriegshund darunter, aber es ist
allgemein ‘orientalisierend’2. Östlich ist auch das Festhalten
1 Ihm scheint noch Moretti, Ausonia VI 1912, 151 zu folgen.
2 Die antiquarische Frage nach der Verwendung von Hunden
im Kriege überhaupt (Körte, AM. XX 1895, 6 Anm. 1; Zahn, Arch. Jahrb.
XXI11 1908, 174 Anm. 10; Nachod, Rennwagen 32; Savignoni, RM. XXI
1906, 69f.) muß natürlich getrennt werden von der formal-typolo-
gischen der Verbindung gerade des rennenden Hundes mit dem
rennenden Gespann (Poulsen, Arch. Jahrb. XXVI 1911, 229 f.). So gehört
der schnuppernde Hund des Pithos von Sparta (BSA. XII 1905/06 Taf. 9 -
Perr.-Chip. IX 164 fig. 81), den Zahn mit aufzählt, zu seinen Vettern auf sf.
Ausfahrtsszenen, und auch der ruhig gehende des Straußeneies (142 a) darf
nicht unter den Beispielen für das hier vorliegende Motiv aufgeführt werden.
Die von Zahn genannten kretischen Reiter auf hochbeinigen Pferden
bilden gerade mit ihrem Fehlen einer Füllung unter den Pferdekörpern
einen Typus für sich, dessen Festigkeit sich auch auf den Reiterfriesen
der mittelkorinthischen Kratere (Louvre E 629, 630, Pottier pl. 46; E 636,
pl. 49) bewährt, während das etruskische Fresko des Campanagrabes
(Martha, L’art etrusque 422 fig. 282 = Micali, Monumenti inediti Taf. 58)
trotz des doch wohl verwandten Pferdetypus eine Ausnahme davon bildet,
die sich aus der überhaupt stark raumfüllenden Tendenz des Bildes und
aus etruskischem Synkretismus erklärt. — Und ebenso fest ist nun der
Typus des rennenden Gespannes, häufig auch des galoppierenden
Reiters m it dem Hunde; und der ist in der Tat, wenn auch nicht‘ionisch’,
so doch in allen Stilen beliebt, die orientalischen Einfluß am unmittel-
barsten bewahren, z. B.: klazomen. Sarkophage, siehe Nachod, a. a. O. 32
Anm. 5; Dümmlersche Vase, RM. II 1887 Taf. 9; sf. Amphora, Brüssel,
Münchener Studien 297 Abb. 23; sf. Amphora, Louvre E 811, Pottier
pl. 57 (die auch im Pferdetyp stark nach Osten weist); Pithosfragment
von Praisos, AJA. V 1901 pl. XIV 11; thasischer Reiterfries, AJA. XIX 1915,
94 fig. 1; Terrakottafries von Larissa unpubl. (vgl. Koch, RM. XXX 1915,
8); Buccherovase, Brit. Mus. Catal. 1 2, 243 H 185, fig. 372; protokorinth.
Lekythos, Berlin, Arch. Jahrb. XXI 1906 Taf. 2. — Einige Male hetzt auf
den angeführten Denkmälern der Hund einen Hasen, und auch dies Motiv
hat ja die ganz parallele Geschichte (vgl. Loeschcke, Arch. Ztg. XXXIX