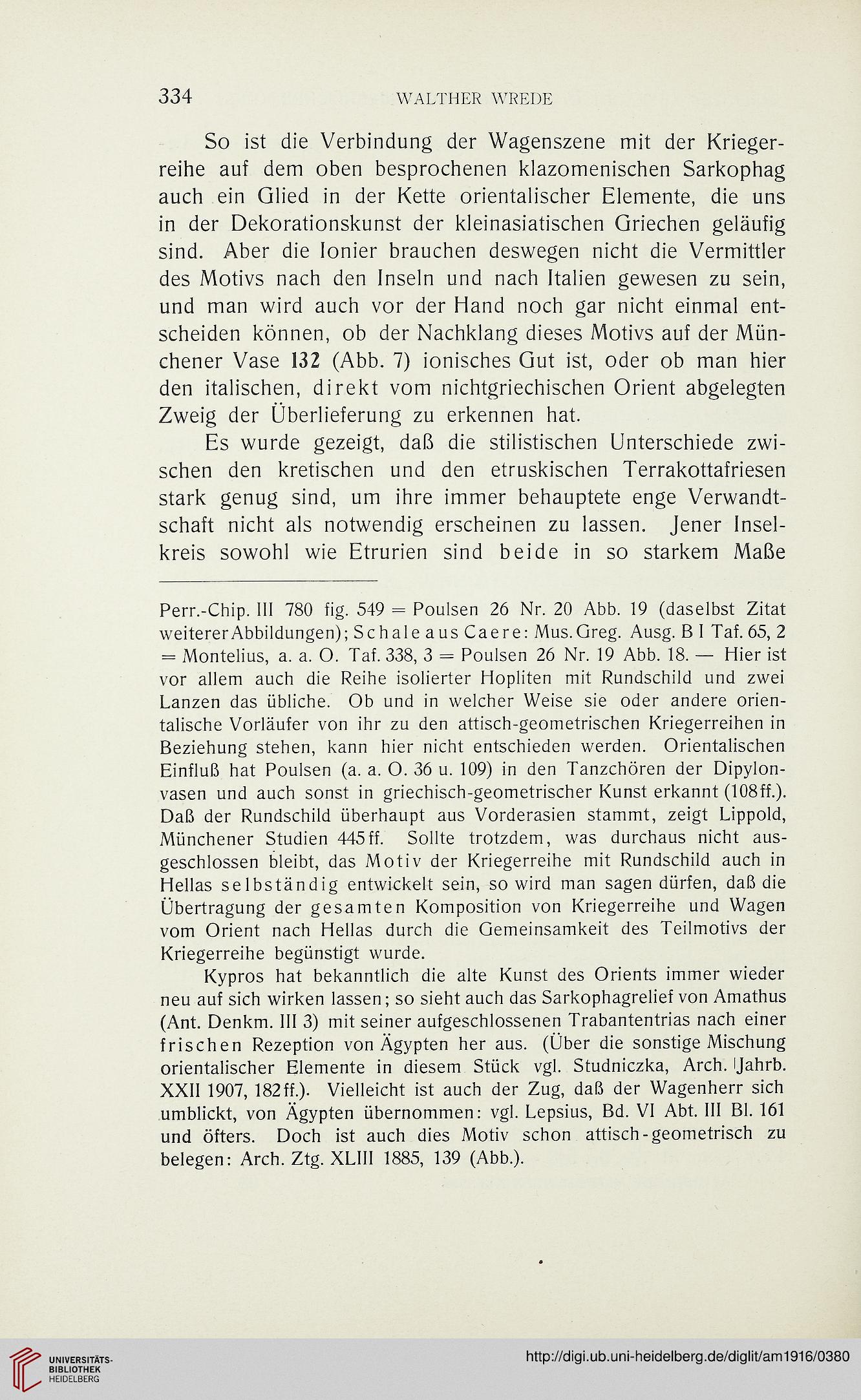334
WALTHER WREDE
So ist die Verbindung der Wagenszene mit der Krieger-
reihe auf dem oben besprochenen klazomenischen Sarkophag
auch ein Glied in der Kette orientalischer Elemente, die uns
in der Dekorationskunst der kleinasiatischen Griechen geläufig
sind. Aber die Ionier brauchen deswegen nicht die Vermittler
des Motivs nach den Inseln und nach Italien gewesen zu sein,
und man wird auch vor der Hand noch gar nicht einmal ent-
scheiden können, ob der Nachklang dieses Motivs auf der Mün-
chener Vase 132 (Abb. 7) ionisches Gut ist, oder ob man hier
den italischen, direkt vom nichtgriechischen Orient abgelegten
Zweig der Überlieferung zu erkennen hat.
Es wurde gezeigt, daß die stilistischen Unterschiede zwi-
schen den kretischen und den etruskischen Terrakottafriesen
stark genug sind, um ihre immer behauptete enge Verwandt-
schaft nicht als notwendig erscheinen zu lassen. Jener Insel-
kreis sowohl wie Etrurien sind beide in so starkem Maße
Perr.-Chip. III 780 fig. 549 = Poulsen 26 Nr. 20 Abb. 19 (daselbst Zitat
weiterer Abbildungen); Schale aus Caere: Mus.Greg. Ausg. B I Taf. 65, 2
= Montelius, a. a. O. Taf. 338, 3 = Poulsen 26 Nr. 19 Abb. 18. — Hier ist
vor allem auch die Reihe isolierter Hopliten mit Rundschild und zwei
Lanzen das übliche. Ob und in welcher Weise sie oder andere orien-
talische Vorläufer von ihr zu den attisch-geometrischen Kriegerreihen in
Beziehung stehen, kann hier nicht entschieden werden. Orientalischen
Einfluß hat Poulsen (a. a. O. 36 u. 109) in den Tanzchören der Dipylon-
vasen und auch sonst in griechisch-geometrischer Kunst erkannt (108ff.).
Daß der Rundschild überhaupt aus Vorderasien stammt, zeigt Lippold,
Münchener Studien 445ff. Sollte trotzdem, was durchaus nicht aus-
geschlossen bleibt, das Motiv der Kriegerreihe mit Rundschild auch in
Hellas selbständig entwickelt sein, so wird man sagen dürfen, daß die
Übertragung der gesamten Komposition von Kriegerreihe und Wagen
vom Orient nach Hellas durch die Gemeinsamkeit des Teilmotivs der
Kriegerreihe begünstigt wurde.
Kypros hat bekanntlich die alte Kunst des Orients immer wieder
neu auf sich wirken lassen; so sieht auch das Sarkophagrelief von Amathus
(Ant. Denkm. III 3) mit seiner aufgeschlossenen Trabantentrias nach einer
frischen Rezeption von Ägypten her aus. (Über die sonstige Mischung
orientalischer Elemente in diesem Stück vgl. Studniczka, Arch. ijahrb.
XXII 1907, 182ff.)- Vielleicht ist auch der Zug, daß der Wagenherr sich
umblickt, von Ägypten übernommen: vgl. Lepsius, Bd. VI Abt. 111 Bl. 161
und öfters. Doch ist auch dies Motiv schon attisch-geometrisch zu
belegen: Arch. Ztg. XLII1 1885, 139 (Abb.).
WALTHER WREDE
So ist die Verbindung der Wagenszene mit der Krieger-
reihe auf dem oben besprochenen klazomenischen Sarkophag
auch ein Glied in der Kette orientalischer Elemente, die uns
in der Dekorationskunst der kleinasiatischen Griechen geläufig
sind. Aber die Ionier brauchen deswegen nicht die Vermittler
des Motivs nach den Inseln und nach Italien gewesen zu sein,
und man wird auch vor der Hand noch gar nicht einmal ent-
scheiden können, ob der Nachklang dieses Motivs auf der Mün-
chener Vase 132 (Abb. 7) ionisches Gut ist, oder ob man hier
den italischen, direkt vom nichtgriechischen Orient abgelegten
Zweig der Überlieferung zu erkennen hat.
Es wurde gezeigt, daß die stilistischen Unterschiede zwi-
schen den kretischen und den etruskischen Terrakottafriesen
stark genug sind, um ihre immer behauptete enge Verwandt-
schaft nicht als notwendig erscheinen zu lassen. Jener Insel-
kreis sowohl wie Etrurien sind beide in so starkem Maße
Perr.-Chip. III 780 fig. 549 = Poulsen 26 Nr. 20 Abb. 19 (daselbst Zitat
weiterer Abbildungen); Schale aus Caere: Mus.Greg. Ausg. B I Taf. 65, 2
= Montelius, a. a. O. Taf. 338, 3 = Poulsen 26 Nr. 19 Abb. 18. — Hier ist
vor allem auch die Reihe isolierter Hopliten mit Rundschild und zwei
Lanzen das übliche. Ob und in welcher Weise sie oder andere orien-
talische Vorläufer von ihr zu den attisch-geometrischen Kriegerreihen in
Beziehung stehen, kann hier nicht entschieden werden. Orientalischen
Einfluß hat Poulsen (a. a. O. 36 u. 109) in den Tanzchören der Dipylon-
vasen und auch sonst in griechisch-geometrischer Kunst erkannt (108ff.).
Daß der Rundschild überhaupt aus Vorderasien stammt, zeigt Lippold,
Münchener Studien 445ff. Sollte trotzdem, was durchaus nicht aus-
geschlossen bleibt, das Motiv der Kriegerreihe mit Rundschild auch in
Hellas selbständig entwickelt sein, so wird man sagen dürfen, daß die
Übertragung der gesamten Komposition von Kriegerreihe und Wagen
vom Orient nach Hellas durch die Gemeinsamkeit des Teilmotivs der
Kriegerreihe begünstigt wurde.
Kypros hat bekanntlich die alte Kunst des Orients immer wieder
neu auf sich wirken lassen; so sieht auch das Sarkophagrelief von Amathus
(Ant. Denkm. III 3) mit seiner aufgeschlossenen Trabantentrias nach einer
frischen Rezeption von Ägypten her aus. (Über die sonstige Mischung
orientalischer Elemente in diesem Stück vgl. Studniczka, Arch. ijahrb.
XXII 1907, 182ff.)- Vielleicht ist auch der Zug, daß der Wagenherr sich
umblickt, von Ägypten übernommen: vgl. Lepsius, Bd. VI Abt. 111 Bl. 161
und öfters. Doch ist auch dies Motiv schon attisch-geometrisch zu
belegen: Arch. Ztg. XLII1 1885, 139 (Abb.).