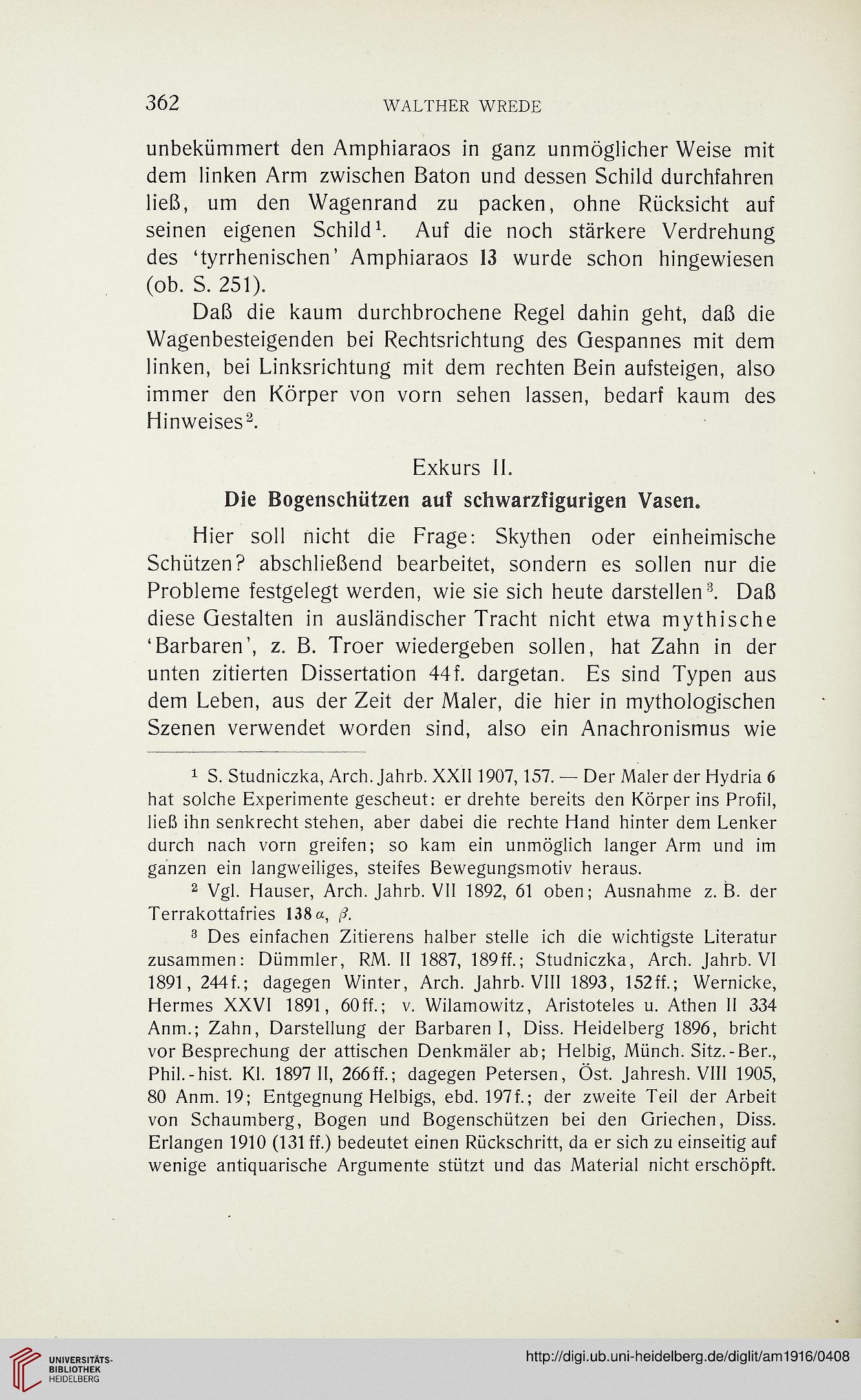362
WALTHER WREDE
unbekümmert den Amphiaraos in ganz unmöglicher Weise mit
dem linken Arm zwischen Baton und dessen Schild durchfahren
ließ, um den Wagenrand zu packen, ohne Rücksicht auf
seinen eigenen Schild1. Auf die noch stärkere Verdrehung
des ‘tyrrhenischen’ Amphiaraos 13 wurde schon hingewiesen
(ob. S. 251).
Daß die kaum durchbrochene Regel dahin geht, daß die
Wagenbesteigenden bei Rechtsrichtung des Gespannes mit dem
linken, bei Linksrichtung mit dem rechten Bein aufsteigen, also
immer den Körper von vorn sehen lassen, bedarf kaum des
Hinweises2.
Exkurs 11.
Die Bogenschützen auf schwarzfigurigen Vasen.
Hier soll nicht die Frage: Skythen oder einheimische
Schützen? abschließend bearbeitet, sondern es sollen nur die
Probleme festgelegt werden, wie sie sich heute darstellen3. Daß
diese Gestalten in ausländischer Tracht nicht etwa mythische
‘Barbaren’, z. B. Troer wiedergeben sollen, hat Zahn in der
unten zitierten Dissertation 44f. dargetan. Es sind Typen aus
dem Leben, aus der Zeit der Maler, die hier in mythologischen
Szenen verwendet worden sind, also ein Anachronismus wie
1 S. Studniczka, Arch. Jahrb. XXII1907,157. — Der Maler der Hydria 6
hat solche Experimente gescheut: er drehte bereits den Körper ins Profil,
ließ ihn senkrecht stehen, aber dabei die rechte Hand hinter dem Lenker
durch nach vorn greifen; so kam ein unmöglich langer Arm und im
ganzen ein langweiliges, steifes Bewegungsmotiv heraus.
2 Vgl. Hauser, Arch. Jahrb. VII 1892, 61 oben; Ausnahme z. B. der
Terrakottafries 138 a, ß.
3 Des einfachen Zitierens halber stelle ich die wichtigste Literatur
zusammen: Dümmler, RM. II 1887, 189ff.; Studniczka, Arch. Jahrb. VI
1891, 244f.; dagegen Winter, Arch. Jahrb. VIII 1893, 152ff.; Wernicke,
Hermes XXVI 1891, 60ff.; v. Wilamowitz, Aristoteles u. Athen II 334
Anm.; Zahn, Darstellung der Barbaren I, Diss. Heidelberg 1896, bricht
vor Besprechung der attischen Denkmäler ab; Helbig, Münch. Sitz.-Ber.,
Phil.-hist. Kl. 1897 II, 266ff.; dagegen Petersen, Öst. Jahresh. VIII 1905,
80 Anm. 19; Entgegnung Helbigs, ebd. 1971; der zweite Teil der Arbeit
von Schaumberg, Bogen und Bogenschützen bei den Griechen, Diss.
Erlangen 1910 (131 ff.) bedeutet einen Rückschritt, da er sich zu einseitig auf
wenige antiquarische Argumente stützt und das Material nicht erschöpft.
WALTHER WREDE
unbekümmert den Amphiaraos in ganz unmöglicher Weise mit
dem linken Arm zwischen Baton und dessen Schild durchfahren
ließ, um den Wagenrand zu packen, ohne Rücksicht auf
seinen eigenen Schild1. Auf die noch stärkere Verdrehung
des ‘tyrrhenischen’ Amphiaraos 13 wurde schon hingewiesen
(ob. S. 251).
Daß die kaum durchbrochene Regel dahin geht, daß die
Wagenbesteigenden bei Rechtsrichtung des Gespannes mit dem
linken, bei Linksrichtung mit dem rechten Bein aufsteigen, also
immer den Körper von vorn sehen lassen, bedarf kaum des
Hinweises2.
Exkurs 11.
Die Bogenschützen auf schwarzfigurigen Vasen.
Hier soll nicht die Frage: Skythen oder einheimische
Schützen? abschließend bearbeitet, sondern es sollen nur die
Probleme festgelegt werden, wie sie sich heute darstellen3. Daß
diese Gestalten in ausländischer Tracht nicht etwa mythische
‘Barbaren’, z. B. Troer wiedergeben sollen, hat Zahn in der
unten zitierten Dissertation 44f. dargetan. Es sind Typen aus
dem Leben, aus der Zeit der Maler, die hier in mythologischen
Szenen verwendet worden sind, also ein Anachronismus wie
1 S. Studniczka, Arch. Jahrb. XXII1907,157. — Der Maler der Hydria 6
hat solche Experimente gescheut: er drehte bereits den Körper ins Profil,
ließ ihn senkrecht stehen, aber dabei die rechte Hand hinter dem Lenker
durch nach vorn greifen; so kam ein unmöglich langer Arm und im
ganzen ein langweiliges, steifes Bewegungsmotiv heraus.
2 Vgl. Hauser, Arch. Jahrb. VII 1892, 61 oben; Ausnahme z. B. der
Terrakottafries 138 a, ß.
3 Des einfachen Zitierens halber stelle ich die wichtigste Literatur
zusammen: Dümmler, RM. II 1887, 189ff.; Studniczka, Arch. Jahrb. VI
1891, 244f.; dagegen Winter, Arch. Jahrb. VIII 1893, 152ff.; Wernicke,
Hermes XXVI 1891, 60ff.; v. Wilamowitz, Aristoteles u. Athen II 334
Anm.; Zahn, Darstellung der Barbaren I, Diss. Heidelberg 1896, bricht
vor Besprechung der attischen Denkmäler ab; Helbig, Münch. Sitz.-Ber.,
Phil.-hist. Kl. 1897 II, 266ff.; dagegen Petersen, Öst. Jahresh. VIII 1905,
80 Anm. 19; Entgegnung Helbigs, ebd. 1971; der zweite Teil der Arbeit
von Schaumberg, Bogen und Bogenschützen bei den Griechen, Diss.
Erlangen 1910 (131 ff.) bedeutet einen Rückschritt, da er sich zu einseitig auf
wenige antiquarische Argumente stützt und das Material nicht erschöpft.