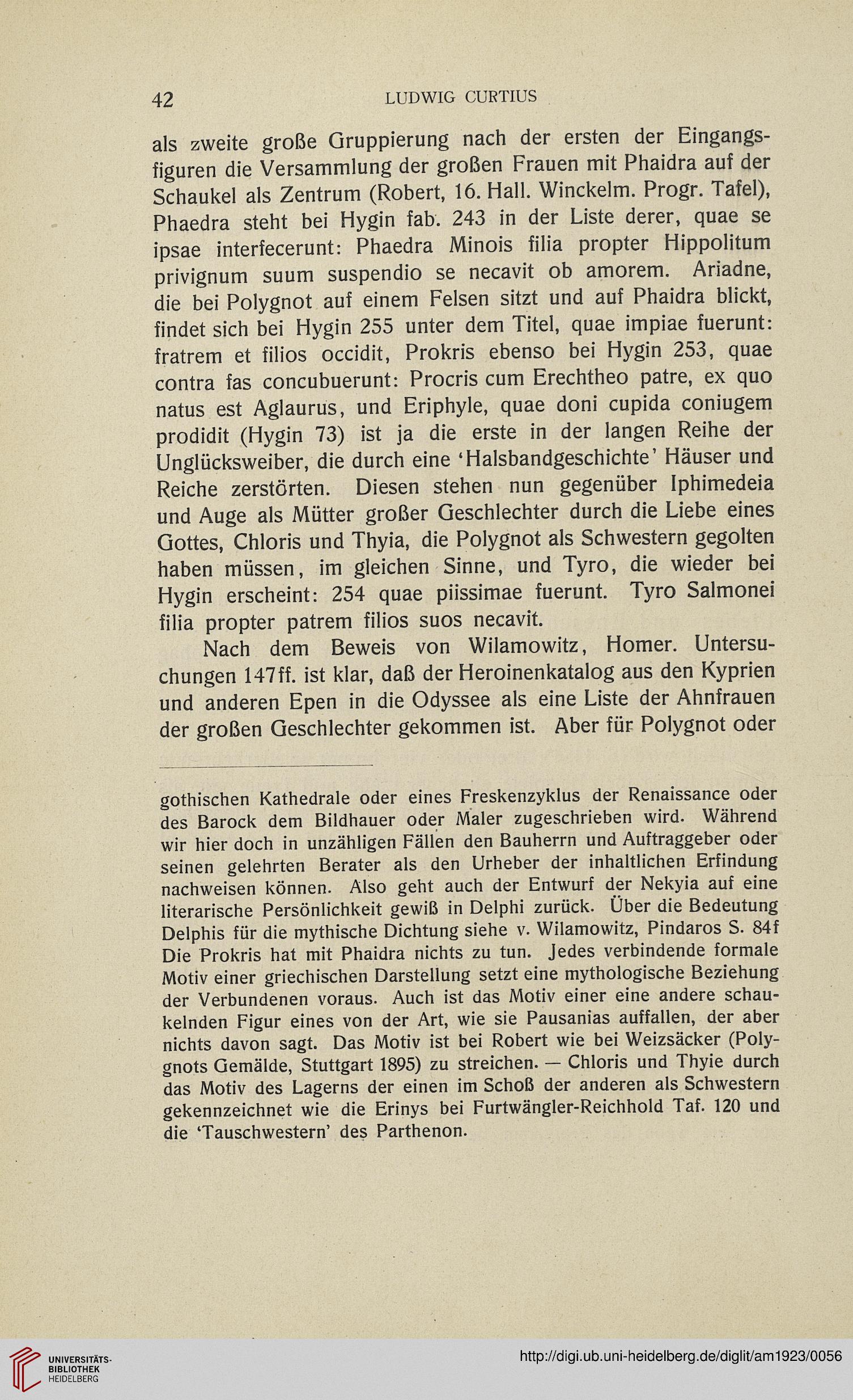42
LUDWIG CURTIUS
als zweite große Gruppierung nach der ersten der Eingangs-
figuren die Versammlung der großen Frauen mit Phaidra auf der
Schaukel als Zentrum (Robert, 16. Hall. Winckelm. Progr. Tafel),
Phaedra steht bei Hygin fab. 243 in der Liste derer, quae se
ipsae interfecerunt: Phaedra Minois filia propter Hippolitum
privignum suum suspendio se necavit ob amorem. Ariadne,
die bei Polygnot auf einem Felsen sitzt und auf Phaidra blickt,
findet sich bei Hygin 255 unter dem Titel, quae impiae fuerunt:
fratrem et filios occidit, Prokris ebenso bei Hygin 253, quae
contra fas concubuerunt: Procris cum Erechtheo patre, ex quo
natus est Aglaurus, und Eriphyle, quae doni cupida coniugem
prodidit (Hygin 73) ist ja die erste in der langen Reihe der
Unglücksweiber, die durch eine ‘Halsbandgeschichte’ Häuser und
Reiche zerstörten. Diesen stehen nun gegenüber Iphimedeia
und Auge als Miitter großer Geschlechter durch die Liebe eines
Gottes, Chloris und Thyia, die Polygnot als Schwestern gegolten
haben miissen, im gleichen Sinne, und Tyro, die wieder bei
Hygin erscheint: 254 quae piissimae fuerunt. Tyro Salmonei
filia propter patrem filios suos necavit.
Nach dem Beweis von Wilamowitz, Homer. Untersu-
chungen 147ff. ist klar, daß der Heroinenkatalog aus den Kyprien
und anderen Epen in die Odyssee als eine Liste der Ahnfrauen
der großen Geschlechter gekommen ist. Aber für Polygnot oder
gothischen Kathedrale oder eines Freskenzyklus der Renaissance oder
des Barock dem Bildhauer oder Maler zugeschrieben wird. Während
wir hier doch in unzähligen Fällen den Bauherrn und Auftraggeber oder
seinen gelehrten Berater als den Urheber der inhaltlichen Erfindung
nachweisen können. Also geht auch der Entwurf der Nekyia auf eine
literarische Persönlichkeit gewiß in Delphi zurück. Über die Bedeutung
Delphis für die mythische Dichtung siehe v. Wilamowitz, Pindaros S. 84f
Die Prokris hat mit Phaidra nichts zu tun. Jedes verbindende formale
Motiv einer griechischen Darstellung setzt eine mythologische Beziehung
der Verbundenen voraus. Auch ist das Motiv einer eine andere schau-
kelnden Figur eines von der Art, wie sie Pausanias auffallen, der aber
nichts davon sagt. Das Motiv ist bei Robert wie bei Weizsäcker (Poly-
gnots Gemälde, Stuttgart 1895) zu streichen. — Chloris und Thyie durch
das Motiv des Lagerns der einen im Schoß der anderen als Schwestern
gekennzeichnet wie die Erinys bei Furtwängler-Reichhold Taf. 120 und
die ‘Tauschwestern’ des Parthenon.
LUDWIG CURTIUS
als zweite große Gruppierung nach der ersten der Eingangs-
figuren die Versammlung der großen Frauen mit Phaidra auf der
Schaukel als Zentrum (Robert, 16. Hall. Winckelm. Progr. Tafel),
Phaedra steht bei Hygin fab. 243 in der Liste derer, quae se
ipsae interfecerunt: Phaedra Minois filia propter Hippolitum
privignum suum suspendio se necavit ob amorem. Ariadne,
die bei Polygnot auf einem Felsen sitzt und auf Phaidra blickt,
findet sich bei Hygin 255 unter dem Titel, quae impiae fuerunt:
fratrem et filios occidit, Prokris ebenso bei Hygin 253, quae
contra fas concubuerunt: Procris cum Erechtheo patre, ex quo
natus est Aglaurus, und Eriphyle, quae doni cupida coniugem
prodidit (Hygin 73) ist ja die erste in der langen Reihe der
Unglücksweiber, die durch eine ‘Halsbandgeschichte’ Häuser und
Reiche zerstörten. Diesen stehen nun gegenüber Iphimedeia
und Auge als Miitter großer Geschlechter durch die Liebe eines
Gottes, Chloris und Thyia, die Polygnot als Schwestern gegolten
haben miissen, im gleichen Sinne, und Tyro, die wieder bei
Hygin erscheint: 254 quae piissimae fuerunt. Tyro Salmonei
filia propter patrem filios suos necavit.
Nach dem Beweis von Wilamowitz, Homer. Untersu-
chungen 147ff. ist klar, daß der Heroinenkatalog aus den Kyprien
und anderen Epen in die Odyssee als eine Liste der Ahnfrauen
der großen Geschlechter gekommen ist. Aber für Polygnot oder
gothischen Kathedrale oder eines Freskenzyklus der Renaissance oder
des Barock dem Bildhauer oder Maler zugeschrieben wird. Während
wir hier doch in unzähligen Fällen den Bauherrn und Auftraggeber oder
seinen gelehrten Berater als den Urheber der inhaltlichen Erfindung
nachweisen können. Also geht auch der Entwurf der Nekyia auf eine
literarische Persönlichkeit gewiß in Delphi zurück. Über die Bedeutung
Delphis für die mythische Dichtung siehe v. Wilamowitz, Pindaros S. 84f
Die Prokris hat mit Phaidra nichts zu tun. Jedes verbindende formale
Motiv einer griechischen Darstellung setzt eine mythologische Beziehung
der Verbundenen voraus. Auch ist das Motiv einer eine andere schau-
kelnden Figur eines von der Art, wie sie Pausanias auffallen, der aber
nichts davon sagt. Das Motiv ist bei Robert wie bei Weizsäcker (Poly-
gnots Gemälde, Stuttgart 1895) zu streichen. — Chloris und Thyie durch
das Motiv des Lagerns der einen im Schoß der anderen als Schwestern
gekennzeichnet wie die Erinys bei Furtwängler-Reichhold Taf. 120 und
die ‘Tauschwestern’ des Parthenon.