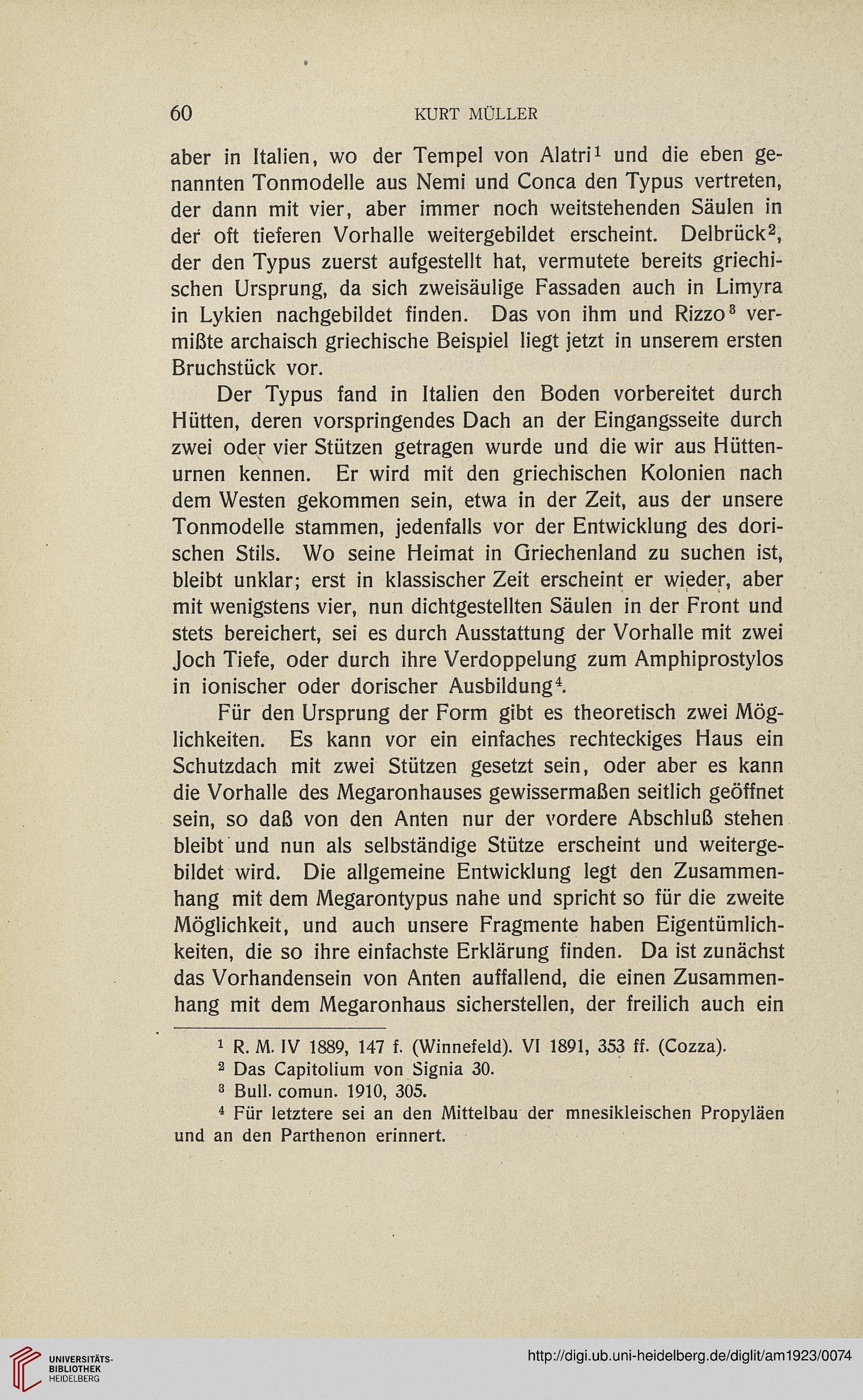60
KURT MÜLLER
aber in Italien, wo der Tempel von Alatri 1 und die eben ge-
nannten Tonmodelle aus Nemi und Conca den Typus vertreten,
der dann mit vier, aber immer noch weitstehenden Säulen in
der oft tieferen Vorhalle weitergebildet erscheint. Delbrück 2,
der den Typus zuerst aufgestellt hat, vermutete bereits griechi-
schen Ursprung, da sich zweisäulige Fassaden auch in Limyra
in Lykien nachgebildet finden. Das von ihm und Rizzo 3 ver-
mißte archaisch griechische Beispiel liegt jetzt in unserem ersten
Bruchstück vor.
Der Typus fand in Italien den Boden vorbereitet durch
Hütten, deren vorspringendes Dach an der Eingangsseite durch
zwei oder vier Stützen getragen wurde und die wir aus Hütten-
urnen kennen. Er wird mit den griechischen Kolonien nach
dem Westen gekommen sein, etwa in der Zeit, aus der unsere
Tonmodelle stammen, jedenfalls vor der Entwicklung des dori-
schen Stils. Wo seine Heimat in Griechenland zu suchen ist,
bleibt unklar; erst in klassischer Zeit erscheint er wieder, aber
mit wenigstens vier, nun dichtgestellten Säulen in der Front und
stets bereichert, sei es durch Ausstattung der Vorhalle mit zwei
Joch Tiefe, oder durch ihre Verdoppelung zum Amphiprostylos
in ionischer oder dorischer Ausbildung 4.
Für den Ursprung der Form gibt es theoretisch zwei Mög-
lichkeiten. Es kann vor ein einfaches rechteckiges Haus ein
Schutzdach mit zwei Stützen gesetzt sein, oder aber es kann
die Vorhalle des Megaronhauses gewissermaßen seitlich geöffnet
sein, so daß von den Anten nur der vordere Abschluß stehen
bleibt und nun als selbständige Stütze erscheint und weiterge-
bildet wird. Die allgemeine Entwicklung legt den Zusammen-
hang mit dem Megarontypus nahe und spricht so für die zweite
Möglichkeit, und auch unsere Fragmente haben Eigentümlich-
keiten, die so ihre einfachste Erklärung finden. Da ist zunächst
das Vorhandensein von Anten auffallend, die einen Zusammen-
hang mit dem Megaronhaus sicherstellen, der freilich auch ein
1 R. M. IV 1889, 147 f. (Winnefeld). VI 1891, 353 ff. (Cozza).
2 Das Capitolium von Signia 30.
3 Bull. comun. 1910, 305.
4 Für letztere sei an den Mittelbau der mnesikleischen Propyläen
und an den Parthenon erinnert.
KURT MÜLLER
aber in Italien, wo der Tempel von Alatri 1 und die eben ge-
nannten Tonmodelle aus Nemi und Conca den Typus vertreten,
der dann mit vier, aber immer noch weitstehenden Säulen in
der oft tieferen Vorhalle weitergebildet erscheint. Delbrück 2,
der den Typus zuerst aufgestellt hat, vermutete bereits griechi-
schen Ursprung, da sich zweisäulige Fassaden auch in Limyra
in Lykien nachgebildet finden. Das von ihm und Rizzo 3 ver-
mißte archaisch griechische Beispiel liegt jetzt in unserem ersten
Bruchstück vor.
Der Typus fand in Italien den Boden vorbereitet durch
Hütten, deren vorspringendes Dach an der Eingangsseite durch
zwei oder vier Stützen getragen wurde und die wir aus Hütten-
urnen kennen. Er wird mit den griechischen Kolonien nach
dem Westen gekommen sein, etwa in der Zeit, aus der unsere
Tonmodelle stammen, jedenfalls vor der Entwicklung des dori-
schen Stils. Wo seine Heimat in Griechenland zu suchen ist,
bleibt unklar; erst in klassischer Zeit erscheint er wieder, aber
mit wenigstens vier, nun dichtgestellten Säulen in der Front und
stets bereichert, sei es durch Ausstattung der Vorhalle mit zwei
Joch Tiefe, oder durch ihre Verdoppelung zum Amphiprostylos
in ionischer oder dorischer Ausbildung 4.
Für den Ursprung der Form gibt es theoretisch zwei Mög-
lichkeiten. Es kann vor ein einfaches rechteckiges Haus ein
Schutzdach mit zwei Stützen gesetzt sein, oder aber es kann
die Vorhalle des Megaronhauses gewissermaßen seitlich geöffnet
sein, so daß von den Anten nur der vordere Abschluß stehen
bleibt und nun als selbständige Stütze erscheint und weiterge-
bildet wird. Die allgemeine Entwicklung legt den Zusammen-
hang mit dem Megarontypus nahe und spricht so für die zweite
Möglichkeit, und auch unsere Fragmente haben Eigentümlich-
keiten, die so ihre einfachste Erklärung finden. Da ist zunächst
das Vorhandensein von Anten auffallend, die einen Zusammen-
hang mit dem Megaronhaus sicherstellen, der freilich auch ein
1 R. M. IV 1889, 147 f. (Winnefeld). VI 1891, 353 ff. (Cozza).
2 Das Capitolium von Signia 30.
3 Bull. comun. 1910, 305.
4 Für letztere sei an den Mittelbau der mnesikleischen Propyläen
und an den Parthenon erinnert.