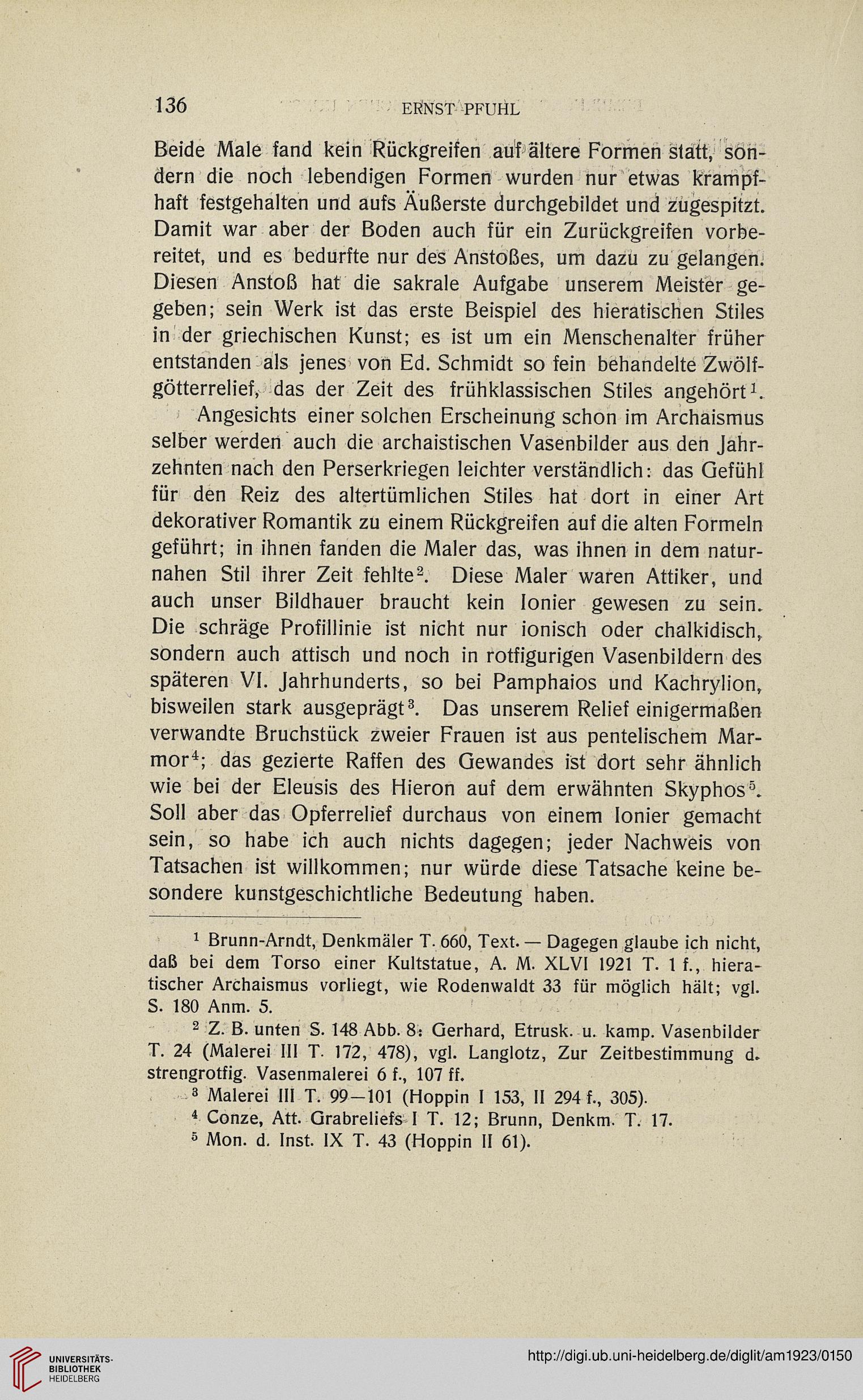136
ERNST PFUHL
Beide Male fand kein Rückgreifen aüf ältere Formen statt, son-
dern die noch lebendigen Formen wurden nur etwas krampf-
haft festgehalten und aufs Äußerste durchgebildet und zugespitzt.
Damit war aber der Boden auch für ein Zuriickgreifen vorbe-
reitet, und es bedurfte nur des Anstoßes, um dazu zu gelangen.
Diesen Anstoß hat die sakrale Aufgabe unserem Meister ge-
geben; sein Werk ist das erste Beispiel des hieratischen Stiles
in der griechischen Kunst; es ist um ein Menschenalter friiher
entstanden als jenes von Ed. Schmidt so fein behandelte Zwölf-
götterrelief, das der Zeit des frühklassischen Stiles angehört 1.
Angesichts einer solchen Erscheinung schon im Archaismus
selber werden auch die archaistischen Vasenbilder aus den Jahr-
zehnten nach den Perserkriegen leichter verständlich: das Gefühl
für den Reiz des altertümlichen Stiles hat dort in einer Art
dekorativer Romantik zu einem Rückgreifen auf die alten Formeln
geführt; in ihnen fanden die Maler das, was ihnen in dem natur-
nahen Stil ihrer Zeit fehlte 2. Diese Maler waren Attiker, und
auch unser Bildhauer braucht kein Ionier gewesen zu sein.
Die schräge Profillinie ist nicht nur ionisch oder chalkidisch,
sondern auch attisch und noch in rotfigurigen Vasenbildern des
späteren VI. Jahrhunderts, so bei Pamphaios und Kachrylion,
bisweilen stark ausgeprägt 3. Das unserem Relief einigermaßen
verwandte Bruchstück zweier Frauen ist aus pentelischem Mar-
mor 4; das gezierte Raffen des Gewandes ist dort sehr ähnlich
wie bei der Eleusis des Hieron auf dem erwähnten Skyphos 5.
Soll aber das Opferrelief durchaus von einem Ionier gemacht
sein, so habe ich auch nichts dagegen; jeder Nachweis von
Tatsachen ist willkommen; nur würde diese Tatsache keine be-
sondere kunstgeschichtliche Bedeutung haben.
1 Brunn-Arndt, Denkmäler T. 660, Text. — Dagegen glaube ich nicht,
daß bei dem Torso einer Kultstatue, A. M. XLVI 1921 T. 1 f., hiera-
tischer Archaismus vorliegt, wie Rodenwaldt 33 für möglich hält; vgl.
S. 180 Anm. 5.
2 Z. B. unten S. 148 Abb. 8: Gerhard, Etrusk. u. kamp. Vasenbilder
T. 24 (Malerei III T. 172, 478), vgl. Langlotz, Zur Zeitbestimmung d.
strengrotfig. Vasenmalerei 6 f., 107 ff.
3 Malerei III T. 99-101 (Hoppin I 153, II 294 f., 305).
4 Conze, Att. Grabreliefs I T. 12; Brunn, Denkm. T. 17.
5 Mon. d. Inst. IX T. 43 (Hoppin II 61).
ERNST PFUHL
Beide Male fand kein Rückgreifen aüf ältere Formen statt, son-
dern die noch lebendigen Formen wurden nur etwas krampf-
haft festgehalten und aufs Äußerste durchgebildet und zugespitzt.
Damit war aber der Boden auch für ein Zuriickgreifen vorbe-
reitet, und es bedurfte nur des Anstoßes, um dazu zu gelangen.
Diesen Anstoß hat die sakrale Aufgabe unserem Meister ge-
geben; sein Werk ist das erste Beispiel des hieratischen Stiles
in der griechischen Kunst; es ist um ein Menschenalter friiher
entstanden als jenes von Ed. Schmidt so fein behandelte Zwölf-
götterrelief, das der Zeit des frühklassischen Stiles angehört 1.
Angesichts einer solchen Erscheinung schon im Archaismus
selber werden auch die archaistischen Vasenbilder aus den Jahr-
zehnten nach den Perserkriegen leichter verständlich: das Gefühl
für den Reiz des altertümlichen Stiles hat dort in einer Art
dekorativer Romantik zu einem Rückgreifen auf die alten Formeln
geführt; in ihnen fanden die Maler das, was ihnen in dem natur-
nahen Stil ihrer Zeit fehlte 2. Diese Maler waren Attiker, und
auch unser Bildhauer braucht kein Ionier gewesen zu sein.
Die schräge Profillinie ist nicht nur ionisch oder chalkidisch,
sondern auch attisch und noch in rotfigurigen Vasenbildern des
späteren VI. Jahrhunderts, so bei Pamphaios und Kachrylion,
bisweilen stark ausgeprägt 3. Das unserem Relief einigermaßen
verwandte Bruchstück zweier Frauen ist aus pentelischem Mar-
mor 4; das gezierte Raffen des Gewandes ist dort sehr ähnlich
wie bei der Eleusis des Hieron auf dem erwähnten Skyphos 5.
Soll aber das Opferrelief durchaus von einem Ionier gemacht
sein, so habe ich auch nichts dagegen; jeder Nachweis von
Tatsachen ist willkommen; nur würde diese Tatsache keine be-
sondere kunstgeschichtliche Bedeutung haben.
1 Brunn-Arndt, Denkmäler T. 660, Text. — Dagegen glaube ich nicht,
daß bei dem Torso einer Kultstatue, A. M. XLVI 1921 T. 1 f., hiera-
tischer Archaismus vorliegt, wie Rodenwaldt 33 für möglich hält; vgl.
S. 180 Anm. 5.
2 Z. B. unten S. 148 Abb. 8: Gerhard, Etrusk. u. kamp. Vasenbilder
T. 24 (Malerei III T. 172, 478), vgl. Langlotz, Zur Zeitbestimmung d.
strengrotfig. Vasenmalerei 6 f., 107 ff.
3 Malerei III T. 99-101 (Hoppin I 153, II 294 f., 305).
4 Conze, Att. Grabreliefs I T. 12; Brunn, Denkm. T. 17.
5 Mon. d. Inst. IX T. 43 (Hoppin II 61).