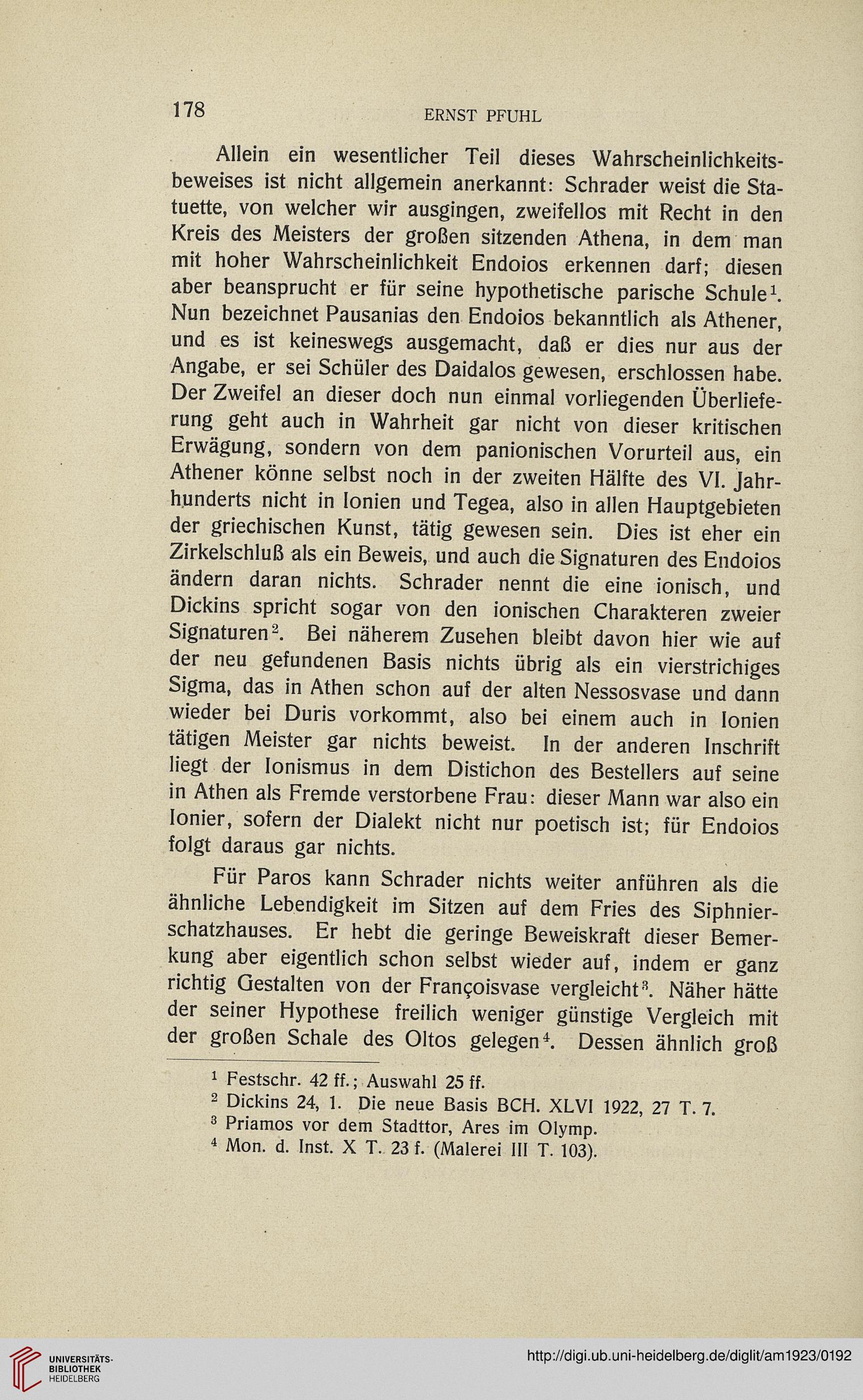178
ERNST PFUHL
Allein ein wesentlicher Teil dieses Wahrscheinlichkeits-
beweises ist nicht allgemein anerkannt: Schrader weist die Sta-
tuette, von welcher wir ausgingen, zweifellos mit Recht in den
Kreis des Meisters der großen sitzenden Athena, in dem man
mit hoher Wahrscheinlichkeit Endoios erkennen darf; diesen
aber beansprucht er für seine hypothetische parische Schule 1.
Nun bezeichnet Pausanias den Endoios bekanntlich als Athener,
und es ist keineswegs ausgemacht, daß er dies nur aus der
Angabe, er sei Schüler des Daidalos gewesen, erschlossen habe.
Der Zweifel an dieser doch nun einmal vorliegenden Überliefe-
rung geht auch in Wahrheit gar nicht von dieser kritischen
Erwägung, sondern von dem panionischen Vorurteil aus, ein
Athener könne selbst noch in der zweiten Hälfte des VI. Jahr-
hunderts nicht in Ionien und Tegea, also in allen Hauptgebieten
der griechischen Kunst, tätig gewesen sein. Dies ist eher ein
Zirkelschluß als ein Beweis, und auch die Signaturen des Endoios
ändern daran nichts. Schrader nennt die eine ionisch, und
Dickins spricht sogar von den ionischen Charakteren zweier
Signaturen 2. Bei näherem Zusehen bleibt davon hier wie auf
der neu gefundenen Basis nichts übrig als ein vierstrichiges
Sigma, das in Athen schon auf der alten Nessosvase und dann
wieder bei Duris vorkommt, also bei einem auch in Ionien
tätigen Meister gar nichts beweist. In der anderen Inschrift
liegt der Ionismus in dem Distichon des Bestellers auf seine
in Athen als Fremde verstorbene Frau: dieser Mann war also ein
Ionier, sofern der Dialekt nicht nur poetisch ist; für Endoios
folgt daraus gar nichts.
Für Paros kann Schrader nichts weiter anführen als die
ähnliche Lebendigkeit im Sitzen auf dem Fries des Siphnier-
schatzhauses. Er hebt die geringe Beweiskraft dieser Bemer-
kung aber eigentlich schon selbst wieder auf, indem er ganz
richtig Gestalten von der Fran^oisvase vergleicht 3. Näher hätte
der seiner Hypothese freilich weniger günstige Vergleich mit
der großen Schale des Oltos gelegen 4. Dessen ähnlich groß
1 Festschr. 42 ff.; Auswahl 25 ff.
2 Dickins 24, 1. Die neue Basis BCH. XLVI 1922, 27 T. 7.
3 Priamos vor dem Stadttor, Ares im Olymp.
4 Mon. d. Inst. X T. 23 f. (Malerei III T. 103).
ERNST PFUHL
Allein ein wesentlicher Teil dieses Wahrscheinlichkeits-
beweises ist nicht allgemein anerkannt: Schrader weist die Sta-
tuette, von welcher wir ausgingen, zweifellos mit Recht in den
Kreis des Meisters der großen sitzenden Athena, in dem man
mit hoher Wahrscheinlichkeit Endoios erkennen darf; diesen
aber beansprucht er für seine hypothetische parische Schule 1.
Nun bezeichnet Pausanias den Endoios bekanntlich als Athener,
und es ist keineswegs ausgemacht, daß er dies nur aus der
Angabe, er sei Schüler des Daidalos gewesen, erschlossen habe.
Der Zweifel an dieser doch nun einmal vorliegenden Überliefe-
rung geht auch in Wahrheit gar nicht von dieser kritischen
Erwägung, sondern von dem panionischen Vorurteil aus, ein
Athener könne selbst noch in der zweiten Hälfte des VI. Jahr-
hunderts nicht in Ionien und Tegea, also in allen Hauptgebieten
der griechischen Kunst, tätig gewesen sein. Dies ist eher ein
Zirkelschluß als ein Beweis, und auch die Signaturen des Endoios
ändern daran nichts. Schrader nennt die eine ionisch, und
Dickins spricht sogar von den ionischen Charakteren zweier
Signaturen 2. Bei näherem Zusehen bleibt davon hier wie auf
der neu gefundenen Basis nichts übrig als ein vierstrichiges
Sigma, das in Athen schon auf der alten Nessosvase und dann
wieder bei Duris vorkommt, also bei einem auch in Ionien
tätigen Meister gar nichts beweist. In der anderen Inschrift
liegt der Ionismus in dem Distichon des Bestellers auf seine
in Athen als Fremde verstorbene Frau: dieser Mann war also ein
Ionier, sofern der Dialekt nicht nur poetisch ist; für Endoios
folgt daraus gar nichts.
Für Paros kann Schrader nichts weiter anführen als die
ähnliche Lebendigkeit im Sitzen auf dem Fries des Siphnier-
schatzhauses. Er hebt die geringe Beweiskraft dieser Bemer-
kung aber eigentlich schon selbst wieder auf, indem er ganz
richtig Gestalten von der Fran^oisvase vergleicht 3. Näher hätte
der seiner Hypothese freilich weniger günstige Vergleich mit
der großen Schale des Oltos gelegen 4. Dessen ähnlich groß
1 Festschr. 42 ff.; Auswahl 25 ff.
2 Dickins 24, 1. Die neue Basis BCH. XLVI 1922, 27 T. 7.
3 Priamos vor dem Stadttor, Ares im Olymp.
4 Mon. d. Inst. X T. 23 f. (Malerei III T. 103).