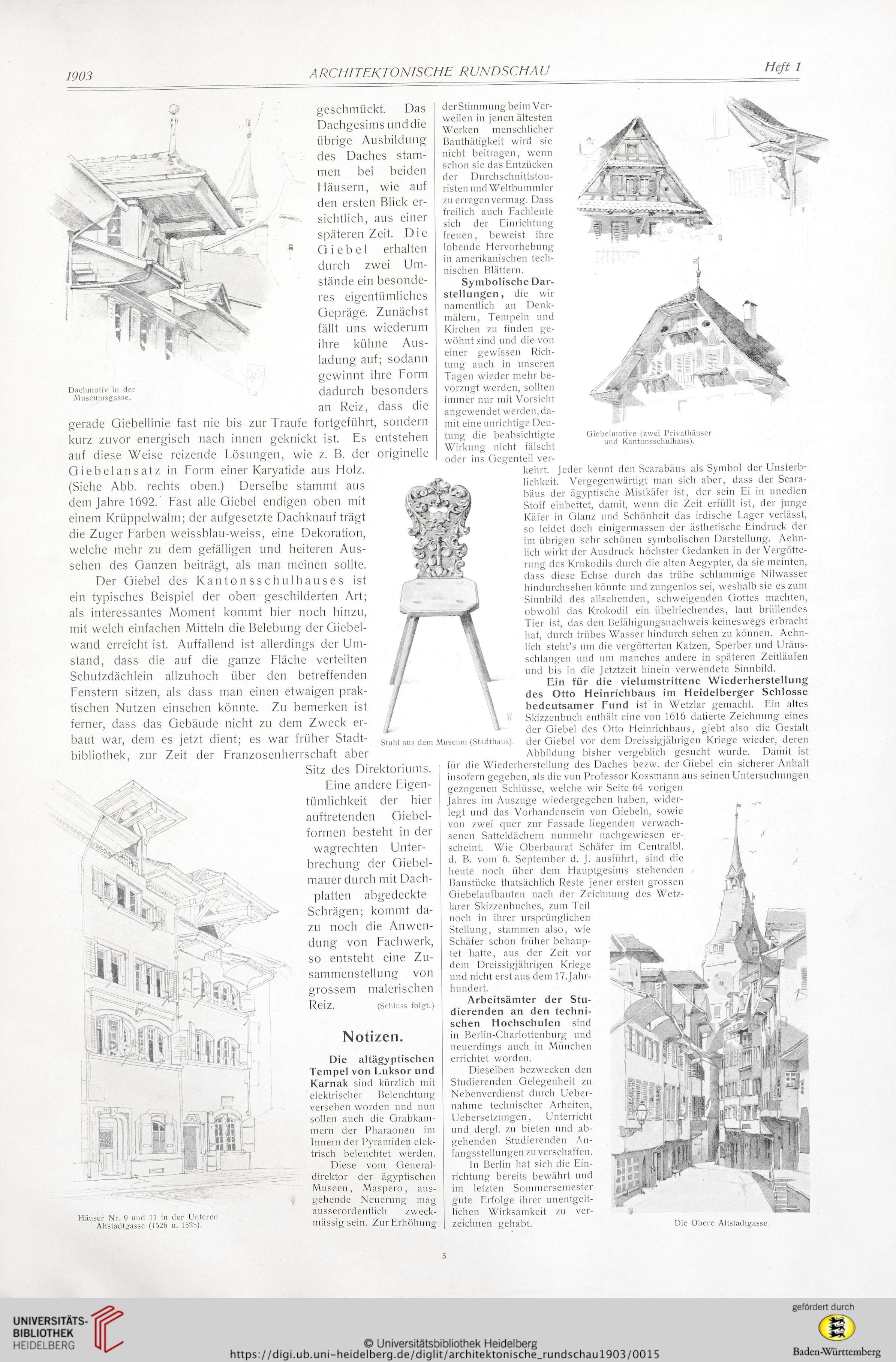1903
ARCHITEKTONISCHE RUNDSCHAU
Heft 1
Stuhl aus dem Museum (Stadthaus).
Notizen.
Die Obere Altstadtgasse.
Dachmotiv in der
Museumsgasse.
Häuser Nr. 9 und 11 in der Unteren
Altstadtgasse (1526 u. 152b).
entstehen
originelle
Oiebeimotive (zwei Privathäuser
und Kantonsschulhaus).
Die altägyptischen
Tempel von Luksor und
Karnak sind kürzlich mit
elektrischer Beleuchtung
versehen worden und nun
sollen auch die Grabkam-
mern der Pharaonen im
Innern der Pyramiden elek-
trisch beleuchtet werden.
Diese vom General-
direktor der ägyptischen
Museen, Maspero, aus-
gehende Neuerung mag
ausserordentlich zweck-
mässig sein. Zur Erhöhung
der Stimmung beim Ver¬
weilen in jenen ältesten
Werken menschlicher
Bauthätigkeit wird sie
nicht beitragen, wenn
schon sie das Entzücken
der Durchschnittstou¬
risten und Weltbummler
zu erregen vermag. Dass
freilich auch Fachleute
sich der Einrichtung
freuen, beweist ihre
lobende Hervorhebung
in amerikanischen tech¬
nischen Blättern.
Symbolische Dar¬
stellungen, die wii-
namentlich an Denk¬
mälern, Tempeln und
Kirchen zu finden ge¬
wöhnt sind und die von
einer gewissen Rich¬
tung auch in unseren
Tagen wieder mehr be¬
vorzugt werden, sollten
immer nur mit Vorsicht
angewendet werden, da¬
mit eine unrichtige Deu¬
tung die beabsichtigte
Wirkung nicht fälscht
oder ins Gegenteil ver¬
kehrt. Jeder kennt den Scarabäus als Symbol der Unsterb-
lichkeit. Vergegenwärtigt man sich aber, dass der Scara-
bäus der ägyptische Mistkäfer ist, der sein Ei in unedlen
Stoff einbettet, damit, wenn die Zeit erfüllt ist, der junge
Käfer in Glanz und Schönheit das irdische Lager verlässt,
so leidet doch einigermassen der ästhetische Eindruck der
im übrigen sehr schönen symbolischen Darstellung. Aehn-
lich wirkt der Ausdruck höchster Gedanken in der Vergötte-
rung des Krokodils durch die alten Aegypter, da sie meinten,
dass diese Echse durch das trübe schlammige Nilwasser
hindurchsehen könnte und zungenlos sei, weshalb sie es zum
Sinnbild des allsehenden, schweigenden Gottes machten,
obwohl das Krokodil ein übelriechendes, laut brüllendes
Tier ist, das den Befähigungsnachweis keineswegs erbracht
hat, durch trübes Wasser hindurch sehen zu können. Aehn-
lich steht’s um die vergötterten Katzen, Sperber und Uräus-
schlangen und um manches andere in späteren Zeitläufen
und bis in die Jetztzeit hinein verwendete Sinnbild.
Ein für die vielumstrittene Wiederherstellung
des Otto Heinrichbaus im Heidelberger Schlosse
bedeutsamer Fund ist in Wetzlar gemacht. Ein altes
Skizzenbuch enthält eine von 1616 datierte Zeichnung eines
der Giebel des Otto Heinrichbaus, giebt also die Gestalt
der Giebel vor dem Dreissigjährigen Kriege wieder, deren
Abbildung bisher vergeblich gesucht wurde. Damit ist
für die Wiederherstellung des Daches bezw. der Giebel ein sicherer Anhalt
insofern gegeben, als die von Professor Kossmann aus seinen Untersuchungen
gezogenen Schlüsse, welche wir Seite 64 vorigen
Jahres im Auszuge wiedergegeben haben, wider¬
legt und das Vorhandensein von Giebeln, sowie
von zwei quer zur Fassade liegenden verwach¬
senen Satteldächern nunmehr nachgewiesen er¬
scheint. Wie Oberbaurat Schäfer im Centralbl.
d. B. vom 6. September d. J. ausführt, sind die
heute noch über dem Hauptgesims stehenden
Baustücke thatsächlich Reste jener ersten grossen
Giebelaufbauten nach der Zeichnung des Wetz¬
larer Skizzenbuches, zum Teil
noch in ihrer ursprünglichen
Stellung, stammen also, wie
Schäfer schon früher behaup¬
tet hatte, aus der Zeit vor
dem Dreissigjährigen Kriege
und nicht erst aus dem 17. Jahr¬
hundert.
Arbeitsämter der Stu¬
dierenden an den techni¬
schen Hochschulen sind
in Berlin-Charlottenburg und
neuerdings auch in München
errichtet worden.
Dieselben bezwecken den
Studierenden Gelegenheit zu
Nebenverdienst durch Ueber-
nahme technischer Arbeiten,
Uebersetzungen, Unterricht
und dergl. zu bieten und ab¬
gehenden Studierenden An¬
fangsstellungenzuverschaffen.
In Berlin hat sich die Ein¬
richtung bereits bewährt und
im letzten Sommersemester
gute Erfolge ihrer unentgelt¬
lichen Wirksamkeit zu ver¬
zeichnen gehabt.
geschmückt. Das
Dachgesims und die
übrige Ausbildung
des Daches stam-
men bei beiden
Häusern, wie auf
den ersten Blick er-
sichtlich, aus einer
späteren Zeit. Die
Giebel erhalten
durch zwei Um-
stände ein besonde-
res eigentümliches
Gepräge. Zunächst
fällt uns wiederum
ihre kühne Aus-
ladung auf; sodann
gewinnt ihre Form
dadurch besonders
an Reiz, dass die
gerade Giebellinie fast nie bis zur Traufe fortgeführt, sondern
kurz zuvor energisch nach innen geknickt ist. Es
auf diese Weise reizende Lösungen, wie z. B. der
Giebelansatz in Form einer Karyatide aus Holz.
(Siehe Abb. rechts oben.) Derselbe stammt aus
dem Jahre 1692. Fast alle Giebel endigen oben mit
einem Krüppelwalm; der aufgesetzte Dachknauf trägt
die Zuger Farben weissblau-weiss, eine Dekoration,
welche mehr zu dem gefälligen und heiteren Aus-
sehen des Ganzen beiträgt, als man meinen sollte.
Der Giebel des Kantonsschulhauses ist
ein typisches Beispiel der oben geschilderten Art;
als interessantes Moment kommt hier noch hinzu,
mit welch einfachen Mitteln die Belebung der Giebel-
wand erreicht ist. Auffallend ist allerdings der Um-
stand, dass die auf die ganze Fläche verteilten
Schutzdächlein allzuhoch über den betreffenden
Fenstern sitzen, als dass man einen etwaigen prak-
tischen Nutzen einsehen könnte. Zu bemerken ist
ferner, dass das Gebäude nicht zu dem Zweck er-
baut war, dem es jetzt dient; es war früher Stadt-
bibliothek, zur Zeit der Franzosenherrschaft aber
Sitz des Direktoriums.
Eine andere Eigen-
tümlichkeit der hier
auftretenden Giebel-
formen besteht in der
wagrechten Unter-
brechung der Giebel-
mauer durch mit Dach-
platten abgedeckte
Schrägen; kommt da-
zu noch die Anwen-
dung von Fachwerk,
so entsteht eine Zu-
sammenstellung von
grossem malerischen
Reiz. (Schluss folgt.)
5
ARCHITEKTONISCHE RUNDSCHAU
Heft 1
Stuhl aus dem Museum (Stadthaus).
Notizen.
Die Obere Altstadtgasse.
Dachmotiv in der
Museumsgasse.
Häuser Nr. 9 und 11 in der Unteren
Altstadtgasse (1526 u. 152b).
entstehen
originelle
Oiebeimotive (zwei Privathäuser
und Kantonsschulhaus).
Die altägyptischen
Tempel von Luksor und
Karnak sind kürzlich mit
elektrischer Beleuchtung
versehen worden und nun
sollen auch die Grabkam-
mern der Pharaonen im
Innern der Pyramiden elek-
trisch beleuchtet werden.
Diese vom General-
direktor der ägyptischen
Museen, Maspero, aus-
gehende Neuerung mag
ausserordentlich zweck-
mässig sein. Zur Erhöhung
der Stimmung beim Ver¬
weilen in jenen ältesten
Werken menschlicher
Bauthätigkeit wird sie
nicht beitragen, wenn
schon sie das Entzücken
der Durchschnittstou¬
risten und Weltbummler
zu erregen vermag. Dass
freilich auch Fachleute
sich der Einrichtung
freuen, beweist ihre
lobende Hervorhebung
in amerikanischen tech¬
nischen Blättern.
Symbolische Dar¬
stellungen, die wii-
namentlich an Denk¬
mälern, Tempeln und
Kirchen zu finden ge¬
wöhnt sind und die von
einer gewissen Rich¬
tung auch in unseren
Tagen wieder mehr be¬
vorzugt werden, sollten
immer nur mit Vorsicht
angewendet werden, da¬
mit eine unrichtige Deu¬
tung die beabsichtigte
Wirkung nicht fälscht
oder ins Gegenteil ver¬
kehrt. Jeder kennt den Scarabäus als Symbol der Unsterb-
lichkeit. Vergegenwärtigt man sich aber, dass der Scara-
bäus der ägyptische Mistkäfer ist, der sein Ei in unedlen
Stoff einbettet, damit, wenn die Zeit erfüllt ist, der junge
Käfer in Glanz und Schönheit das irdische Lager verlässt,
so leidet doch einigermassen der ästhetische Eindruck der
im übrigen sehr schönen symbolischen Darstellung. Aehn-
lich wirkt der Ausdruck höchster Gedanken in der Vergötte-
rung des Krokodils durch die alten Aegypter, da sie meinten,
dass diese Echse durch das trübe schlammige Nilwasser
hindurchsehen könnte und zungenlos sei, weshalb sie es zum
Sinnbild des allsehenden, schweigenden Gottes machten,
obwohl das Krokodil ein übelriechendes, laut brüllendes
Tier ist, das den Befähigungsnachweis keineswegs erbracht
hat, durch trübes Wasser hindurch sehen zu können. Aehn-
lich steht’s um die vergötterten Katzen, Sperber und Uräus-
schlangen und um manches andere in späteren Zeitläufen
und bis in die Jetztzeit hinein verwendete Sinnbild.
Ein für die vielumstrittene Wiederherstellung
des Otto Heinrichbaus im Heidelberger Schlosse
bedeutsamer Fund ist in Wetzlar gemacht. Ein altes
Skizzenbuch enthält eine von 1616 datierte Zeichnung eines
der Giebel des Otto Heinrichbaus, giebt also die Gestalt
der Giebel vor dem Dreissigjährigen Kriege wieder, deren
Abbildung bisher vergeblich gesucht wurde. Damit ist
für die Wiederherstellung des Daches bezw. der Giebel ein sicherer Anhalt
insofern gegeben, als die von Professor Kossmann aus seinen Untersuchungen
gezogenen Schlüsse, welche wir Seite 64 vorigen
Jahres im Auszuge wiedergegeben haben, wider¬
legt und das Vorhandensein von Giebeln, sowie
von zwei quer zur Fassade liegenden verwach¬
senen Satteldächern nunmehr nachgewiesen er¬
scheint. Wie Oberbaurat Schäfer im Centralbl.
d. B. vom 6. September d. J. ausführt, sind die
heute noch über dem Hauptgesims stehenden
Baustücke thatsächlich Reste jener ersten grossen
Giebelaufbauten nach der Zeichnung des Wetz¬
larer Skizzenbuches, zum Teil
noch in ihrer ursprünglichen
Stellung, stammen also, wie
Schäfer schon früher behaup¬
tet hatte, aus der Zeit vor
dem Dreissigjährigen Kriege
und nicht erst aus dem 17. Jahr¬
hundert.
Arbeitsämter der Stu¬
dierenden an den techni¬
schen Hochschulen sind
in Berlin-Charlottenburg und
neuerdings auch in München
errichtet worden.
Dieselben bezwecken den
Studierenden Gelegenheit zu
Nebenverdienst durch Ueber-
nahme technischer Arbeiten,
Uebersetzungen, Unterricht
und dergl. zu bieten und ab¬
gehenden Studierenden An¬
fangsstellungenzuverschaffen.
In Berlin hat sich die Ein¬
richtung bereits bewährt und
im letzten Sommersemester
gute Erfolge ihrer unentgelt¬
lichen Wirksamkeit zu ver¬
zeichnen gehabt.
geschmückt. Das
Dachgesims und die
übrige Ausbildung
des Daches stam-
men bei beiden
Häusern, wie auf
den ersten Blick er-
sichtlich, aus einer
späteren Zeit. Die
Giebel erhalten
durch zwei Um-
stände ein besonde-
res eigentümliches
Gepräge. Zunächst
fällt uns wiederum
ihre kühne Aus-
ladung auf; sodann
gewinnt ihre Form
dadurch besonders
an Reiz, dass die
gerade Giebellinie fast nie bis zur Traufe fortgeführt, sondern
kurz zuvor energisch nach innen geknickt ist. Es
auf diese Weise reizende Lösungen, wie z. B. der
Giebelansatz in Form einer Karyatide aus Holz.
(Siehe Abb. rechts oben.) Derselbe stammt aus
dem Jahre 1692. Fast alle Giebel endigen oben mit
einem Krüppelwalm; der aufgesetzte Dachknauf trägt
die Zuger Farben weissblau-weiss, eine Dekoration,
welche mehr zu dem gefälligen und heiteren Aus-
sehen des Ganzen beiträgt, als man meinen sollte.
Der Giebel des Kantonsschulhauses ist
ein typisches Beispiel der oben geschilderten Art;
als interessantes Moment kommt hier noch hinzu,
mit welch einfachen Mitteln die Belebung der Giebel-
wand erreicht ist. Auffallend ist allerdings der Um-
stand, dass die auf die ganze Fläche verteilten
Schutzdächlein allzuhoch über den betreffenden
Fenstern sitzen, als dass man einen etwaigen prak-
tischen Nutzen einsehen könnte. Zu bemerken ist
ferner, dass das Gebäude nicht zu dem Zweck er-
baut war, dem es jetzt dient; es war früher Stadt-
bibliothek, zur Zeit der Franzosenherrschaft aber
Sitz des Direktoriums.
Eine andere Eigen-
tümlichkeit der hier
auftretenden Giebel-
formen besteht in der
wagrechten Unter-
brechung der Giebel-
mauer durch mit Dach-
platten abgedeckte
Schrägen; kommt da-
zu noch die Anwen-
dung von Fachwerk,
so entsteht eine Zu-
sammenstellung von
grossem malerischen
Reiz. (Schluss folgt.)
5