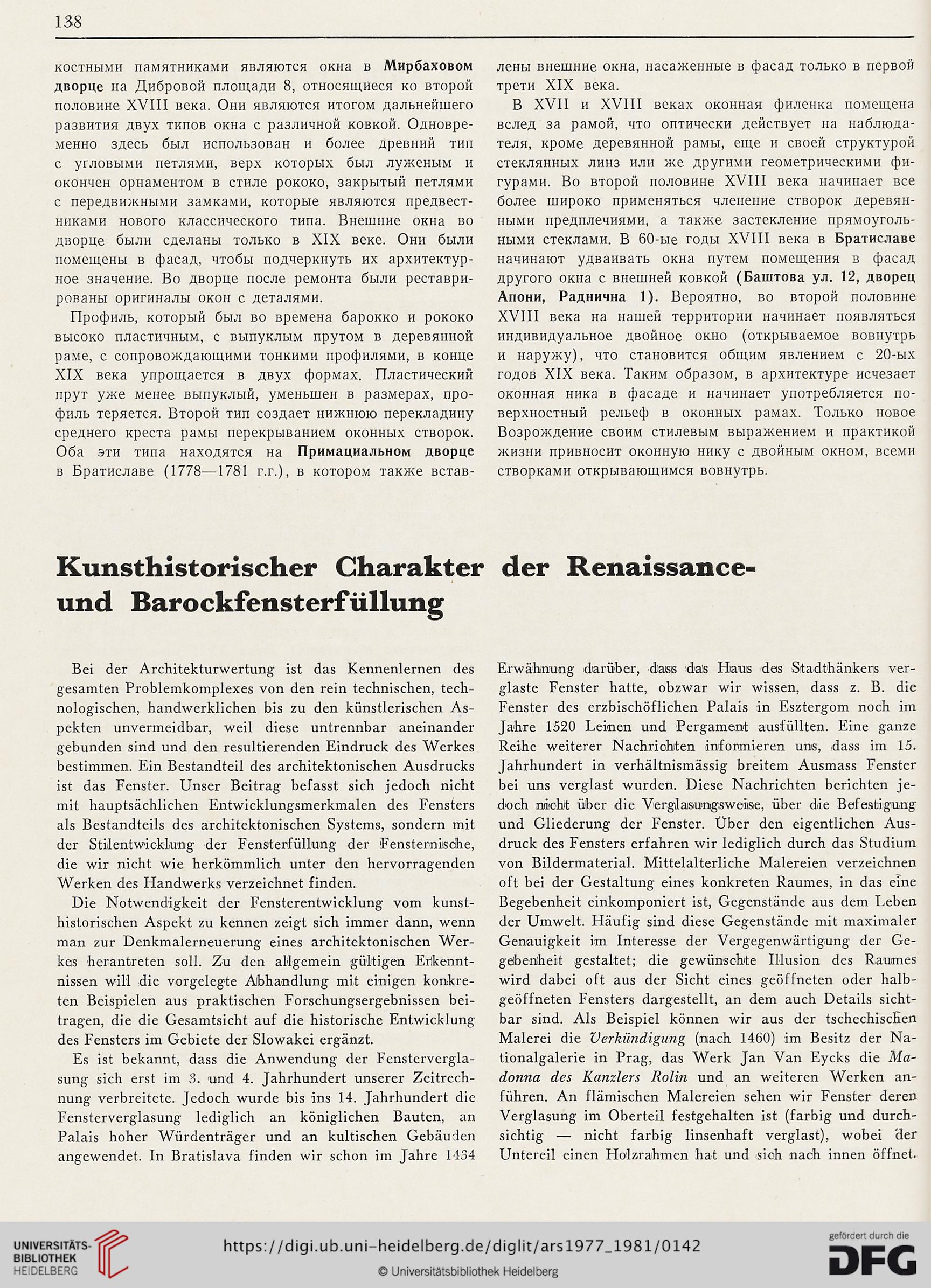138
KOCTHBIMH naMHTHHKaMH HBJIÍIIOTCH OKHa B Mnp6aXOBOM
ABoppe na XUßpoBOH njiomaAH 8, othochihhcch ko BTopoft
noJiOBHHe XVIII BeKa. Ohh hbahiotch htotom AaJibHeftmero
paaBHTHH AByX TKIIOB OKHa C pa3JIHHHOH KOBKOft. ÚAHOBpe-
M6HH0 3ACCb ÓbIJI HCH0JIb30BaH H ÓOJiee ApCBHHft thh
C yrjlOBHMH neTJIHMH, Bepx KOTOpHX ÓbIJI JiyxeHblM H
OKOHien opnaMeHTOM b ciHJie pokoko, aaKpbiTbift hctjihmh
c nepeABHJKHbíMH 3aMKaMH, KOTopbie MBJíHiOTCH npeABecT-
HHKaMH HOBoro KJiaccHHecKOro THna. BneinnHe OKHa bo
ABopiie óbiJiH caejiaHbí tojibko b XIX Bene. Ohh óhjih
noMemeHbí b JiacaA, htoóbi iiOA'iepKHVTb hx apxHTeKTyp-
Hoe 3HaneHHe. Bo ABopue nocjie peMOHTa 6hjih pecTaBpn-
pOBaHbl OpHFHHaAbl OKOH C AÉTajIHMH.
ripO(])HAb, KOTOpbIH ÓblA BO BpeMeiia ÓapOKKO H pOKOKO
BblCOKO HAaCTHHHblM, C BblHyKJIblM npyTOM B AepeBHHHOft
paMe, C COnpOBOJKAaiOUIHMH TOHKHMH npO(j)HA5IMH, B KOHIie
XIX BeKa ynpomaeTCH b Aßyx (jiopMax. HjiacTHHecKHft
npyr yxe Menee BbinyKAbift, yMenbuien b paswepax, npo-
(jiHAb TepneTCH. BTopoft thh co3AaeT hhjkhioio nepeKJiaAHHy
cpeAHero KpecTa paMbi nepeKphiBanneM okohhhix ctbopok.
06a 3TH THna HaxoAHTCH Ha IIpHMauHajibHOM ABOppe
b BparacAaBe (1778—1781 r.r.), b kotopom TaK>i<e BCTaB-
AeHbí BHemHHe OKHa, Haca»ceHHbie b JiacaA tojibko b nepBoft
TpeTH XIX BeKa.
B XVII h XVIII Benax oKOHHan (|)HAeHKa noMemena
BCJieA 3a paMoft, hto onTHuecKH AeftcTByeT na HaöjiiOAa-
tcjih, KpoMe AepeBHHHOÖ paMbi, eine h cBoeft CTpyKTypoft
CTeKJIHHHbIX AHH3 HJIH Hæ ApyrHMH reOMCTpHHeCKHMH (j)H-
rypaMH. Bo BTopoft nonoBHHe XVIII sena na^iHaei Bce
öojiee mnpoKO npHMeHHTbca 'i.iei-iei-iHe ctbopok nepeBHH-
HbiMH npeAnneHHHMH, a TaK»ce sacTeKnenne npaMoyroAb-
HHMH CTeKJiaMH. B 60-bie roAbi XVIII BeKa b EpaTHcjiase
HanHHaioT yABanBaTb OKHa nyreM noMemeHHH b JiacaA
Apyroro OKHa c BHeuiHeft kobkoh (BauiTOBa yji. 12, ABopeu
AnoHH, PanHHHHa 1). BeponTHO, bo BTopoft hojiobhhc
XVIII BeKa na Hauieft TeppHTopnn HamiHaeT hohbahtbch
HHAHBHAyaAbHOe ABOHHOe OKHO (oTKpbIBaeMOe BOBHyTpb
h napyacy), hto cthhobutch oóihhm HBneHHeM c 20-hx
roAOB XIX BeKa. Tbkhm oôpasoM, b apxHTeKType HcneaaeT
OKOHHan HHKa b (jjacane h HannnaeT ynoTpeÓJiaeTCH no-
BepXHOCTHblft peJIbeij) B OKOHHblX paMaX. TojIbKO HOBOe
Bo3po>KAeHHe cbohm cthahebim BBipaJKeHHeM h npaKTHKoň
JKH3HH npHBHOCHT OKOHHyiO HHKy C ABOftlíblM OKHOM, BCCMH
CTBOpKaMH OTKpblBaiOIHHMCH BOBHyTpb.
Kunsthistorischer Charakter der Renaissance-
und Báro ckfensterfiillung
Bei der Architekturwertung ist das Kennenlernen des
gesamten Problemkomplexes von den rein technischen, tech-
nologischen, handwerklichen bis zu den künstlerischen As-
pekten unvermeidbar, weil diese untrennbar aneinander
gebunden sind und den resultierenden Eindruck des Werkes
bestimmen. Ein Bestandteil des architektonischen Ausdrucks
ist das Fenster. Unser Beitrag befasst sich jedoch nicht
mit hauptsächlichen Entwicklungsmerkmalen des Fensters
als Bestandteils des architektonischen Systems, sondern mit
der Stilentwicklung der Fensterfüllung der Fensternische,
die wir nicht wie herkömmlich unter den hervorragenden
Werken des Handwerks verzeichnet finden.
Die Notwendigkeit der Fensterentwicklung vom kunst-
historischen Aspekt zu kennen zeigt sich immer dann, wenn
man zur Denkmalerneuerung eines architektonischen Wer-
kes herantreten soll. Zu den allgemein gültigen Erkennt-
nissen will die vorgelegte Abhandlung mit einigen konkre-
ten Beispielen aus praktischen Forschungsergebnissen bei-
tragen, die die Gesamtsicht auf die historische Entwicklung
des Fensters im Gebiete der Slowakei ergänzt.
Es ist bekannt, dass die Anwendung der Fenstervergla-
sung sich erst im 3. und 4. Jahrhundert unserer Zeitrech-
nung verbreitete. Jedoch wurde bis ins 14. Jahrhundert die
Fensterverglasung lediglich an königlichen Bauten, an
Palais hoher Würdenträger und an kultischen Gebäuden
angewendet. In Bratislava finden wir schon im Jahre 1434
Erwähnung darüber, dass dals Haus des Stadthänkeris ver-
glaste Fenster hatte, obzwar wir wissen, dass z. B. die
Fenster des erzbischöflichen Palais in Esztergom noch im
Jahre 1520 Leinen und Pergament ausfüllten. Eine ganze
Reihe weiterer Nachrichten informieren uns, dass im 15.
Jahrhundert in verhältnismässig breitem Ausmass Fenster
bei uns verglast wurden. Diese Nachrichten berichten je-
doch nicht über die Verglasungsweise, über die Befestigung
und Gliederung der Fenster. Über den eigentlichen Aus-
druck des Fensters erfahren wir lediglich durch das Studium
von Bildermaterial. Mittelalterliche Malereien verzeichnen
oft bei der Gestaltung eines konkreten Raumes, in das eine
Begebenheit einkomponiert ist, Gegenstände aus dem Leben
der Umwelt. Häufig sind diese Gegenstände mit maximaler
Genauigkeit im Interesse der Vergegenwärtigung der Ge-
gebenheit gestaltet; die gewünschte Illusion des Raumes
wird dabei oft aus der Sicht eines geöffneten oder halb-
geöffneten Fensters dargestellt, an dem auch Details sicht-
bar sind. Als Beispiel können wir aus der tschechischen
Malerei die Verkündigung (nach 1460) im Besitz der Na-
tionalgalerie in Prag, das Werk Jan Van Eycks die Af<z-
donna des Kanzlers Rolin und an weiteren Werken an-
führen. An flämischen Malereien sehen wir Fenster deren
Verglasung im Oberteil festgehalten ist (farbig und durch-
sichtig — nicht farbig linsenhaft verglast), wobei 'der
Untereil einen Holzrahmen hat und sieh nach innen öffnet.
KOCTHBIMH naMHTHHKaMH HBJIÍIIOTCH OKHa B Mnp6aXOBOM
ABoppe na XUßpoBOH njiomaAH 8, othochihhcch ko BTopoft
noJiOBHHe XVIII BeKa. Ohh hbahiotch htotom AaJibHeftmero
paaBHTHH AByX TKIIOB OKHa C pa3JIHHHOH KOBKOft. ÚAHOBpe-
M6HH0 3ACCb ÓbIJI HCH0JIb30BaH H ÓOJiee ApCBHHft thh
C yrjlOBHMH neTJIHMH, Bepx KOTOpHX ÓbIJI JiyxeHblM H
OKOHien opnaMeHTOM b ciHJie pokoko, aaKpbiTbift hctjihmh
c nepeABHJKHbíMH 3aMKaMH, KOTopbie MBJíHiOTCH npeABecT-
HHKaMH HOBoro KJiaccHHecKOro THna. BneinnHe OKHa bo
ABopiie óbiJiH caejiaHbí tojibko b XIX Bene. Ohh óhjih
noMemeHbí b JiacaA, htoóbi iiOA'iepKHVTb hx apxHTeKTyp-
Hoe 3HaneHHe. Bo ABopue nocjie peMOHTa 6hjih pecTaBpn-
pOBaHbl OpHFHHaAbl OKOH C AÉTajIHMH.
ripO(])HAb, KOTOpbIH ÓblA BO BpeMeiia ÓapOKKO H pOKOKO
BblCOKO HAaCTHHHblM, C BblHyKJIblM npyTOM B AepeBHHHOft
paMe, C COnpOBOJKAaiOUIHMH TOHKHMH npO(j)HA5IMH, B KOHIie
XIX BeKa ynpomaeTCH b Aßyx (jiopMax. HjiacTHHecKHft
npyr yxe Menee BbinyKAbift, yMenbuien b paswepax, npo-
(jiHAb TepneTCH. BTopoft thh co3AaeT hhjkhioio nepeKJiaAHHy
cpeAHero KpecTa paMbi nepeKphiBanneM okohhhix ctbopok.
06a 3TH THna HaxoAHTCH Ha IIpHMauHajibHOM ABOppe
b BparacAaBe (1778—1781 r.r.), b kotopom TaK>i<e BCTaB-
AeHbí BHemHHe OKHa, Haca»ceHHbie b JiacaA tojibko b nepBoft
TpeTH XIX BeKa.
B XVII h XVIII Benax oKOHHan (|)HAeHKa noMemena
BCJieA 3a paMoft, hto onTHuecKH AeftcTByeT na HaöjiiOAa-
tcjih, KpoMe AepeBHHHOÖ paMbi, eine h cBoeft CTpyKTypoft
CTeKJIHHHbIX AHH3 HJIH Hæ ApyrHMH reOMCTpHHeCKHMH (j)H-
rypaMH. Bo BTopoft nonoBHHe XVIII sena na^iHaei Bce
öojiee mnpoKO npHMeHHTbca 'i.iei-iei-iHe ctbopok nepeBHH-
HbiMH npeAnneHHHMH, a TaK»ce sacTeKnenne npaMoyroAb-
HHMH CTeKJiaMH. B 60-bie roAbi XVIII BeKa b EpaTHcjiase
HanHHaioT yABanBaTb OKHa nyreM noMemeHHH b JiacaA
Apyroro OKHa c BHeuiHeft kobkoh (BauiTOBa yji. 12, ABopeu
AnoHH, PanHHHHa 1). BeponTHO, bo BTopoft hojiobhhc
XVIII BeKa na Hauieft TeppHTopnn HamiHaeT hohbahtbch
HHAHBHAyaAbHOe ABOHHOe OKHO (oTKpbIBaeMOe BOBHyTpb
h napyacy), hto cthhobutch oóihhm HBneHHeM c 20-hx
roAOB XIX BeKa. Tbkhm oôpasoM, b apxHTeKType HcneaaeT
OKOHHan HHKa b (jjacane h HannnaeT ynoTpeÓJiaeTCH no-
BepXHOCTHblft peJIbeij) B OKOHHblX paMaX. TojIbKO HOBOe
Bo3po>KAeHHe cbohm cthahebim BBipaJKeHHeM h npaKTHKoň
JKH3HH npHBHOCHT OKOHHyiO HHKy C ABOftlíblM OKHOM, BCCMH
CTBOpKaMH OTKpblBaiOIHHMCH BOBHyTpb.
Kunsthistorischer Charakter der Renaissance-
und Báro ckfensterfiillung
Bei der Architekturwertung ist das Kennenlernen des
gesamten Problemkomplexes von den rein technischen, tech-
nologischen, handwerklichen bis zu den künstlerischen As-
pekten unvermeidbar, weil diese untrennbar aneinander
gebunden sind und den resultierenden Eindruck des Werkes
bestimmen. Ein Bestandteil des architektonischen Ausdrucks
ist das Fenster. Unser Beitrag befasst sich jedoch nicht
mit hauptsächlichen Entwicklungsmerkmalen des Fensters
als Bestandteils des architektonischen Systems, sondern mit
der Stilentwicklung der Fensterfüllung der Fensternische,
die wir nicht wie herkömmlich unter den hervorragenden
Werken des Handwerks verzeichnet finden.
Die Notwendigkeit der Fensterentwicklung vom kunst-
historischen Aspekt zu kennen zeigt sich immer dann, wenn
man zur Denkmalerneuerung eines architektonischen Wer-
kes herantreten soll. Zu den allgemein gültigen Erkennt-
nissen will die vorgelegte Abhandlung mit einigen konkre-
ten Beispielen aus praktischen Forschungsergebnissen bei-
tragen, die die Gesamtsicht auf die historische Entwicklung
des Fensters im Gebiete der Slowakei ergänzt.
Es ist bekannt, dass die Anwendung der Fenstervergla-
sung sich erst im 3. und 4. Jahrhundert unserer Zeitrech-
nung verbreitete. Jedoch wurde bis ins 14. Jahrhundert die
Fensterverglasung lediglich an königlichen Bauten, an
Palais hoher Würdenträger und an kultischen Gebäuden
angewendet. In Bratislava finden wir schon im Jahre 1434
Erwähnung darüber, dass dals Haus des Stadthänkeris ver-
glaste Fenster hatte, obzwar wir wissen, dass z. B. die
Fenster des erzbischöflichen Palais in Esztergom noch im
Jahre 1520 Leinen und Pergament ausfüllten. Eine ganze
Reihe weiterer Nachrichten informieren uns, dass im 15.
Jahrhundert in verhältnismässig breitem Ausmass Fenster
bei uns verglast wurden. Diese Nachrichten berichten je-
doch nicht über die Verglasungsweise, über die Befestigung
und Gliederung der Fenster. Über den eigentlichen Aus-
druck des Fensters erfahren wir lediglich durch das Studium
von Bildermaterial. Mittelalterliche Malereien verzeichnen
oft bei der Gestaltung eines konkreten Raumes, in das eine
Begebenheit einkomponiert ist, Gegenstände aus dem Leben
der Umwelt. Häufig sind diese Gegenstände mit maximaler
Genauigkeit im Interesse der Vergegenwärtigung der Ge-
gebenheit gestaltet; die gewünschte Illusion des Raumes
wird dabei oft aus der Sicht eines geöffneten oder halb-
geöffneten Fensters dargestellt, an dem auch Details sicht-
bar sind. Als Beispiel können wir aus der tschechischen
Malerei die Verkündigung (nach 1460) im Besitz der Na-
tionalgalerie in Prag, das Werk Jan Van Eycks die Af<z-
donna des Kanzlers Rolin und an weiteren Werken an-
führen. An flämischen Malereien sehen wir Fenster deren
Verglasung im Oberteil festgehalten ist (farbig und durch-
sichtig — nicht farbig linsenhaft verglast), wobei 'der
Untereil einen Holzrahmen hat und sieh nach innen öffnet.