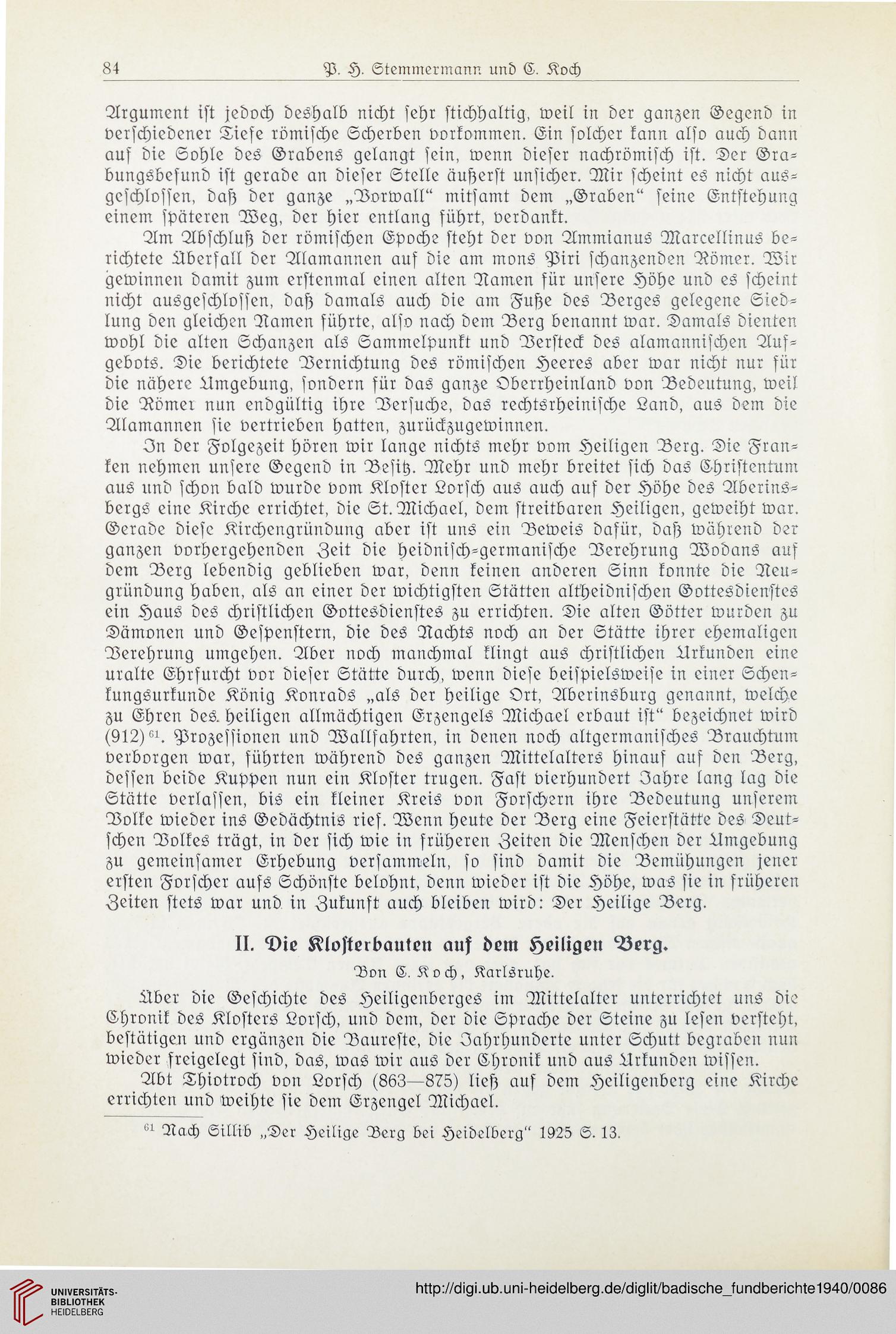84
P. H. Stemmermarin und C. Koch
Argument ist jedoch deshalb nicht sehr stichhaltig, weil in der ganzen Gegend in
verschiedener Tiefe römische Scherben Vorkommen. Ein solcher kann also auch dann
aus die Sohle des Grabens gelangt sein, wenn dieser nachrömisch ist. Der Gra-
bungsbesund ist gerade an dieser Stelle äußerst unsicher. Mir scheint es nicht aus-
geschlossen, daß der ganze „Vorwall" mitsamt dem „Graben" seine Entstehung
einem späteren Weg, der hier entlang führt, verdankt.
Am Abschluß der römischen Epoche steht der von Ammianus Marcellinus be-
richtete Äbersall der Alamannen aus die am mons Piri schanzenden Römer. Wir
gewinnen damit zum erstenmal einen alten Namen für unsere Höhe und es scheint
nicht ausgeschlossen, daß damals auch die am Fuße des Berges gelegene Sied-
lung den gleichen Namen führte, also nach dem Berg benannt war. Damals dienten
wohl die alten Schanzen als Sammelpunkt und Versteck des alamannischen Auf-
gebots. Die berichtete Vernichtung des römischen Heeres aber war nicht nur für
die nähere Umgebung, sondern für das ganze Oberrheinlanö von Bedeutung, weil
die Römer nun endgültig ihre Versuche, das rechtsrheinische Land, aus dem die
Alamannen sie vertrieben hatten, zurückzugewinnen.
In der Folgezeit hören wir lange nichts mehr vom Heiligen Berg. Die Fran-
ken nehmen unsere Gegend in Besitz. Mehr und mehr breitet sich das Christentum
aus und schon bald wurde vom Kloster Lorsch aus auch auf der Höhe des Aberins-
bergs eine Kirche errichtet, die St. Michael, dem streitbaren Heiligen, geweiht war.
Gerade diese Kirchengründung aber ist uns ein Beweis dafür, daß während der
ganzen vorhergehenden Zeit die heidnisch-germanische Verehrung Wodans aus
dem Berg lebendig geblieben war, denn keinen anderen Sinn konnte die Neu-
gründung haben, als an einer der wichtigsten Stätten altheidnischen Gottesdienstes
ein Haus des christlichen Gottesdienstes zu errichten. Die alten Götter wurden zu
Dämonen und Gespenstern, die des Nachts noch an der Stätte ihrer ehemaligen
Verehrung umgehen. Aber noch manchmal klingt aus christlichen Urkunden eine
uralte Ehrfurcht vor dieser Stätte durch, wenn diese beispielsweise in einer Schen-
kungsurkunde König Konrads „als der heilige Ort, Aberinsburg genannt, welche
zu Ehren des. heiligen allmächtigen Erzengels Michael erbaut ist" bezeichnet wird
(912)op Prozessionen und Wallfahrten, in denen noch altgermanisches Brauchtum
verborgen war, führten während des ganzen Mittelalters hinauf auf den Berg,
dessen beide Kuppen nun ein Kloster trugen. Fast vierhundert Iahre lang lag die
Stätte verlassen, bis ein kleiner Kreis von Forschern ihre Bedeutung unserem
Volke wieder ins Gedächtnis rief. Wenn heute der Berg eine Feierstätte des Deut-
schen Volkes trägt, in der sich wie in früheren Zeiten die Menschen der Umgebung
zu gemeinsamer Erhebung versammeln, so sind damit die Bemühungen jener
ersten Forscher aufs Schönste belohnt, denn wieder ist die Höhe, was sie in früheren
Zeiten stets war und in Zukunft auch bleiben wird: Der Heilige Berg.
II. Die Klosterbauten auf dem Heiligen Berg.
Bon C. Koch, Karlsruhe.
Aber die Geschichte des Heiligenberges im Mittelalter unterrichtet uns die
Chronik des Klosters Lorsch, und dem, der die Sprache der Steine zu lesen versteht,
bestätigen und ergänzen die Baureste, die Jahrhunderte unter Schutt begraben nun
wieder sreigelegt sind, das, was wir aus der Chronik und aus Urkunden wissen.
Abt Thiotroch von Lorsch (863—875) ließ auf dem Heiligenberg eine Kirche
errichten und weihte sie dem Erzengel Michael.
01 Nach Sillib „Der Heilige Berg bei Heidelberg" 1925 S. 13.
P. H. Stemmermarin und C. Koch
Argument ist jedoch deshalb nicht sehr stichhaltig, weil in der ganzen Gegend in
verschiedener Tiefe römische Scherben Vorkommen. Ein solcher kann also auch dann
aus die Sohle des Grabens gelangt sein, wenn dieser nachrömisch ist. Der Gra-
bungsbesund ist gerade an dieser Stelle äußerst unsicher. Mir scheint es nicht aus-
geschlossen, daß der ganze „Vorwall" mitsamt dem „Graben" seine Entstehung
einem späteren Weg, der hier entlang führt, verdankt.
Am Abschluß der römischen Epoche steht der von Ammianus Marcellinus be-
richtete Äbersall der Alamannen aus die am mons Piri schanzenden Römer. Wir
gewinnen damit zum erstenmal einen alten Namen für unsere Höhe und es scheint
nicht ausgeschlossen, daß damals auch die am Fuße des Berges gelegene Sied-
lung den gleichen Namen führte, also nach dem Berg benannt war. Damals dienten
wohl die alten Schanzen als Sammelpunkt und Versteck des alamannischen Auf-
gebots. Die berichtete Vernichtung des römischen Heeres aber war nicht nur für
die nähere Umgebung, sondern für das ganze Oberrheinlanö von Bedeutung, weil
die Römer nun endgültig ihre Versuche, das rechtsrheinische Land, aus dem die
Alamannen sie vertrieben hatten, zurückzugewinnen.
In der Folgezeit hören wir lange nichts mehr vom Heiligen Berg. Die Fran-
ken nehmen unsere Gegend in Besitz. Mehr und mehr breitet sich das Christentum
aus und schon bald wurde vom Kloster Lorsch aus auch auf der Höhe des Aberins-
bergs eine Kirche errichtet, die St. Michael, dem streitbaren Heiligen, geweiht war.
Gerade diese Kirchengründung aber ist uns ein Beweis dafür, daß während der
ganzen vorhergehenden Zeit die heidnisch-germanische Verehrung Wodans aus
dem Berg lebendig geblieben war, denn keinen anderen Sinn konnte die Neu-
gründung haben, als an einer der wichtigsten Stätten altheidnischen Gottesdienstes
ein Haus des christlichen Gottesdienstes zu errichten. Die alten Götter wurden zu
Dämonen und Gespenstern, die des Nachts noch an der Stätte ihrer ehemaligen
Verehrung umgehen. Aber noch manchmal klingt aus christlichen Urkunden eine
uralte Ehrfurcht vor dieser Stätte durch, wenn diese beispielsweise in einer Schen-
kungsurkunde König Konrads „als der heilige Ort, Aberinsburg genannt, welche
zu Ehren des. heiligen allmächtigen Erzengels Michael erbaut ist" bezeichnet wird
(912)op Prozessionen und Wallfahrten, in denen noch altgermanisches Brauchtum
verborgen war, führten während des ganzen Mittelalters hinauf auf den Berg,
dessen beide Kuppen nun ein Kloster trugen. Fast vierhundert Iahre lang lag die
Stätte verlassen, bis ein kleiner Kreis von Forschern ihre Bedeutung unserem
Volke wieder ins Gedächtnis rief. Wenn heute der Berg eine Feierstätte des Deut-
schen Volkes trägt, in der sich wie in früheren Zeiten die Menschen der Umgebung
zu gemeinsamer Erhebung versammeln, so sind damit die Bemühungen jener
ersten Forscher aufs Schönste belohnt, denn wieder ist die Höhe, was sie in früheren
Zeiten stets war und in Zukunft auch bleiben wird: Der Heilige Berg.
II. Die Klosterbauten auf dem Heiligen Berg.
Bon C. Koch, Karlsruhe.
Aber die Geschichte des Heiligenberges im Mittelalter unterrichtet uns die
Chronik des Klosters Lorsch, und dem, der die Sprache der Steine zu lesen versteht,
bestätigen und ergänzen die Baureste, die Jahrhunderte unter Schutt begraben nun
wieder sreigelegt sind, das, was wir aus der Chronik und aus Urkunden wissen.
Abt Thiotroch von Lorsch (863—875) ließ auf dem Heiligenberg eine Kirche
errichten und weihte sie dem Erzengel Michael.
01 Nach Sillib „Der Heilige Berg bei Heidelberg" 1925 S. 13.