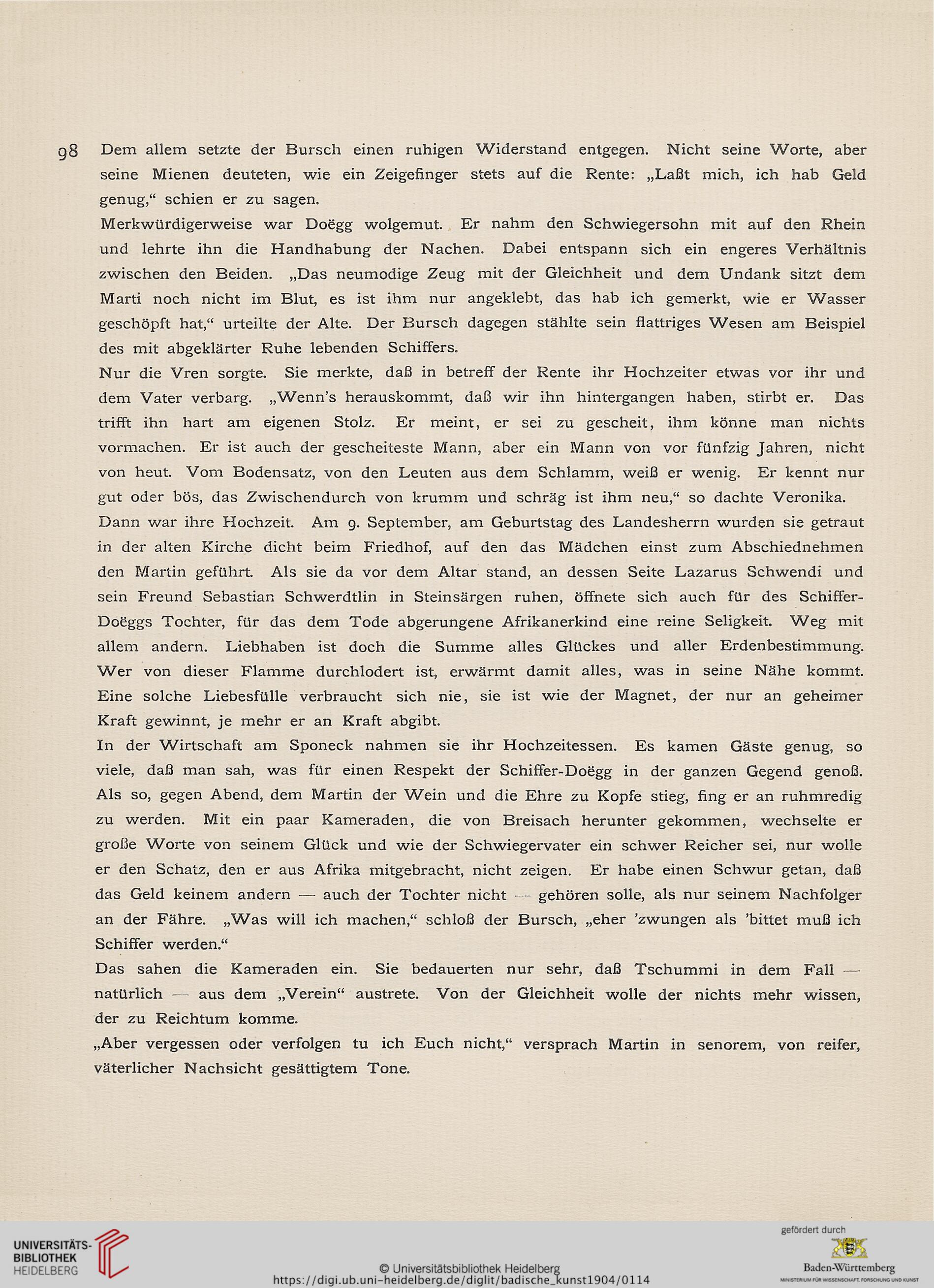98
Dem allem setzte der Bursch einen ruhigen Widerstand entgegen. Nicht seine Worte, aber
seine Mienen deuteten, wie ein Zeigefinger stets auf die Rente: „Laßt mich, ich hab Geld
genug,“ schien er zu sagen.
Merkwürdigerweise war Doegg wolgemut. Er nahm den Schwiegersohn mit auf den Rhein
und lehrte ihn die Handhabung der Nachen. Dabei entspann sich ein engeres Verhältnis
zwischen den Beiden. „Das neumodige Zeug mit der Gleichheit und dem Undank sitzt dem
Marti noch nicht im Blut, es ist ihm nur angeklebt, das hab ich gemerkt, wie er Wasser
geschöpft hat,“ urteilte der Alte. Der Bursch dagegen stählte sein flattriges Wesen am Beispiel
des mit abgeklärter Ruhe lebenden Schiffers.
Nur die Vren sorgte. Sie merkte, daß in betreff der Rente ihr Hochzeiter etwas vor ihr und
dem Vater verbarg. „Wenn’s herauskommt, daß wir ihn hintergangen haben, stirbt er. Das
trifft ihn hart am eigenen Stolz. Er meint, er sei zu gescheit, ihm könne man nichts
vormachen. Er ist auch der gescheiteste Mann, aber ein Mann von vor fünfzig Jahren, nicht
von heut. Vom Bodensatz, von den Leuten aus dem Schlamm, weiß er wenig. Er kennt nur
gut oder bös, das Zwischendurch von krumm und schräg ist ihm neu,“ so dachte Veronika.
Dann war ihre Hochzeit. Am g. September, am Geburtstag des Landesherrn wurden sie getraut
in der alten Kirche dicht beim Friedhof, auf den das Mädchen einst zum Abschiednehmen
den Martin geführt. Als sie da vor dem Altar stand, an dessen Seite Lazarus Schwendi und
sein Freund Sebastian Schwerdtlin in Steinsärgen ruhen, öffnete sich auch für des Schiffer-
Doeggs Tochter, für das dem Tode abgerungene Afrikanerkind eine reine Seligkeit. Weg mit
allem andern. Liebhaben ist doch die Summe alles Glückes und aller Erdenbestimmung.
Wer von dieser Flamme durchlodert ist, erwärmt damit alles, was in seine Nähe kommt.
Eine solche Liebesfülle verbraucht sich nie, sie ist wie der Magnet, der nur an geheimer
Kraft gewinnt, je mehr er an Kraft abgibt.
In der Wirtschaft am Sponeck nahmen sie ihr Hochzeitessen. Es kamen Gäste genug, so
viele, daß man sah, was für einen Respekt der Schiffer-Doegg in der ganzen Gegend genoß.
Als so, gegen Abend, dem Martin der Wein und die Ehre zu Kopfe stieg, fing er an ruhmredig
zu werden. Mit ein paar Kameraden, die von Breisach herunter gekommen, wechselte er
große Worte von seinem Glück und wie der Schwiegervater ein schwer Reicher sei, nur wolle
er den Schatz, den er aus Afrika mitgebracht, nicht zeigen. Er habe einen Schwur getan, daß
das Geld keinem andern — auch der Tochter nicht — gehören solle, als nur seinem Nachfolger
an der Fähre. „Was will ich machen,“ schloß der Bursch, „eher ’zwungen als 'bittet muß ich
Schiffer werden.“
Das sahen die Kameraden ein. Sie bedauerten nur sehr, daß Tschummi in dem Fall —
natürlich — aus dem „Verein“ austrete. Von der Gleichheit wolle der nichts mehr wissen,
der zu Reichtum komme.
„Aber vergessen oder verfolgen tu ich Euch nicht,“ versprach Martin in senorem, von reifer,
väterlicher Nachsicht gesättigtem Tone.
Dem allem setzte der Bursch einen ruhigen Widerstand entgegen. Nicht seine Worte, aber
seine Mienen deuteten, wie ein Zeigefinger stets auf die Rente: „Laßt mich, ich hab Geld
genug,“ schien er zu sagen.
Merkwürdigerweise war Doegg wolgemut. Er nahm den Schwiegersohn mit auf den Rhein
und lehrte ihn die Handhabung der Nachen. Dabei entspann sich ein engeres Verhältnis
zwischen den Beiden. „Das neumodige Zeug mit der Gleichheit und dem Undank sitzt dem
Marti noch nicht im Blut, es ist ihm nur angeklebt, das hab ich gemerkt, wie er Wasser
geschöpft hat,“ urteilte der Alte. Der Bursch dagegen stählte sein flattriges Wesen am Beispiel
des mit abgeklärter Ruhe lebenden Schiffers.
Nur die Vren sorgte. Sie merkte, daß in betreff der Rente ihr Hochzeiter etwas vor ihr und
dem Vater verbarg. „Wenn’s herauskommt, daß wir ihn hintergangen haben, stirbt er. Das
trifft ihn hart am eigenen Stolz. Er meint, er sei zu gescheit, ihm könne man nichts
vormachen. Er ist auch der gescheiteste Mann, aber ein Mann von vor fünfzig Jahren, nicht
von heut. Vom Bodensatz, von den Leuten aus dem Schlamm, weiß er wenig. Er kennt nur
gut oder bös, das Zwischendurch von krumm und schräg ist ihm neu,“ so dachte Veronika.
Dann war ihre Hochzeit. Am g. September, am Geburtstag des Landesherrn wurden sie getraut
in der alten Kirche dicht beim Friedhof, auf den das Mädchen einst zum Abschiednehmen
den Martin geführt. Als sie da vor dem Altar stand, an dessen Seite Lazarus Schwendi und
sein Freund Sebastian Schwerdtlin in Steinsärgen ruhen, öffnete sich auch für des Schiffer-
Doeggs Tochter, für das dem Tode abgerungene Afrikanerkind eine reine Seligkeit. Weg mit
allem andern. Liebhaben ist doch die Summe alles Glückes und aller Erdenbestimmung.
Wer von dieser Flamme durchlodert ist, erwärmt damit alles, was in seine Nähe kommt.
Eine solche Liebesfülle verbraucht sich nie, sie ist wie der Magnet, der nur an geheimer
Kraft gewinnt, je mehr er an Kraft abgibt.
In der Wirtschaft am Sponeck nahmen sie ihr Hochzeitessen. Es kamen Gäste genug, so
viele, daß man sah, was für einen Respekt der Schiffer-Doegg in der ganzen Gegend genoß.
Als so, gegen Abend, dem Martin der Wein und die Ehre zu Kopfe stieg, fing er an ruhmredig
zu werden. Mit ein paar Kameraden, die von Breisach herunter gekommen, wechselte er
große Worte von seinem Glück und wie der Schwiegervater ein schwer Reicher sei, nur wolle
er den Schatz, den er aus Afrika mitgebracht, nicht zeigen. Er habe einen Schwur getan, daß
das Geld keinem andern — auch der Tochter nicht — gehören solle, als nur seinem Nachfolger
an der Fähre. „Was will ich machen,“ schloß der Bursch, „eher ’zwungen als 'bittet muß ich
Schiffer werden.“
Das sahen die Kameraden ein. Sie bedauerten nur sehr, daß Tschummi in dem Fall —
natürlich — aus dem „Verein“ austrete. Von der Gleichheit wolle der nichts mehr wissen,
der zu Reichtum komme.
„Aber vergessen oder verfolgen tu ich Euch nicht,“ versprach Martin in senorem, von reifer,
väterlicher Nachsicht gesättigtem Tone.