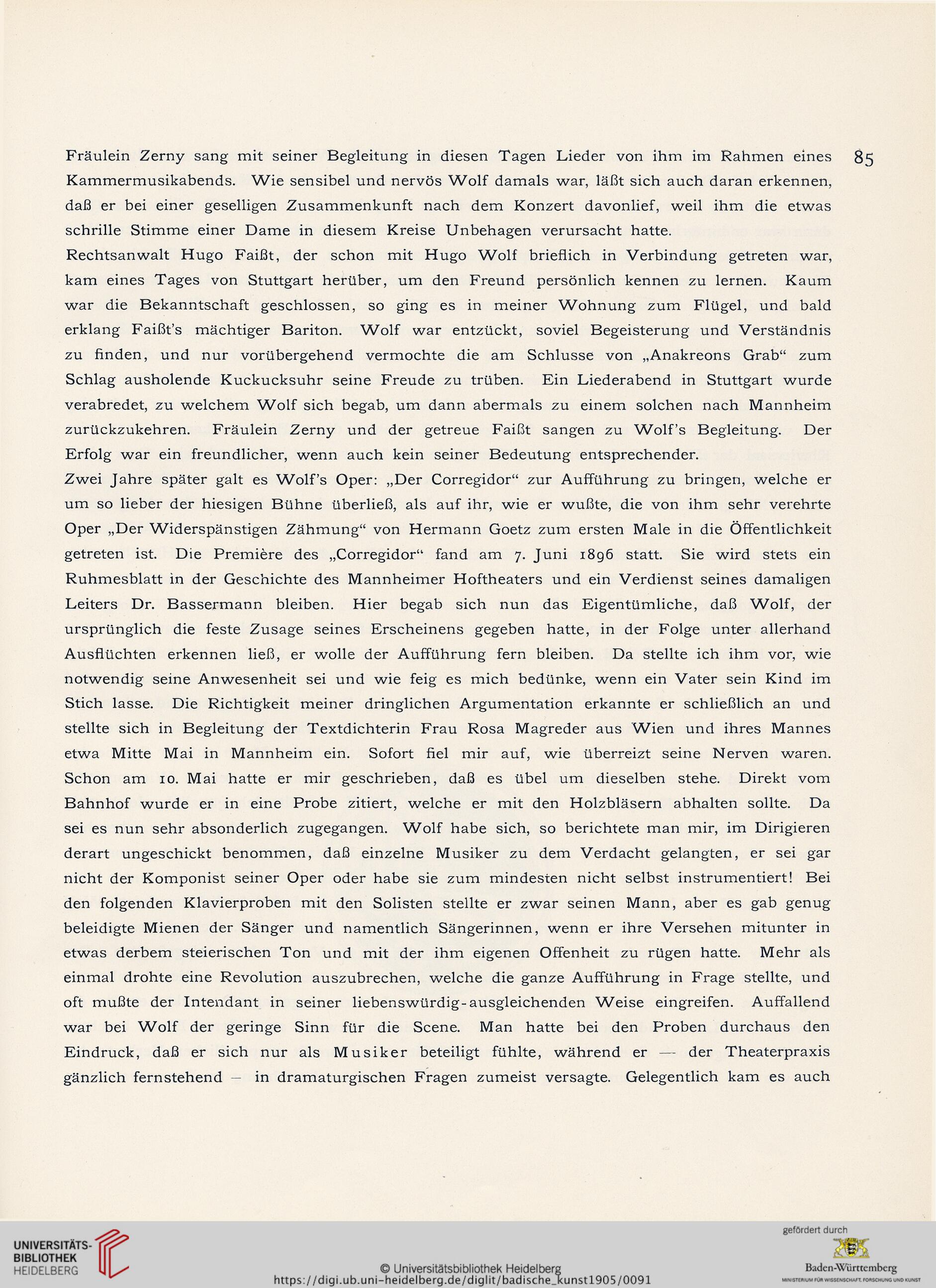Fräulein Zerny sang mit seiner Begleitung in diesen Tagen Lieder von ihm im Rahmen eines
Kammermusikabends. Wie sensibel und nervös Wolf damals war, läßt sich auch daran erkennen,
daß er bei einer geselligen Zusammenkunft nach dem Konzert davonlief, weil ihm die etwas
schrille Stimme einer Dame in diesem Kreise Unbehagen verursacht hatte.
Rechtsanwalt Hugo Faißt, der schon mit Hugo Wolf brieflich in Verbindung getreten war,
kam eines Tages von Stuttgart herüber, um den Freund persönlich kennen zu lernen. Kaum
war die Bekanntschaft geschlossen, so ging es in meiner Wohnung zum Flügel, und bald
erklang Faißt’s mächtiger Bariton. Wolf war entzückt, soviel Begeisterung und Verständnis
zu finden, und nur vorübergehend vermochte die am Schlüsse von „Anakreons Grab“ zum
Schlag ausholende Kuckucksuhr seine Freude zu trüben. Ein Liederabend in Stuttgart wurde
verabredet, zu welchem Wolf sich begab, um dann abermals zu einem solchen nach Mannheim
zurückzukehren. Fräulein Zerny und der getreue Faißt sangen zu Wolf’s Begleitung. Der
Erfolg war ein freundlicher, wenn auch kein seiner Bedeutung entsprechender.
Zwei Jahre später galt es Wolf’s Oper: „Der Corregidor“ zur Aufführung zu bringen, welche er
um so lieber der hiesigen Bühne überließ, als auf ihr, wie er wußte, die von ihm sehr verehrte
Oper „Der Widerspänstigen Zähmung“ von Hermann Goetz zum ersten Male in die Öffentlichkeit
getreten ist. Die Premiere des „Corregidor“ fand am 7. Juni 1896 statt. Sie wird stets ein
Ruhmesblatt in der Geschichte des Mannheimer Hoftheaters und ein Verdienst seines damaligen
Leiters Dr. Bassermann bleiben. Hier begab sich nun das Eigentümliche, daß Wolf, der
ursprünglich die feste Zusage seines Erscheinens gegeben hatte, in der Folge unter allerhand
Ausflüchten erkennen ließ, er wolle der Aufführung fern bleiben. Da stellte ich ihm vor, wie
notwendig seine Anwesenheit sei und wie feig es mich bedünke, wenn ein Vater sein Kind im
Stich lasse. Die Richtigkeit meiner dringlichen Argumentation erkannte er schließlich an und
stellte sich in Begleitung der Textdichterin Frau Rosa Magreder aus Wien und ihres Mannes
etwa Mitte Mai in Mannheim ein. Sofort fiel mir auf, wie überreizt seine Nerven waren.
Schon am 10. Mai hatte er mir geschrieben, daß es übel um dieselben stehe. Direkt vom
Bahnhof wurde er in eine Probe zitiert, welche er mit den Holzbläsern abhalten sollte. Da
sei es nun sehr absonderlich zugegangen. Wolf habe sich, so berichtete man mir, im Dirigieren
derart ungeschickt benommen, daß einzelne Musiker zu dem Verdacht gelangten, er sei gar
nicht der Komponist seiner Oper oder habe sie zum mindesten nicht selbst instrumentiert! Bei
den folgenden Klavierproben mit den Solisten stellte er zwar seinen Mann, aber es gab genug
beleidigte Mienen der Sänger und namentlich Sängerinnen, wenn er ihre Versehen mitunter in
etwas derbem steierischen Ton und mit der ihm eigenen Offenheit zu rügen hatte. Mehr als
einmal drohte eine Revolution auszubrechen, welche die ganze Aufführung in Frage stellte, und
oft mußte der Intendant in seiner liebenswürdig-ausgleichenden Weise eingreifen. Auffallend
war bei Wolf der geringe Sinn für die Scene. Man hatte bei den Proben durchaus den
Eindruck, daß er sich nur als Musiker beteiligt fühlte, während er — der Theaterpraxis
gänzlich fernstehend — in dramaturgischen Fragen zumeist versagte. Gelegentlich kam es auch
85
Kammermusikabends. Wie sensibel und nervös Wolf damals war, läßt sich auch daran erkennen,
daß er bei einer geselligen Zusammenkunft nach dem Konzert davonlief, weil ihm die etwas
schrille Stimme einer Dame in diesem Kreise Unbehagen verursacht hatte.
Rechtsanwalt Hugo Faißt, der schon mit Hugo Wolf brieflich in Verbindung getreten war,
kam eines Tages von Stuttgart herüber, um den Freund persönlich kennen zu lernen. Kaum
war die Bekanntschaft geschlossen, so ging es in meiner Wohnung zum Flügel, und bald
erklang Faißt’s mächtiger Bariton. Wolf war entzückt, soviel Begeisterung und Verständnis
zu finden, und nur vorübergehend vermochte die am Schlüsse von „Anakreons Grab“ zum
Schlag ausholende Kuckucksuhr seine Freude zu trüben. Ein Liederabend in Stuttgart wurde
verabredet, zu welchem Wolf sich begab, um dann abermals zu einem solchen nach Mannheim
zurückzukehren. Fräulein Zerny und der getreue Faißt sangen zu Wolf’s Begleitung. Der
Erfolg war ein freundlicher, wenn auch kein seiner Bedeutung entsprechender.
Zwei Jahre später galt es Wolf’s Oper: „Der Corregidor“ zur Aufführung zu bringen, welche er
um so lieber der hiesigen Bühne überließ, als auf ihr, wie er wußte, die von ihm sehr verehrte
Oper „Der Widerspänstigen Zähmung“ von Hermann Goetz zum ersten Male in die Öffentlichkeit
getreten ist. Die Premiere des „Corregidor“ fand am 7. Juni 1896 statt. Sie wird stets ein
Ruhmesblatt in der Geschichte des Mannheimer Hoftheaters und ein Verdienst seines damaligen
Leiters Dr. Bassermann bleiben. Hier begab sich nun das Eigentümliche, daß Wolf, der
ursprünglich die feste Zusage seines Erscheinens gegeben hatte, in der Folge unter allerhand
Ausflüchten erkennen ließ, er wolle der Aufführung fern bleiben. Da stellte ich ihm vor, wie
notwendig seine Anwesenheit sei und wie feig es mich bedünke, wenn ein Vater sein Kind im
Stich lasse. Die Richtigkeit meiner dringlichen Argumentation erkannte er schließlich an und
stellte sich in Begleitung der Textdichterin Frau Rosa Magreder aus Wien und ihres Mannes
etwa Mitte Mai in Mannheim ein. Sofort fiel mir auf, wie überreizt seine Nerven waren.
Schon am 10. Mai hatte er mir geschrieben, daß es übel um dieselben stehe. Direkt vom
Bahnhof wurde er in eine Probe zitiert, welche er mit den Holzbläsern abhalten sollte. Da
sei es nun sehr absonderlich zugegangen. Wolf habe sich, so berichtete man mir, im Dirigieren
derart ungeschickt benommen, daß einzelne Musiker zu dem Verdacht gelangten, er sei gar
nicht der Komponist seiner Oper oder habe sie zum mindesten nicht selbst instrumentiert! Bei
den folgenden Klavierproben mit den Solisten stellte er zwar seinen Mann, aber es gab genug
beleidigte Mienen der Sänger und namentlich Sängerinnen, wenn er ihre Versehen mitunter in
etwas derbem steierischen Ton und mit der ihm eigenen Offenheit zu rügen hatte. Mehr als
einmal drohte eine Revolution auszubrechen, welche die ganze Aufführung in Frage stellte, und
oft mußte der Intendant in seiner liebenswürdig-ausgleichenden Weise eingreifen. Auffallend
war bei Wolf der geringe Sinn für die Scene. Man hatte bei den Proben durchaus den
Eindruck, daß er sich nur als Musiker beteiligt fühlte, während er — der Theaterpraxis
gänzlich fernstehend — in dramaturgischen Fragen zumeist versagte. Gelegentlich kam es auch
85