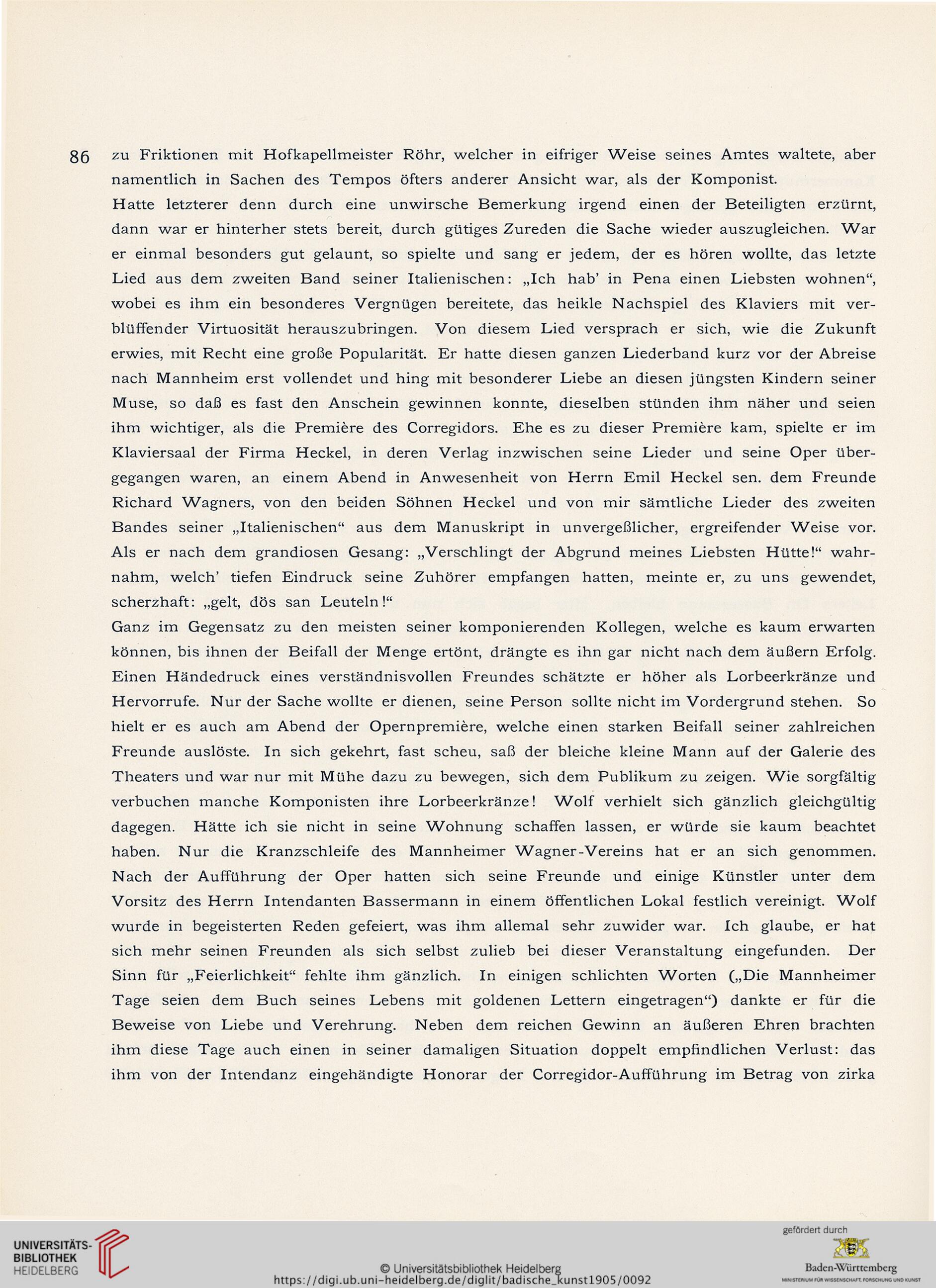86 zu Friktionen mit Hofkapellmeister Röhr, welcher in eifriger Weise seines Amtes waltete, aber
namentlich in Sachen des Tempos öfters anderer Ansicht war, als der Komponist.
Hatte letzterer denn durch eine unwirsche Bemerkung irgend einen der Beteiligten erzürnt,
dann war er hinterher stets bereit, durch gütiges Zureden die Sache wieder auszugleichen. War
er einmal besonders gut gelaunt, so spielte und sang er jedem, der es hören wollte, das letzte
Lied aus dem zweiten Band seiner Italienischen: „Ich hab’ in Pena einen Liebsten wohnen“,
wobei es ihm ein besonderes Vergnügen bereitete, das heikle Nachspiel des Klaviers mit ver-
blüffender Virtuosität herauszubringen. Von diesem Lied versprach er sich, wie die Zukunft
erwies, mit Recht eine große Popularität. Er hatte diesen ganzen Liederband kurz vor der Abreise
nach Mannheim erst vollendet und hing mit besonderer Liebe an diesen jüngsten Kindern seiner
Muse, so daß es fast den Anschein gewinnen konnte, dieselben stünden ihm näher und seien
ihm wichtiger, als die Premiere des Corregidors. Ehe es zu dieser Premiere kam, spielte er im
Klaviersaal der Firma Heckel, in deren Verlag inzwischen seine Lieder und seine Oper über-
gegangen waren, an einem Abend in Anwesenheit von Herrn Emil Heckel sen. dem Freunde
Richard Wagners, von den beiden Söhnen Heckel und von mir sämtliche Lieder des zweiten
Bandes seiner „Italienischen“ aus dem Manuskript in unvergeßlicher, ergreifender Weise vor.
Als er nach dem grandiosen Gesang: „Verschlingt der Abgrund meines Liebsten Hütte!“ wahr-
nahm, welch’ tiefen Eindruck seine Zuhörer empfangen hatten, meinte er, zu uns gewendet,
scherzhaft: „gelt, dös san Leuteln!“
Ganz im Gegensatz zu den meisten seiner komponierenden Kollegen, welche es kaum erwarten
können, bis ihnen der Beifall der Menge ertönt, drängte es ihn gar nicht nach dem äußern Erfolg.
Einen Händedruck eines verständnisvollen Freundes schätzte er höher als Lorbeerkränze und
Hervorrufe. Nur der Sache wollte er dienen, seine Person sollte nicht im Vordergrund stehen. So
hielt er es auch am Abend der Opernpremiere, welche einen starken Beifall seiner zahlreichen
Freunde auslöste. In sich gekehrt, fast scheu, saß der bleiche kleine Mann auf der Galerie des
Theaters und war nur mit Mühe dazu zu bewegen, sich dem Publikum zu zeigen. Wie sorgfältig
verbuchen manche Komponisten ihre Lorbeerkränze! Wolf verhielt sich gänzlich gleichgültig
dagegen. Hätte ich sie nicht in seine Wohnung schaffen lassen, er würde sie kaum beachtet
haben. Nur die Kranzschleife des Mannheimer Wagner-Vereins hat er an sich genommen.
Nach der Aufführung der Oper hatten sich seine Freunde und einige Künstler unter dem
Vorsitz des Herrn Intendanten Bassermann in einem öffentlichen Lokal festlich vereinigt. Wolf
wurde in begeisterten Reden gefeiert, was ihm allemal sehr zuwider war. Ich glaube, er hat
sich mehr seinen Freunden als sich selbst zulieb bei dieser Veranstaltung eingefunden. Der
Sinn für „Feierlichkeit“ fehlte ihm gänzlich. In einigen schlichten Worten („Die Mannheimer
Tage seien dem Buch seines Lebens mit goldenen Lettern eingetragen“) dankte er für die
Beweise von Liebe und Verehrung. Neben dem reichen Gewinn an äußeren Ehren brachten
ihm diese Tage auch einen in seiner damaligen Situation doppelt empfindlichen Verlust: das
ihm von der Intendanz eingehändigte Honorar der Corregidor-Aufführung im Betrag von zirka
namentlich in Sachen des Tempos öfters anderer Ansicht war, als der Komponist.
Hatte letzterer denn durch eine unwirsche Bemerkung irgend einen der Beteiligten erzürnt,
dann war er hinterher stets bereit, durch gütiges Zureden die Sache wieder auszugleichen. War
er einmal besonders gut gelaunt, so spielte und sang er jedem, der es hören wollte, das letzte
Lied aus dem zweiten Band seiner Italienischen: „Ich hab’ in Pena einen Liebsten wohnen“,
wobei es ihm ein besonderes Vergnügen bereitete, das heikle Nachspiel des Klaviers mit ver-
blüffender Virtuosität herauszubringen. Von diesem Lied versprach er sich, wie die Zukunft
erwies, mit Recht eine große Popularität. Er hatte diesen ganzen Liederband kurz vor der Abreise
nach Mannheim erst vollendet und hing mit besonderer Liebe an diesen jüngsten Kindern seiner
Muse, so daß es fast den Anschein gewinnen konnte, dieselben stünden ihm näher und seien
ihm wichtiger, als die Premiere des Corregidors. Ehe es zu dieser Premiere kam, spielte er im
Klaviersaal der Firma Heckel, in deren Verlag inzwischen seine Lieder und seine Oper über-
gegangen waren, an einem Abend in Anwesenheit von Herrn Emil Heckel sen. dem Freunde
Richard Wagners, von den beiden Söhnen Heckel und von mir sämtliche Lieder des zweiten
Bandes seiner „Italienischen“ aus dem Manuskript in unvergeßlicher, ergreifender Weise vor.
Als er nach dem grandiosen Gesang: „Verschlingt der Abgrund meines Liebsten Hütte!“ wahr-
nahm, welch’ tiefen Eindruck seine Zuhörer empfangen hatten, meinte er, zu uns gewendet,
scherzhaft: „gelt, dös san Leuteln!“
Ganz im Gegensatz zu den meisten seiner komponierenden Kollegen, welche es kaum erwarten
können, bis ihnen der Beifall der Menge ertönt, drängte es ihn gar nicht nach dem äußern Erfolg.
Einen Händedruck eines verständnisvollen Freundes schätzte er höher als Lorbeerkränze und
Hervorrufe. Nur der Sache wollte er dienen, seine Person sollte nicht im Vordergrund stehen. So
hielt er es auch am Abend der Opernpremiere, welche einen starken Beifall seiner zahlreichen
Freunde auslöste. In sich gekehrt, fast scheu, saß der bleiche kleine Mann auf der Galerie des
Theaters und war nur mit Mühe dazu zu bewegen, sich dem Publikum zu zeigen. Wie sorgfältig
verbuchen manche Komponisten ihre Lorbeerkränze! Wolf verhielt sich gänzlich gleichgültig
dagegen. Hätte ich sie nicht in seine Wohnung schaffen lassen, er würde sie kaum beachtet
haben. Nur die Kranzschleife des Mannheimer Wagner-Vereins hat er an sich genommen.
Nach der Aufführung der Oper hatten sich seine Freunde und einige Künstler unter dem
Vorsitz des Herrn Intendanten Bassermann in einem öffentlichen Lokal festlich vereinigt. Wolf
wurde in begeisterten Reden gefeiert, was ihm allemal sehr zuwider war. Ich glaube, er hat
sich mehr seinen Freunden als sich selbst zulieb bei dieser Veranstaltung eingefunden. Der
Sinn für „Feierlichkeit“ fehlte ihm gänzlich. In einigen schlichten Worten („Die Mannheimer
Tage seien dem Buch seines Lebens mit goldenen Lettern eingetragen“) dankte er für die
Beweise von Liebe und Verehrung. Neben dem reichen Gewinn an äußeren Ehren brachten
ihm diese Tage auch einen in seiner damaligen Situation doppelt empfindlichen Verlust: das
ihm von der Intendanz eingehändigte Honorar der Corregidor-Aufführung im Betrag von zirka