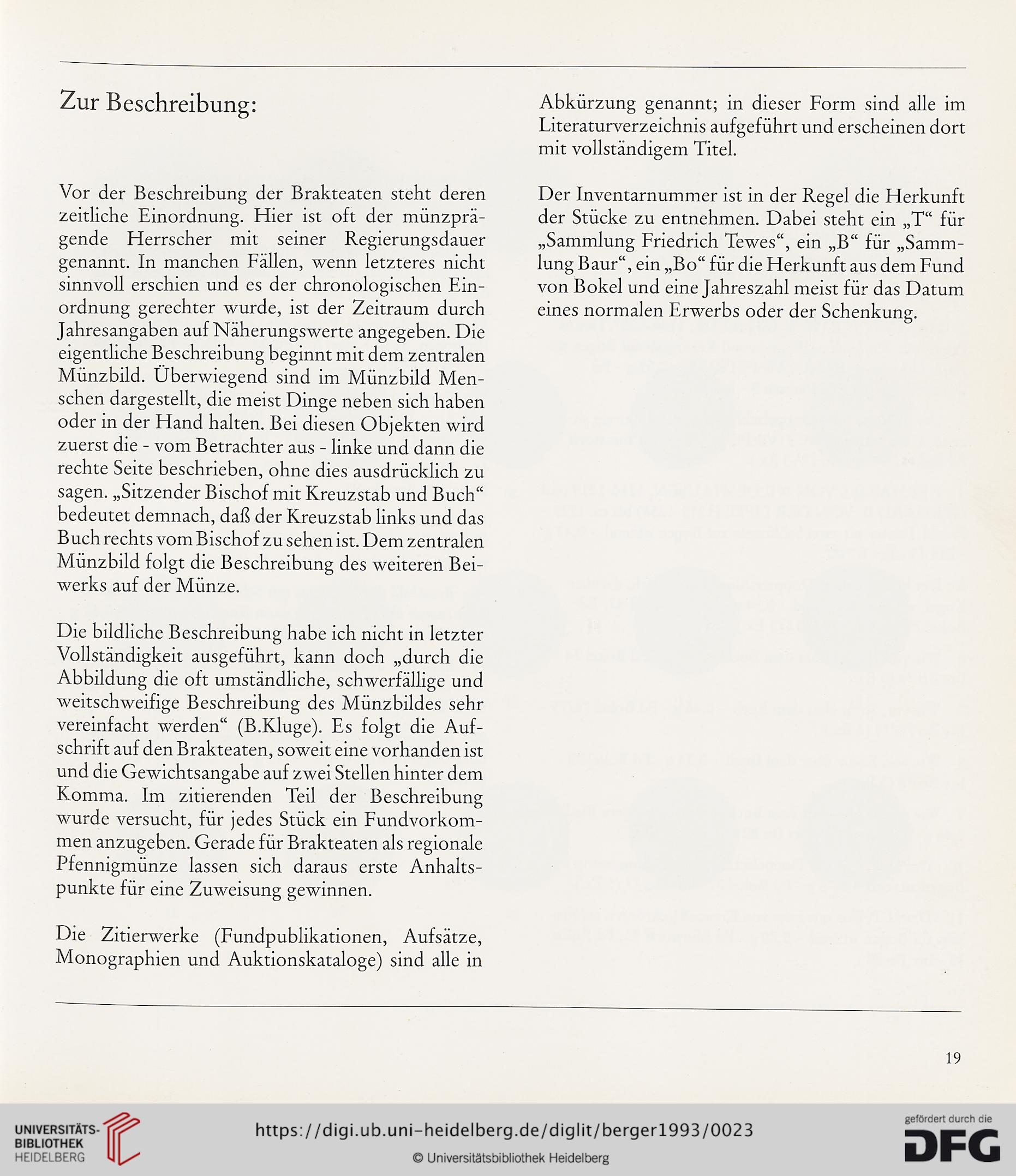Zur Beschreibung:
Vor der Beschreibung der Brakteaten steht deren
zeitliche Einordnung. Hier ist oft der münzprä-
gende Herrscher mit seiner Regierungsdauer
genannt. In manchen Fällen, wenn letzteres nicht
sinnvoll erschien und es der chronologischen Ein-
ordnung gerechter wurde, ist der Zeitraum durch
Jahresangaben auf Näherungswerte angegeben. Die
eigentliche Beschreibung beginnt mit dem zentralen
Münzbild. Überwiegend sind im Münzbild Men-
schen dargestellt, die meist Dinge neben sich haben
oder in der Hand halten. Bei diesen Objekten wird
zuerst die - vom Betrachter aus - linke und dann die
rechte Seite beschrieben, ohne dies ausdrücklich zu
sagen. „Sitzender Bischof mit Kreuzstab und Buch“
bedeutet demnach, daß der Kreuzstab links und das
Buch rechts vom Bischof zu sehen ist. Dem zentralen
Münzbild folgt die Beschreibung des weiteren Bei-
werks auf der Münze.
Die bildliche Beschreibung habe ich nicht in letzter
Vollständigkeit ausgeführt, kann doch „durch die
Abbildung die oft umständliche, schwerfällige und
weitschweifige Beschreibung des Münzbildes sehr
vereinfacht werden“ (B.Kluge). Es folgt die Auf-
schrift auf den Brakteaten, soweit eine vorhanden ist
und die Gewichtsangabe auf zwei Stellen hinter dem
Komma. Im zitierenden Teil der Beschreibung
wurde versucht, für jedes Stück ein Fundvorkom-
men anzugeben. Gerade für Brakteaten als regionale
Pfennigmünze lassen sich daraus erste Anhalts-
punkte für eine Zuweisung gewinnen.
Die Zitierwerke (Fundpublikationen, Aufsätze,
Monographien und Auktionskataloge) sind alle in
Abkürzung genannt; in dieser Form sind alle im
Literaturverzeichnis aufgeführt und erscheinen dort
mit vollständigem Titel.
Der Inventarnummer ist in der Regel die Herkunft
der Stücke zu entnehmen. Dabei steht ein „T“ für
„Sammlung Friedrich Tewes“, ein „B“ für „Samm-
lung Baur“, ein „Bo“ für die Herkunft aus dem Fund
von Bokel und eine Jahreszahl meist für das Datum
eines normalen Erwerbs oder der Schenkung.
19
Vor der Beschreibung der Brakteaten steht deren
zeitliche Einordnung. Hier ist oft der münzprä-
gende Herrscher mit seiner Regierungsdauer
genannt. In manchen Fällen, wenn letzteres nicht
sinnvoll erschien und es der chronologischen Ein-
ordnung gerechter wurde, ist der Zeitraum durch
Jahresangaben auf Näherungswerte angegeben. Die
eigentliche Beschreibung beginnt mit dem zentralen
Münzbild. Überwiegend sind im Münzbild Men-
schen dargestellt, die meist Dinge neben sich haben
oder in der Hand halten. Bei diesen Objekten wird
zuerst die - vom Betrachter aus - linke und dann die
rechte Seite beschrieben, ohne dies ausdrücklich zu
sagen. „Sitzender Bischof mit Kreuzstab und Buch“
bedeutet demnach, daß der Kreuzstab links und das
Buch rechts vom Bischof zu sehen ist. Dem zentralen
Münzbild folgt die Beschreibung des weiteren Bei-
werks auf der Münze.
Die bildliche Beschreibung habe ich nicht in letzter
Vollständigkeit ausgeführt, kann doch „durch die
Abbildung die oft umständliche, schwerfällige und
weitschweifige Beschreibung des Münzbildes sehr
vereinfacht werden“ (B.Kluge). Es folgt die Auf-
schrift auf den Brakteaten, soweit eine vorhanden ist
und die Gewichtsangabe auf zwei Stellen hinter dem
Komma. Im zitierenden Teil der Beschreibung
wurde versucht, für jedes Stück ein Fundvorkom-
men anzugeben. Gerade für Brakteaten als regionale
Pfennigmünze lassen sich daraus erste Anhalts-
punkte für eine Zuweisung gewinnen.
Die Zitierwerke (Fundpublikationen, Aufsätze,
Monographien und Auktionskataloge) sind alle in
Abkürzung genannt; in dieser Form sind alle im
Literaturverzeichnis aufgeführt und erscheinen dort
mit vollständigem Titel.
Der Inventarnummer ist in der Regel die Herkunft
der Stücke zu entnehmen. Dabei steht ein „T“ für
„Sammlung Friedrich Tewes“, ein „B“ für „Samm-
lung Baur“, ein „Bo“ für die Herkunft aus dem Fund
von Bokel und eine Jahreszahl meist für das Datum
eines normalen Erwerbs oder der Schenkung.
19