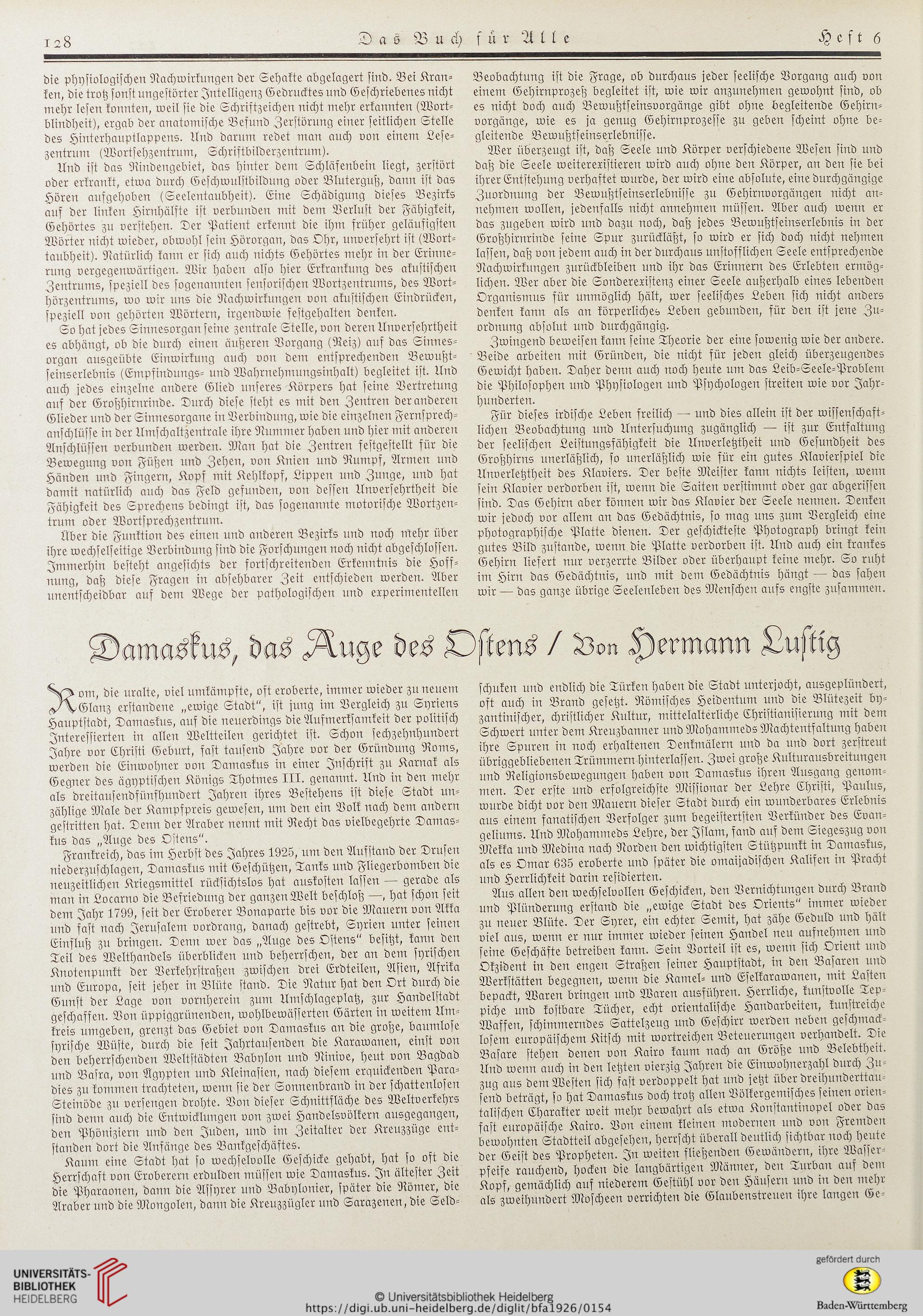1 28
Das. Bu ch. f ür Alle
Heſt 6
die physiologiſchen Nachwirkungen der Sehakte abgelagert ſind. Bei Kran-
ken, die trotß ſonſt ungestörter Intelligenz Gedrucktes und Geschriebenes nicht
mehr leſen konnten, weil ſie die Schriftzeichen nicht mehr erkannten (Wort-
blindheit), ergab der anatomische Befund Zerstörung einer seitlichen Stelle
des Hinterhauptlappens. Und darum redet man auch von einem Leſe-
zentrum (Wortsſehzentrum, Schriftbilderzentrum).
Und iſt das Rindengebiet, das hinter dem Schläfenbein liegt, zerstört
oder erkrankt, etwa durch Geſchwulſtbildung oder Bluterguß, dann iſt das
Hören aufgehoben (Seelentaubheit). Eine Schädigung dieses Bezirks
auf der linken Hirnhälfte iſt verbunden mit dem Verluſt der Fähigkeit,
Gehörtes zu verſtehen. Der Patient erkennt die ihm früher geläufigſten
Wörter nicht wieder, obwohl sein Hörorgan, das Ohr, unversehrt iſt (Wort-
taubheit). Natürlich kann er ſich auch nichts Gehörtes mehr in der Erinne-
rung vergegenwärtigen. Wir haben alſo hier Erkrankung des atuſtiſchen
Zentrums, speziell des ſogenannten ſenſoriſchen Wortzentrums, des Wort-
hörzentrums, wo wir uns die Nachwirkungen von akuſtiſchen Eindrücken,
ſpeziell von gehörten Wörtern, irgendwie feſtgehalten denten.
So hat jedes Sinnesorgan seine zentrale Stelle, von deren Unversehrtheit
es abhängt, ob die durch einen äußeren Vorgang (Reiz) auf das Sinnes-
organ ausgeübte Einwirkung auch von dem entſprechenden Bewujßt-
seinserlebnis (Empfindungs- und Wahrnehmundgsinhalt) begleitet iſt. Und
auch jedes einzelne andere Glied unſeres Körpers hat ſeine Vertretung
auf der Groſzhirnrinde. Durch diese ſteht es mit den Zentren der anderen
Glieder und der Sinnesorgane in Verbindung, wie die einzelnen Fernſprech-
anschlüsse in der Umſchaltzentrale ihre Nummer haben und hier mit anderen
Anschlüssen verbunden werden. Man hat die Zentren feſtgeſtellt für die
Bewegung von Füßen und Zehen, von Knien und Rumpf, Armen und
Händen und Fingern, Kopf mit Kehlkopf, Lippen und Zunge, und hat
damit natürlich auch das Feld gefunden, von dessen Unversehrtheit die
Fähigkeit des Sprechens bedingt iſt, das ſogenannte motoriſche Wortzen-
trum oder Wortſprechzentrum.
Über die Funktion des einen und anderen Bezirks und noch mehr über
ihre wechſelſeitige Verbindung ſind die Forſchungen noch nicht abgeschlossen.
Immerhin beſteht angesichts der fortſchreitenden Erkenntnis die Hoff-
nung, daß dieſe Fragen in absehbarer Zeit entſchieden werden. Aber
unentscheidbar auf dem Wege der pathologiſchen und experimentellen
Beobachtung isſt die Frage, ob durchaus jeder ſeeliſche Vorgang auch von
einem Gehirnprozeß begleitet iſt, wie wir anzunehmen gewohnt Jind, ob
es nicht doch auch Bewußtseinsvorgänge gibt ohne begleitende Gehirn-
vorgänge, wie es ja genug Gehirnprozeſſe zu geben ſcheint ohne be-
gleitende Bewußt9einserlebnise.
Wer überzeugt iſt, daß Seele und Körper verſchiedene Wesen ſind und
daß die Seele weiterexiſtieren wird auch ohne den Körper, an den Jie bei
ihrer Entſtehung verhastet wurde, der wird eine abſolute, eine durchgängige
Zuordnung der Bewußtſseinserlebniſſe zu Gehirnvorgängen nicht an-
nehmen wollen, jedenfalls nicht annehmen müssen. Aber auch wenn er
das zugeben wird und dazu noch, daß jedes Bewußtſeinserlebnis in der
Großhirnrinde seine Spur zurückläßt, so wird er ſich doch nicht nehmen
lassen, daß von jedem auch in der durchaus unſtofflichen Seele entſprechende
Nachwirkungen zurückbleiben und ihr das Erinnern des Erlebten ermög-
lichen. Wer aber die Sonderexiſtenz einer Seele außerhalb eines lebenden
Organismus für unmöglich hält, wer ſeeliſches Leben Jich nicht anders
denken kann als an körperliches Leben gebunden, für den iſt jene Zu-
ordnung absolut und durchgängig.
Zwingend beweisen kann seine Theorie der eine ſowenig wie der andere.
Beide arbeiten mit Gründen, die nicht für jeden gleich überzeugendes
Gewicht haben. Daher denn auch noch heute um das Leib-Seele-Problem
hie Philoſophen und Physiologen und Pſychologen ſtreiten wie vor Jahr-
underten.
Für dieses irdiſche Leben freilich + und dies allein iſt der wissenschaft-
lichen Beobachtung und Unterſuchung zugänglich = iſt zur Entfaltung
der seeliſchen Leiſtungsfähigkeit die Unverletztheit und Geſundheit des
Großhirns unerläßlich, so unerläßlich wie für ein gutes Klavierspiel die
Uwverletztheit des Klaviers. Der besſte Meiſter kann nichts leiſten, wenn
sein Klavier verdorben iſt, wenn die Saiten verſtimmt oder gar abgeriſſen
ſind. Das Gehirn aber können wir das Klavier der Seele nennen. Denken
wir jedoch vor allem an das Gedächtnis, ſo mag uns zum Vergleich eine
photographische Platte dienen. Der geſchickteſte Photograph bringt kein
gutes Bild zuſtande, wenn die Platte verdorben iſt. Und auch ein krankes
Gehirn liefert nur verzerrte Bilder oder überhaupt keine mehr. So ruht
im Hirn das Gedächtnis, und mit dem Gedächtnis hängt + das ſahen
wir –~ das ganze übrige Seelenleben des Menſchen aufs engste zuſammen.
Damaskus, das Ange des Oſtens / Von Hermann Uuſtig
N: die uralte, viel umkämpfte, ost eroberte, immer wieder zuneuem
Glanz erſtandene „ewige Stadt", iſt jung im Vergleich zu Syriens
Hauptſtadt, Damaskus, auf die neuerdings die Aufmerkſamteit der politiſch
Interessierten in allen Weltteilen gerichtet iſt. Schon ſechzehnhundert
Jahre vor Chriſti Geburt, faſt tauſend Jahre vor der Gründung Roms,
werden die Einwohner von Damaskus in einer Inſchrift zu Karnak als
Gegner des ägyptiſchen Königs Thotmes II. genannt. Und in den mehr
als dreitauſendfünfhundert Jahren ihres Beſtehens iſt dieſe Stadt un-
zählige Male der Kampfpreis geweſen, um den ein Volk nach dem andern
geſlritten hat. Denn der Araber nennt mit Recht das vielbegehrte Damas-
kus das „Auge des Oſtens".
Frankreich, das im Herbſt des Jahres 1925, um den Aufstand der Druſen
niederzuſchlagen, Damaskus mit Geſchützen, Tanks und Fliegerbomben die
neuzeitlichen Kriegsmittel rückſichtslos hat auskosten laſſen + gerade als
man in Locarno die Befriedung der ganzen Welt beſchloß , hat ſchon seit
dem Jahr 1799, seit der Eroberer Bonaparte bis vor die Mauern von Akka
und faſt nach Jeruſalem vordrang, danach geſtrebt, Syrien unter seinen
Einfluß zu bringen. Denn wer das „Auge des Ostens" besitzt, kann den
Teil des Welthandels überblicken und beherrſchen, der an dem ſyriſchen
Knotenpunkt der Verkehrſtraßen zwiſchen drei Erdteilen, Mien, Afrika
und Europa, seit jeher in Blüte ſtand. Die Natur hat den Ort durch die
Gunst der Lage von vornherein zum Umſchlageplat, zur Handelſtadt
geschaffen. Von üppiggrünenden, wohlbewässerten Gärten in weitem Um-
kreis umgeben, grenzt das Gebiet von Damaskus an die große, baumloſe
ſyriſche Wüſte, durch die ſeit Jahrtauſenden die Karawanen, einſt von
den beherrſchenden Weltſtädten Babylon und Ninive, heut von Bagdad
und Baſra, von Ägypten und RKleinqaJien, nach dieſem erquickenden Para-
dies zu kommen trachteten, wenn Jie der Sonnenbrand in der ſchattenloſen
Steinöde zu versſengen drohte. Von dieser Schnittfläche des Weltverkehrs
ſind denn auch die Entwicklungen von zwei Handelsvölkern ausgegangen,
den Phöniziern und den Juden, und im Zeitalter der Kreuzzüge ent-
ſtanden dort die Anfänge des Bantgeſchäsſtes.
Kaum eine Stadt hat ſo wechſelvolle Geschicke gehabt, hat ſo oft die
Herrſchaft von Eroberern erdulden müſſen wie Damaskus. In älteſter Zeit
die Pharaonen, dann die Aſſyrer und Babylonier, später die Römer, die
Araber und die Mongolen, dann die Kreuzzügler und Sarazenen, die Seld-
ſchuken und endlich die Türken haben die Stadt unterjocht, ausgeplündert,
oft auch in Brand gesetzt. Römiſches Heidentum und die Blütezeit by-
zantinischer, christlicher Kultur, mittelalterliche Chriſtianiſierung mit dem
Schwert unter dem Kreuzbanner und Mohammeds Machtentfaltung haben
ihre Spuren in noch erhaltenen Denkmälern und da und dort zerſtreut
übriggebliebenen Trümmern hinterlassen. Zwei große Kulturausbreitungen
und Religionsbewegungen haben von Damaskus ihren Ausgang genom-
men. Der erſte und erfolgreichſte Miſſionar der Lehre Christi, Paulus,
wurde dicht vor den Mauern dieſer Stadt durch ein wunderbares Erlebnis
aus einem fanatiſchen Verfolger zum begeisſtertſten Verkünder des Evan-
geliums. Und Mohammeds Lehre, der Iſlam, fand auf dem Siegeszug von
Mekka und Medina nach Norden den wichtigſten Stützpunkt in Damaskus,
als es Omar 635 eroberte und später die omaijadiſchen Kalifen in Pracht
und Herrlichkeit darin reſidierten.
Aus allen den wechselvollen Geschicken, den Vernichtungen durch Brand
und Plünderung erſtand die „ewige Stadt des Orients" immer wieder
zu neuer Blüte. Der Syrer, ein echter Semit, hat zähe Geduld und hält
viel aus, wenn er nur immer wieder ſeinen Handel neu aufnehmen und
seine Geschäfte betreiben kann. Sein Vorteil iſt es, wenn sich Orient und
Okzident in den engen Straßen ſeiner Hauptſtadt, in den Baſaren und
Werkstätten begegnen, wenn die Kamel- und Eselkarawanen, mit Laſten
bepackt, Waren bringen und Waren ausführen. Herrliche, kunſtvolle Tep-
piche und kostbare Tücher, echt orientaliſche Handarbeiten, kunſtreiche
Waffen, ſchimmerndes Sattelzeug und Geschirr werden neben geſchmack-
loſem europäischem Kitſch mit wortreichen Beteuerungen verhandelt. Die
Basare stehen denen von Kairo kaum nach an Größe und Belebtheit.
Und wenn auch in den letzten vierzig Jahren die Einwohnerzahl durch Zu-
zug aus dem Westen Jich faſt verdoppelt hat und jetzt über dreihunderttau-
send beträgt, ſo hat Damaskus doch trotz allen Völkergemiſches ſeinen orien-
taliſchen Charakter weit mehr bewahrt als etwa Konstantinopel oder das
faſt europäische Kairo. Von einem kleinen modernen und von Fremden
bewohnten Stadtteil abgeſehen, herrſcht überall deutlich ſichtbar noch heute
der Geiſt des Propheten. In weiten fließenden Gewändern, ihre Waſſser-
pfeife rauchend, hocken die langbärtigen Männer, den Turban auf dem
Kopf, gemächlich auf niederem Geſtühl vor den Häusern und in den mehr
als zweihundert Moſcheen verrichten die Glaubenstreuen ihre langen Ge-
Das. Bu ch. f ür Alle
Heſt 6
die physiologiſchen Nachwirkungen der Sehakte abgelagert ſind. Bei Kran-
ken, die trotß ſonſt ungestörter Intelligenz Gedrucktes und Geschriebenes nicht
mehr leſen konnten, weil ſie die Schriftzeichen nicht mehr erkannten (Wort-
blindheit), ergab der anatomische Befund Zerstörung einer seitlichen Stelle
des Hinterhauptlappens. Und darum redet man auch von einem Leſe-
zentrum (Wortsſehzentrum, Schriftbilderzentrum).
Und iſt das Rindengebiet, das hinter dem Schläfenbein liegt, zerstört
oder erkrankt, etwa durch Geſchwulſtbildung oder Bluterguß, dann iſt das
Hören aufgehoben (Seelentaubheit). Eine Schädigung dieses Bezirks
auf der linken Hirnhälfte iſt verbunden mit dem Verluſt der Fähigkeit,
Gehörtes zu verſtehen. Der Patient erkennt die ihm früher geläufigſten
Wörter nicht wieder, obwohl sein Hörorgan, das Ohr, unversehrt iſt (Wort-
taubheit). Natürlich kann er ſich auch nichts Gehörtes mehr in der Erinne-
rung vergegenwärtigen. Wir haben alſo hier Erkrankung des atuſtiſchen
Zentrums, speziell des ſogenannten ſenſoriſchen Wortzentrums, des Wort-
hörzentrums, wo wir uns die Nachwirkungen von akuſtiſchen Eindrücken,
ſpeziell von gehörten Wörtern, irgendwie feſtgehalten denten.
So hat jedes Sinnesorgan seine zentrale Stelle, von deren Unversehrtheit
es abhängt, ob die durch einen äußeren Vorgang (Reiz) auf das Sinnes-
organ ausgeübte Einwirkung auch von dem entſprechenden Bewujßt-
seinserlebnis (Empfindungs- und Wahrnehmundgsinhalt) begleitet iſt. Und
auch jedes einzelne andere Glied unſeres Körpers hat ſeine Vertretung
auf der Groſzhirnrinde. Durch diese ſteht es mit den Zentren der anderen
Glieder und der Sinnesorgane in Verbindung, wie die einzelnen Fernſprech-
anschlüsse in der Umſchaltzentrale ihre Nummer haben und hier mit anderen
Anschlüssen verbunden werden. Man hat die Zentren feſtgeſtellt für die
Bewegung von Füßen und Zehen, von Knien und Rumpf, Armen und
Händen und Fingern, Kopf mit Kehlkopf, Lippen und Zunge, und hat
damit natürlich auch das Feld gefunden, von dessen Unversehrtheit die
Fähigkeit des Sprechens bedingt iſt, das ſogenannte motoriſche Wortzen-
trum oder Wortſprechzentrum.
Über die Funktion des einen und anderen Bezirks und noch mehr über
ihre wechſelſeitige Verbindung ſind die Forſchungen noch nicht abgeschlossen.
Immerhin beſteht angesichts der fortſchreitenden Erkenntnis die Hoff-
nung, daß dieſe Fragen in absehbarer Zeit entſchieden werden. Aber
unentscheidbar auf dem Wege der pathologiſchen und experimentellen
Beobachtung isſt die Frage, ob durchaus jeder ſeeliſche Vorgang auch von
einem Gehirnprozeß begleitet iſt, wie wir anzunehmen gewohnt Jind, ob
es nicht doch auch Bewußtseinsvorgänge gibt ohne begleitende Gehirn-
vorgänge, wie es ja genug Gehirnprozeſſe zu geben ſcheint ohne be-
gleitende Bewußt9einserlebnise.
Wer überzeugt iſt, daß Seele und Körper verſchiedene Wesen ſind und
daß die Seele weiterexiſtieren wird auch ohne den Körper, an den Jie bei
ihrer Entſtehung verhastet wurde, der wird eine abſolute, eine durchgängige
Zuordnung der Bewußtſseinserlebniſſe zu Gehirnvorgängen nicht an-
nehmen wollen, jedenfalls nicht annehmen müssen. Aber auch wenn er
das zugeben wird und dazu noch, daß jedes Bewußtſeinserlebnis in der
Großhirnrinde seine Spur zurückläßt, so wird er ſich doch nicht nehmen
lassen, daß von jedem auch in der durchaus unſtofflichen Seele entſprechende
Nachwirkungen zurückbleiben und ihr das Erinnern des Erlebten ermög-
lichen. Wer aber die Sonderexiſtenz einer Seele außerhalb eines lebenden
Organismus für unmöglich hält, wer ſeeliſches Leben Jich nicht anders
denken kann als an körperliches Leben gebunden, für den iſt jene Zu-
ordnung absolut und durchgängig.
Zwingend beweisen kann seine Theorie der eine ſowenig wie der andere.
Beide arbeiten mit Gründen, die nicht für jeden gleich überzeugendes
Gewicht haben. Daher denn auch noch heute um das Leib-Seele-Problem
hie Philoſophen und Physiologen und Pſychologen ſtreiten wie vor Jahr-
underten.
Für dieses irdiſche Leben freilich + und dies allein iſt der wissenschaft-
lichen Beobachtung und Unterſuchung zugänglich = iſt zur Entfaltung
der seeliſchen Leiſtungsfähigkeit die Unverletztheit und Geſundheit des
Großhirns unerläßlich, so unerläßlich wie für ein gutes Klavierspiel die
Uwverletztheit des Klaviers. Der besſte Meiſter kann nichts leiſten, wenn
sein Klavier verdorben iſt, wenn die Saiten verſtimmt oder gar abgeriſſen
ſind. Das Gehirn aber können wir das Klavier der Seele nennen. Denken
wir jedoch vor allem an das Gedächtnis, ſo mag uns zum Vergleich eine
photographische Platte dienen. Der geſchickteſte Photograph bringt kein
gutes Bild zuſtande, wenn die Platte verdorben iſt. Und auch ein krankes
Gehirn liefert nur verzerrte Bilder oder überhaupt keine mehr. So ruht
im Hirn das Gedächtnis, und mit dem Gedächtnis hängt + das ſahen
wir –~ das ganze übrige Seelenleben des Menſchen aufs engste zuſammen.
Damaskus, das Ange des Oſtens / Von Hermann Uuſtig
N: die uralte, viel umkämpfte, ost eroberte, immer wieder zuneuem
Glanz erſtandene „ewige Stadt", iſt jung im Vergleich zu Syriens
Hauptſtadt, Damaskus, auf die neuerdings die Aufmerkſamteit der politiſch
Interessierten in allen Weltteilen gerichtet iſt. Schon ſechzehnhundert
Jahre vor Chriſti Geburt, faſt tauſend Jahre vor der Gründung Roms,
werden die Einwohner von Damaskus in einer Inſchrift zu Karnak als
Gegner des ägyptiſchen Königs Thotmes II. genannt. Und in den mehr
als dreitauſendfünfhundert Jahren ihres Beſtehens iſt dieſe Stadt un-
zählige Male der Kampfpreis geweſen, um den ein Volk nach dem andern
geſlritten hat. Denn der Araber nennt mit Recht das vielbegehrte Damas-
kus das „Auge des Oſtens".
Frankreich, das im Herbſt des Jahres 1925, um den Aufstand der Druſen
niederzuſchlagen, Damaskus mit Geſchützen, Tanks und Fliegerbomben die
neuzeitlichen Kriegsmittel rückſichtslos hat auskosten laſſen + gerade als
man in Locarno die Befriedung der ganzen Welt beſchloß , hat ſchon seit
dem Jahr 1799, seit der Eroberer Bonaparte bis vor die Mauern von Akka
und faſt nach Jeruſalem vordrang, danach geſtrebt, Syrien unter seinen
Einfluß zu bringen. Denn wer das „Auge des Ostens" besitzt, kann den
Teil des Welthandels überblicken und beherrſchen, der an dem ſyriſchen
Knotenpunkt der Verkehrſtraßen zwiſchen drei Erdteilen, Mien, Afrika
und Europa, seit jeher in Blüte ſtand. Die Natur hat den Ort durch die
Gunst der Lage von vornherein zum Umſchlageplat, zur Handelſtadt
geschaffen. Von üppiggrünenden, wohlbewässerten Gärten in weitem Um-
kreis umgeben, grenzt das Gebiet von Damaskus an die große, baumloſe
ſyriſche Wüſte, durch die ſeit Jahrtauſenden die Karawanen, einſt von
den beherrſchenden Weltſtädten Babylon und Ninive, heut von Bagdad
und Baſra, von Ägypten und RKleinqaJien, nach dieſem erquickenden Para-
dies zu kommen trachteten, wenn Jie der Sonnenbrand in der ſchattenloſen
Steinöde zu versſengen drohte. Von dieser Schnittfläche des Weltverkehrs
ſind denn auch die Entwicklungen von zwei Handelsvölkern ausgegangen,
den Phöniziern und den Juden, und im Zeitalter der Kreuzzüge ent-
ſtanden dort die Anfänge des Bantgeſchäsſtes.
Kaum eine Stadt hat ſo wechſelvolle Geschicke gehabt, hat ſo oft die
Herrſchaft von Eroberern erdulden müſſen wie Damaskus. In älteſter Zeit
die Pharaonen, dann die Aſſyrer und Babylonier, später die Römer, die
Araber und die Mongolen, dann die Kreuzzügler und Sarazenen, die Seld-
ſchuken und endlich die Türken haben die Stadt unterjocht, ausgeplündert,
oft auch in Brand gesetzt. Römiſches Heidentum und die Blütezeit by-
zantinischer, christlicher Kultur, mittelalterliche Chriſtianiſierung mit dem
Schwert unter dem Kreuzbanner und Mohammeds Machtentfaltung haben
ihre Spuren in noch erhaltenen Denkmälern und da und dort zerſtreut
übriggebliebenen Trümmern hinterlassen. Zwei große Kulturausbreitungen
und Religionsbewegungen haben von Damaskus ihren Ausgang genom-
men. Der erſte und erfolgreichſte Miſſionar der Lehre Christi, Paulus,
wurde dicht vor den Mauern dieſer Stadt durch ein wunderbares Erlebnis
aus einem fanatiſchen Verfolger zum begeisſtertſten Verkünder des Evan-
geliums. Und Mohammeds Lehre, der Iſlam, fand auf dem Siegeszug von
Mekka und Medina nach Norden den wichtigſten Stützpunkt in Damaskus,
als es Omar 635 eroberte und später die omaijadiſchen Kalifen in Pracht
und Herrlichkeit darin reſidierten.
Aus allen den wechselvollen Geschicken, den Vernichtungen durch Brand
und Plünderung erſtand die „ewige Stadt des Orients" immer wieder
zu neuer Blüte. Der Syrer, ein echter Semit, hat zähe Geduld und hält
viel aus, wenn er nur immer wieder ſeinen Handel neu aufnehmen und
seine Geschäfte betreiben kann. Sein Vorteil iſt es, wenn sich Orient und
Okzident in den engen Straßen ſeiner Hauptſtadt, in den Baſaren und
Werkstätten begegnen, wenn die Kamel- und Eselkarawanen, mit Laſten
bepackt, Waren bringen und Waren ausführen. Herrliche, kunſtvolle Tep-
piche und kostbare Tücher, echt orientaliſche Handarbeiten, kunſtreiche
Waffen, ſchimmerndes Sattelzeug und Geschirr werden neben geſchmack-
loſem europäischem Kitſch mit wortreichen Beteuerungen verhandelt. Die
Basare stehen denen von Kairo kaum nach an Größe und Belebtheit.
Und wenn auch in den letzten vierzig Jahren die Einwohnerzahl durch Zu-
zug aus dem Westen Jich faſt verdoppelt hat und jetzt über dreihunderttau-
send beträgt, ſo hat Damaskus doch trotz allen Völkergemiſches ſeinen orien-
taliſchen Charakter weit mehr bewahrt als etwa Konstantinopel oder das
faſt europäische Kairo. Von einem kleinen modernen und von Fremden
bewohnten Stadtteil abgeſehen, herrſcht überall deutlich ſichtbar noch heute
der Geiſt des Propheten. In weiten fließenden Gewändern, ihre Waſſser-
pfeife rauchend, hocken die langbärtigen Männer, den Turban auf dem
Kopf, gemächlich auf niederem Geſtühl vor den Häusern und in den mehr
als zweihundert Moſcheen verrichten die Glaubenstreuen ihre langen Ge-