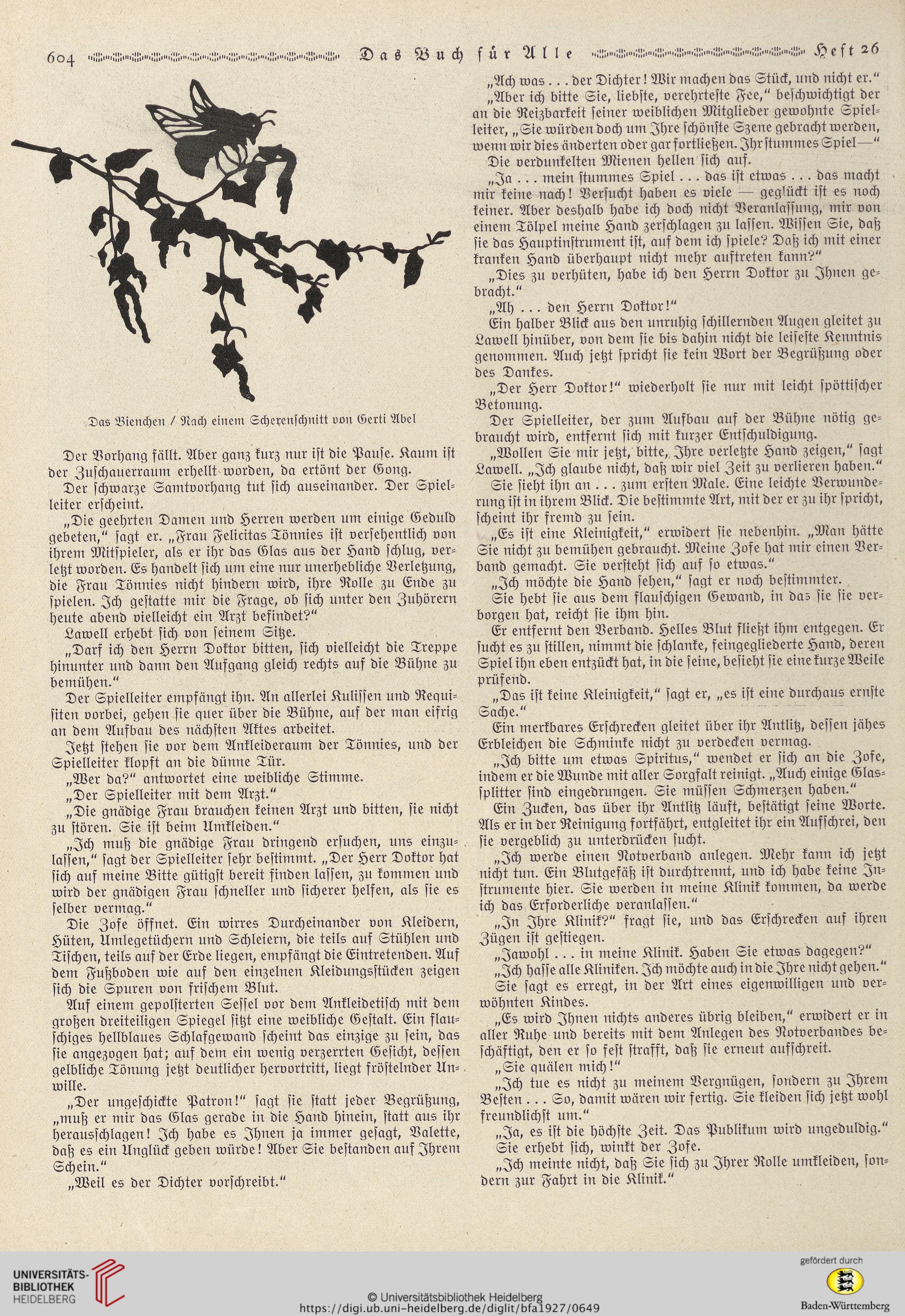Das Bienchen / Nach einem Scherenschnitt von Gerti Adel
Der Vorhang füllt. Aber ganz kurz nur ist die Pause. Kaum ist
der Zuschauerraum erhellt worden, da ertönt der Gong.
Der schwarze Samtvorhang tut sich auseinander. Der Spiel-
leiter erscheint.
„Die geehrten Damen und Herren werden um einige Geduld
gebeten," sagt er. „Frau Felicitas Tönnies ist versehentlich von
ihrem Mitspieler, als er ihr das Glas aus der Hand schlug, ver-
letzt worden. Es handelt sich um eine nur unerhebliche Verletzung,
die Frau Tönnies nicht hindern wird, ihre Rolle zu Ende zu
spielen. Ich gestatte mir die Frage, ob sich unter den Zuhörern
heute abend vielleicht ein Arzt befindet?"
Lawell erhebt sich von seinem Sitze.
„Darf ich den Herrn Doktor bitten, sich vielleicht die Treppe
hinunter und dann den Aufgang gleich rechts auf die Bühne zu
bemühen."
Der Spielleiter empfängt ihn. An allerlei Kulissen und Requi-
siten vorbei, gehen sie quer über die Bühne, auf der man eifrig
an dem Aufbau des nächsten Aktes arbeitet.
Jetzt stehen sie vor dem Ankleideraum der Tönnies, und der
Spielleiter klopft an die dünne Tür.
„Wer da?" antwortet eine weibliche Stimme.
„Der Spielleiter mit dem Arzt."
„Die gnädige Frau brauchen keinen Arzt und bitten, sie nicht
zu stören. Sie ist beim Umkleiden."
„Ich mutz die gnädige Frau dringend ersuchen, uns einzu-
lassen," sagt der Spielleiter sehr bestimmt. „Der Herr Doktor hat
sich auf meine Bitte gütigst bereit finden lassen, zu kommen und
wird der gnädigen Frau schneller und sicherer helfen, als sie es
selber vermag."
Die Zofe öffnet. Ein wirres Durcheinander von Kleidern,
Hüten, Umlegetüchern und Schleiern, die teils auf Stühlen und
Tischen, teils auf der Erde liegen, empfängt die Eintretenden. Auf
dem Fußboden wie auf den einzelnen Kleidungsstücken zeigen
sich die Spuren von frischem Blut.
Auf einem gepolsterten Sessel vor dem Ankleidetisch mit dem
großen dreiteiligen Spiegel sitzt eine weibliche Gestalt. Ein flau-
schiges hellblaues Schlafgewand scheint das einzige zu sein, das
sie angezogen hat; auf dem ein wenig verzerrten Gesicht, dessen
gelbliche Tönung jetzt deutlicher hervortritt, liegt fröstelnder Un-
wille.
„Der ungeschickte Patron!" sagt sie statt jeder Begrüßung,
„muß er mir das Glas gerade in die Hand hinein, statt aus ihr
herausschlagen! Ich habe es Ihnen ja immer gesagt, Valette,
daß es ein Unglück geben würde! Aber Sie bestanden auf Ihrem
Schein."
„Weil es der Dichter vorschreibt."
„Ach was ... der Dichter! Wir machen das Stück, und nicht er."
„Aber ich bitte Sie, liebste, vereinteste Fee," beschwichtigt der
an die Reizbarkeit seiner weiblichen Mitglieder gewohnte Spiel-
leiter, „Sie würden doch um Ihre schönste Szene gebracht werden,
wenn wir dies änderten oder gar fortließen. Ihr stummes Spiel—"
Die verdunkelten Mienen Hellen sich auf.
„Ja ... mein stummes Spiel ... das ist etwas ... das macht
mir keine nach! Versucht haben es viele — geglückt ist es noch
keiner. Aber deshalb habe ich doch nicht Veranlassung, mir von
einem Tölpel meine Hand zerschlagen zu lassen. Wissen Sie, daß
sie das Hauptinstrument ist, auf dem ich spiele? Daß ich mit einer
kranken Hand überhaupt nicht mehr auftreten kann?"
„Dies zu verhüten, habe ich den Herrn Doktor zu Ihnen ge-
bracht."
„Ah ... den Herrn Doktor!"
Ein halber Blick aus den unruhig schillernden Augen gleitet zu
Lawell hinüber, von dem sie bis dahin nicht die leiseste Kenntnis
genommen. Auch jetzt spricht sie kein Wort der Begrüßung oder
des Dankes.
„Der Herr Doktor!" wiederholt sie nur mit leicht spöttischer
Betonung.
Der Spielleiter, der zum Aufbau auf der Bühne nötig ge-
braucht wird, entfernt sich mit kurzer Entschuldigung.
„Wollen Sie mir jetzt, bitte, Ihre verletzte Hand zeigen," sagt
Lawell. „Ich glaube nicht, daß wir viel Zeit zu verlieren haben."
Sie sieht ihn an ... zum ersten Male. Eine leichte Verwunde-
rung ist in ihrem Blick. Die bestimmte Art, mit der er zu ihr spricht,
scheint ihr fremd zu sein.
„Es ist eine Kleinigkeit," erwidert sie nebenhin. „Man hätte
Sie nicht zu bemühen gebraucht. Meine Zofe hat mir einen Ver-
band gemacht. Sie versteht sich auf so etwas."
„Ich möchte die Hand sehen," sagt er noch bestimmter.
Sie hebt sie aus dem flauschigen Gewand, in das sie sie ver-
borgen hat, reicht sie ihm hin.
Er entfernt den Verband. Helles Blut fließt ihm entgegen. Er
sucht es zu stillen, nimmt die schlanke, feingegliederte Hand, deren
Spiel ihn eben entzückt hat, in die seine, besieht sie eine kurze Weile
prüfend.
„Das ist keine Kleinigkeit," sagt er, „es ist eine durchaus ernste
Sache."
Ein merkbares Erschrecken gleitet über ihr Antlitz, dessen jähes
Erbleichen die Schminke nicht zu verdecken vermag.
„Ich bitte um etwas Spiritus," wendet er sich an die Zofe,
indem er die Wunde mit aller Sorgfalt reinigt. „Auch einige Glas-
splitter sind eingedrungen. Sie müssen Schmerzen haben."
Ein Zucken, das über ihr Antlitz läuft, bestätigt seine Worte.
Als er in der Reinigung fortfährt, entgleitet ihr ein Aufschrei, den
sie vergeblich zu unterdrücken sucht.
„Ich werde einen Notverband anlegen. Mehr kann ich jetzt
nicht tun. Ein Blutgefäß ist durchtrennt, und ich habe keine In-
strumente hier. Sie werden in meine Klinik kommen, da werde
ich das Erforderliche veranlassen."
„In Ihre Klinik?" fragt sie, und das Erschrecken auf ihren
Zügen ist gestiegen.
„Jawohl ... in meine Klinik. Haben Sie etwas dagegen?"
„Ich hasse alle Kliniken. Ich möchte auch in die Ihre nicht gehen."
Sie sagt es erregt, in der Art eines eigenwilligen und ver-
wöhnten Kindes.
„Es wird Ihnen nichts anderes übrig bleiben," erwidert er in
aller Ruhe und bereits mit dem Anlegen des Notverbandes be-
schäftigt, den er so fest strafft, daß sie erneut aufschreit.
„Sie quälen mich!"
„Ich tue es nicht zu meinem Vergnügen, sondern zu Ihrem
Besten ... So, damit wären wir fertig. Sie kleiden sich jetzt wohl
freundlichst um."
„Ja, es ist die höchste Zeit. Das Publikum wird ungeduldig."
Sie erhebt sich, winkt der Zofe.
„Ich meinte nicht, daß Sie sich zu Ihrer Rolle umkleiden, son-
dern zur Fahrt in die Klinik."