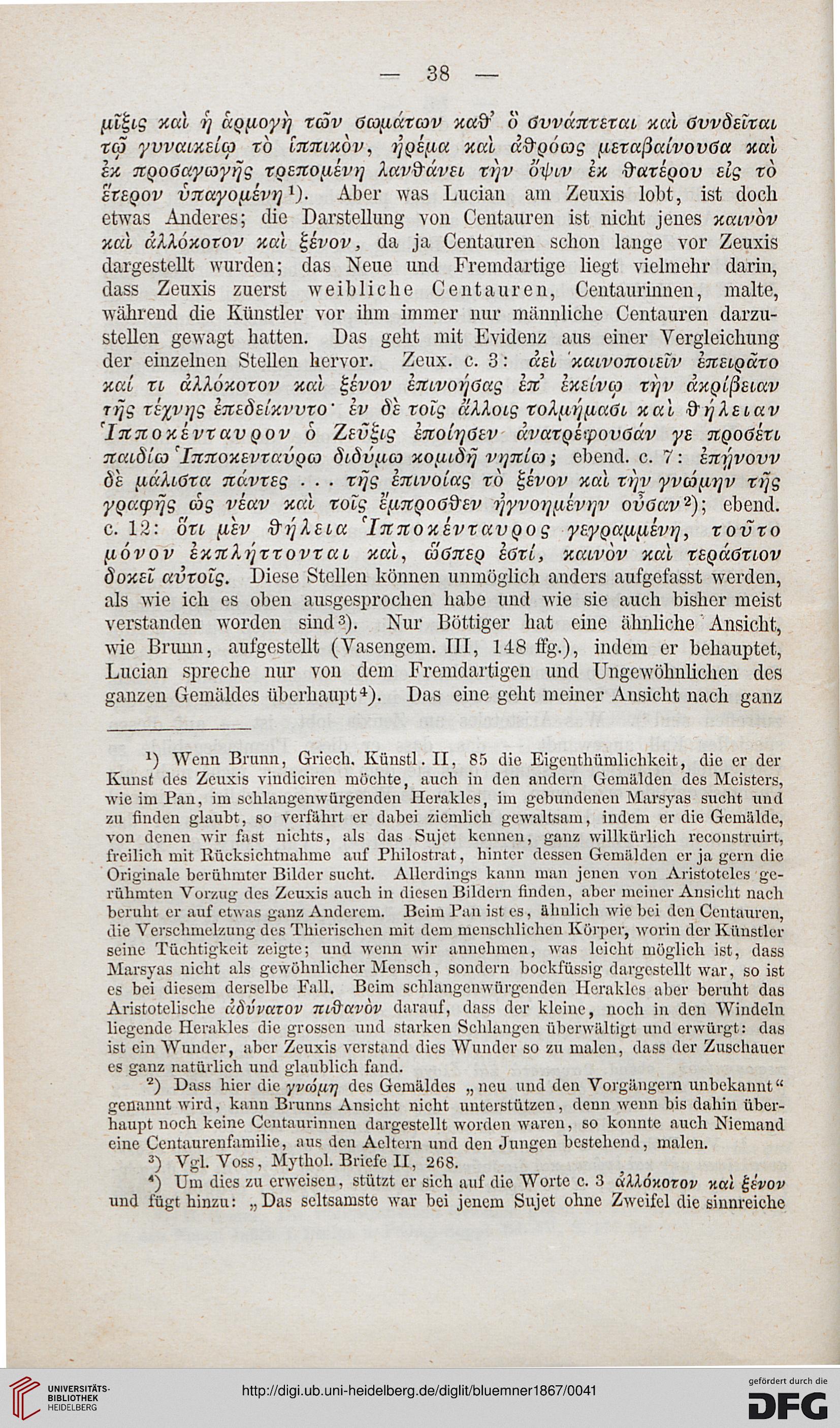— 38 —
filzig xal i] aQ[ioyr] xäv öajiäxcav xa&' o övvanxExai xdi Gwösitca
xä yvvcaxüa xb iitmxbv, tfoEfia xal d&goag fiExaßaivovöa xal
sx itQOöayayrjg xoetiouev)] XavftävEb xrjv öipw ex ftaxEgov elg rö
eteqov vjiayo^isvr]1). Aber was Luciau am Zeuxis lobt, ist doch
etwas Anderes; die Darstellung von Centauren ist niebt jenes xaivbv
xal alXbxorov xal %evov , da ja Centauren schon lange vor Zeuxis
dargestellt wurden; das Neue und Fremdartige liegt vielmehr darin,
dass Zeuxis zuerst weibliche Centauren, Centaurinnen, malte,
während die Künstler vor ihm immer nur männliche Centauren darzu-
stellen gewagt hatten. Das geht mit Evidenz aus einer Verglcichung
der einzelnen Stellen hervor. Zeux. c. 3: asl ' xawonoiElv BTtEiQaxo
xal xi ällöxoxov xal £evov EiztvorjGag In exelvco xtjv äxQißEiav
rrjg XEyyr\g eheSeLxvvto' iv ds xolg alloig xol^rifiaQi xal frrjXEiav
'Ift7iox£vxavQov 6 ZEv^ig enoifjöEV avaxQE\povGav ys %qo6exi
itaböla'ImtOKEvxuvQco diÖv^a xo^iidr] vrjjilco; ebend. c. 7: snrjvovv
Öe (iccfoöxa TtavxEg . . . xfjg ETtwolag xb %evov xa\ x>)v yvdfitjv xijg
yoßtpyg ag vkav xal xolg e^tcqoöQ'ev tfyvoyfj.Evyv ovöav2); ebend.
c. 12: oxi [isv &i]Ieiu IitnoxkvxavQog yEyga^ixEV)], xovxo
fiovov EXTtkyxxovxai, xal, äßnEQ EQxi, xaivbv xal XEQaöxiov
öoxeI avxolg. Diese Stellen können unmöglich anders aufgofasst werden,
als wie ich es oben ausgesprochen habe und wie sie auch bisher meist
verstanden worden sind3). Nur Böttiger hat eine ähnliche' Ansicht,
wie Brunn, aufgestellt (Vasengem. III, 148 ffg.), indem er behauptet,
Lucian spreche nur von dem Fremdartigen und Ungewöhnlichen des
ganzen Gemäldes überhaupt4). Das eine geht meiner Ansicht nach ganz
J) Wenn Brunn, Griech. Künstl. II, 85 die Eigentümlichkeit, die er der
Kunst des Zeuxis viudiciren möchte, auch in den andern Gemälden des Meisters,
wie im Pau, im sehlangenwürgcnden Herakles, im gebundenen Marsyas sucht und
zu finden glaubt, so verfährt er dabei ziemlich gewaltsam, indem ev die Gemälde,
von denen wir fast nichts, als das Sujet kennen, ganz willkürlich reconstruirt,
freilich mit Rücksichtnahme auf Philostrat, hinter dessen Gemälden er ja gern die
Originale berühmter Bilder sucht. Allerdings kann man jenen von Aristoteles ge-
rühmten Vorzug des Zeuxis auch in diesen Bildern finden, aber meiner Ansieht nach
beruht er auf etwas ganz Anderem. Beim Pan ist es, ähnlich wie bei den Centauren,
die Verschmelzung des Thierischeu mit dem menschlichen Körper, worin der Künstler
seine Tüchtigkeit zeigte; und wenn wir annehmen, was leicht möglich ist, dass
Marsyas nicht als gewöhnlicher Mensch, sondern bockfüssig dargestellt war, so ist
es bei diesem derselbe Fall. Beim schlangenwürgenden Herakles aber beruht das
Aristotelische aSvvazov itL&avov darauf, dass der kleine, noch in den Windeln
liegende Herakles die grossen und starken Schlangen überwältigt und erwürgt: das
ist ein Wunder, aber Zeuxis verstand dies Wunder so zu malen, dass der Zuschauer
es ganz natürlich und glaublich fand.
2) Dass hier die yvcS^T] des Gemäldes „neu und den Vorgängern unbekannt"
genannt wird, kann Brunns Ansieht nicht unterstützen, denn wenn bis dahin über-
haupt noch keine Centaurinnen dargestellt worden waren, so konnte auch Niemand
eine Centaurenfamilie, aus den Acltern und den Jungen bestehend, malen.
3) Vgl. Voss, Mythol. Briefe II, 268.
*) Um dies zu erweisen, stützt er sich auf die Worte c. 3 uIXöhotov Hat ^svov
und fügt hinzu: „Das seltsamste war bei jenem Sujet ohne Zweifel die sinnreiche
filzig xal i] aQ[ioyr] xäv öajiäxcav xa&' o övvanxExai xdi Gwösitca
xä yvvcaxüa xb iitmxbv, tfoEfia xal d&goag fiExaßaivovöa xal
sx itQOöayayrjg xoetiouev)] XavftävEb xrjv öipw ex ftaxEgov elg rö
eteqov vjiayo^isvr]1). Aber was Luciau am Zeuxis lobt, ist doch
etwas Anderes; die Darstellung von Centauren ist niebt jenes xaivbv
xal alXbxorov xal %evov , da ja Centauren schon lange vor Zeuxis
dargestellt wurden; das Neue und Fremdartige liegt vielmehr darin,
dass Zeuxis zuerst weibliche Centauren, Centaurinnen, malte,
während die Künstler vor ihm immer nur männliche Centauren darzu-
stellen gewagt hatten. Das geht mit Evidenz aus einer Verglcichung
der einzelnen Stellen hervor. Zeux. c. 3: asl ' xawonoiElv BTtEiQaxo
xal xi ällöxoxov xal £evov EiztvorjGag In exelvco xtjv äxQißEiav
rrjg XEyyr\g eheSeLxvvto' iv ds xolg alloig xol^rifiaQi xal frrjXEiav
'Ift7iox£vxavQov 6 ZEv^ig enoifjöEV avaxQE\povGav ys %qo6exi
itaböla'ImtOKEvxuvQco diÖv^a xo^iidr] vrjjilco; ebend. c. 7: snrjvovv
Öe (iccfoöxa TtavxEg . . . xfjg ETtwolag xb %evov xa\ x>)v yvdfitjv xijg
yoßtpyg ag vkav xal xolg e^tcqoöQ'ev tfyvoyfj.Evyv ovöav2); ebend.
c. 12: oxi [isv &i]Ieiu IitnoxkvxavQog yEyga^ixEV)], xovxo
fiovov EXTtkyxxovxai, xal, äßnEQ EQxi, xaivbv xal XEQaöxiov
öoxeI avxolg. Diese Stellen können unmöglich anders aufgofasst werden,
als wie ich es oben ausgesprochen habe und wie sie auch bisher meist
verstanden worden sind3). Nur Böttiger hat eine ähnliche' Ansicht,
wie Brunn, aufgestellt (Vasengem. III, 148 ffg.), indem er behauptet,
Lucian spreche nur von dem Fremdartigen und Ungewöhnlichen des
ganzen Gemäldes überhaupt4). Das eine geht meiner Ansicht nach ganz
J) Wenn Brunn, Griech. Künstl. II, 85 die Eigentümlichkeit, die er der
Kunst des Zeuxis viudiciren möchte, auch in den andern Gemälden des Meisters,
wie im Pau, im sehlangenwürgcnden Herakles, im gebundenen Marsyas sucht und
zu finden glaubt, so verfährt er dabei ziemlich gewaltsam, indem ev die Gemälde,
von denen wir fast nichts, als das Sujet kennen, ganz willkürlich reconstruirt,
freilich mit Rücksichtnahme auf Philostrat, hinter dessen Gemälden er ja gern die
Originale berühmter Bilder sucht. Allerdings kann man jenen von Aristoteles ge-
rühmten Vorzug des Zeuxis auch in diesen Bildern finden, aber meiner Ansieht nach
beruht er auf etwas ganz Anderem. Beim Pan ist es, ähnlich wie bei den Centauren,
die Verschmelzung des Thierischeu mit dem menschlichen Körper, worin der Künstler
seine Tüchtigkeit zeigte; und wenn wir annehmen, was leicht möglich ist, dass
Marsyas nicht als gewöhnlicher Mensch, sondern bockfüssig dargestellt war, so ist
es bei diesem derselbe Fall. Beim schlangenwürgenden Herakles aber beruht das
Aristotelische aSvvazov itL&avov darauf, dass der kleine, noch in den Windeln
liegende Herakles die grossen und starken Schlangen überwältigt und erwürgt: das
ist ein Wunder, aber Zeuxis verstand dies Wunder so zu malen, dass der Zuschauer
es ganz natürlich und glaublich fand.
2) Dass hier die yvcS^T] des Gemäldes „neu und den Vorgängern unbekannt"
genannt wird, kann Brunns Ansieht nicht unterstützen, denn wenn bis dahin über-
haupt noch keine Centaurinnen dargestellt worden waren, so konnte auch Niemand
eine Centaurenfamilie, aus den Acltern und den Jungen bestehend, malen.
3) Vgl. Voss, Mythol. Briefe II, 268.
*) Um dies zu erweisen, stützt er sich auf die Worte c. 3 uIXöhotov Hat ^svov
und fügt hinzu: „Das seltsamste war bei jenem Sujet ohne Zweifel die sinnreiche