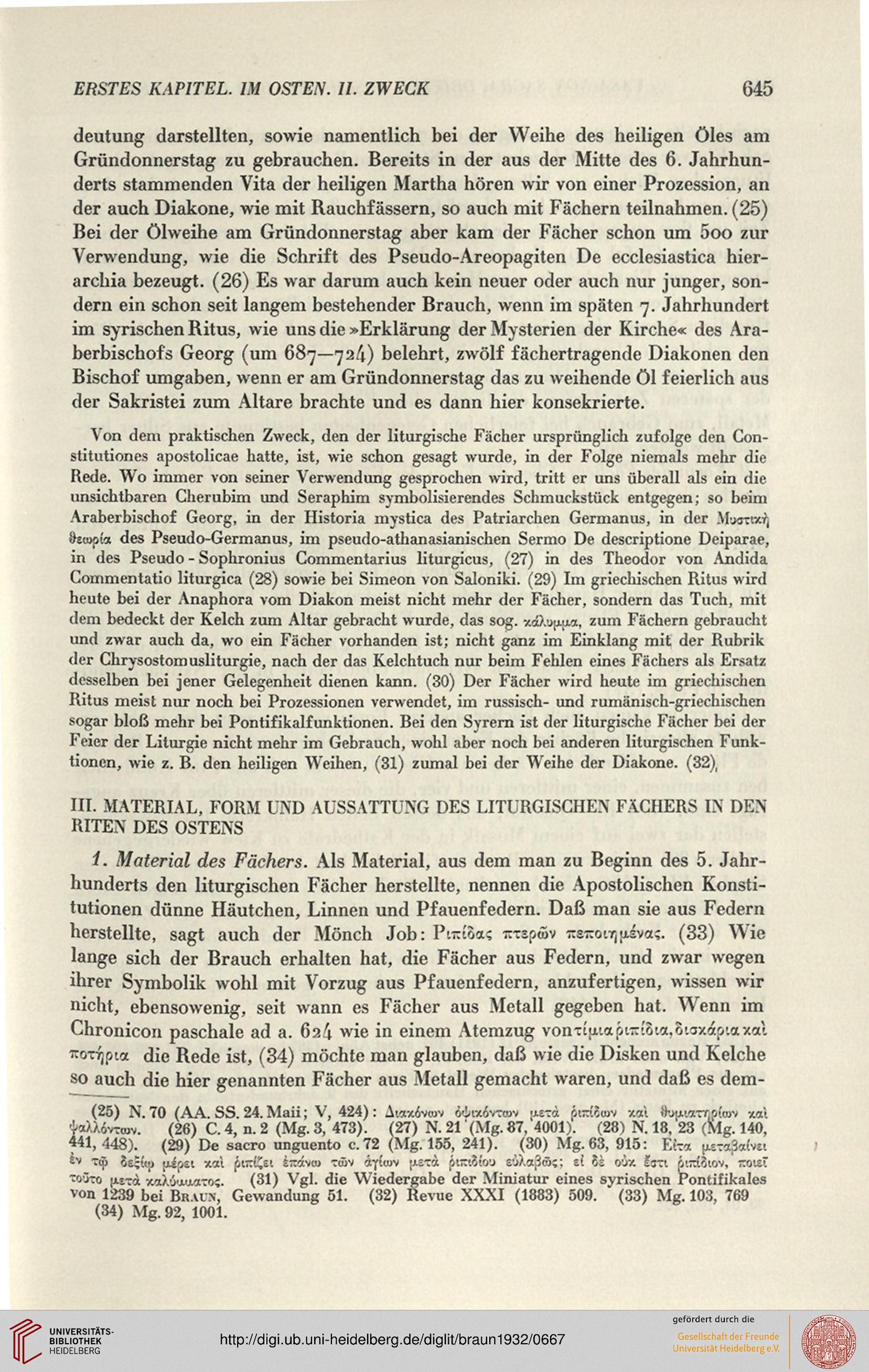ERSTES KAPITEL. IM OSTEN. II. ZWECK 645
deutung darstellten, sowie namentlich bei der Weihe des heiligen Öles am
Gründonnerstag zu gebrauchen. Bereits in der aus der Mitte des 6. Jahrhun-
derts stammenden Vita der heiligen Martha hören wir von einer Prozession, an
der auch Diakone, wie mit Rauchfässern, so auch mit Fächern teilnahmen. (25)
Bei der ölweihe am Gründonnerstag aber kam der Fächer schon um ooo zur
Verwendung, wie die Schrift des Pseudo-Areopagiten De ecclesiastica hier-
archia bezeugt. (26) Es war darum auch kein neuer oder auch nur junger, son-
dern ein schon seit langem bestehender Brauch, wenn im späten 7. Jahrhundert
im syrischen Ritus, wie uns die »Erklärung der Mysterien der Kirche* des Ara-
berbischofs Georg (um 687—72^) belehrt, zwölf fächertragende Diakonen den
Bischof umgaben, wenn er am Gründonnerstag das zu weihende öl feierlich aus
der Sakristei zum Altare brachte und es dann hier konsekrierte.
Von dem praktischen Zweck, den der liturgische Fächer ursprünglich zufolge den Con-
stitutione» apostolicae hatte, ist, wie schon gesagt wurde, in der Folge niemals mehr die
Rede. Wo immer von seiner Verwendung gesprochen wird, tritt er uns überall als ein die
unsichtbaren Cherubim und Seraphim symbolisierendes Sehmuckstück entgegen; so beim
Araberbischof Georg, in der Historia mystica des Patriarchen Germanus, in der Myarix-Tj
ytuwict des Pseudc-Germanus, im pseudo-athanasianischen Sermo De descriptione Deiparae,
in des Pseudo - Sophronius Commentarius liturgicus, (27) in des Theodor von Andida
Commentatio liturgica (28) sowie bei Simeon von Saloniki. (29) Im griechischen Ritus wird
heute bei der Anaphora vom Diakon meist nicht mehr der Fächer, sondern das Tuch, mit
dem bedeckt der Kelch zum Altar gebracht wurde, das sog. xä?,u|j.iia, zum Fächern gebraucht
und zwar auch da, wo ein Fächer vorhanden ist; nicht ganz im Einklang mit der Rubrik
der Clirysostomusliturgie, nach der das Kelchtuch nur beim Fehlen eines Fächers als Ersatz
desselben bei jener Gelegenheit dienen kann. (30) Der Fächer wird heute im griechischen
Ritus meist nur noch bei Prozessionen verwendet, im russisch- und rumänisch-griechischen
sogar bloß mehr bei Pontifikalf Miktionen. Bei den Syrern ist der liturgische Fächer bei der
Feier der Liturgie nicht mehr im Gebrauch, wohl aber noch bei anderen liturgischen Funk-
tionen, wie z. B. den heiligen Weihen, (31) zumal bei der Weihe der Diakone. (32),
III. MATERIAL, FORM UND AüSSATTUNG DES LITURGISCHEN FÄCHERS IN DEN
RITEN DES OSTENS
1. Material des Fächers. Als Material, aus dem man zu Beginn des 5. Jahr-
hunderts den liturgischen F'ächer herstellte, nennen die Apostolischen Konsti-
tutionen dünne Häutchen, Linnen und Pfauenfedern. Daß man sie aus Federn
herstellte, sagt auch der Mönch Job: PuctSoc icxtp&v iteirowjpivo«. (33) Wie
lange sich der Brauch erhalten hat, die Fächer aus Federn, und zwar wegen
ihrer Symbolik wohl mit Vorzug aus Pfauenfedern, anzufertigen, wissen wir
nicht, ebensowenig, seit wann es Fächer aus Metall gegeben hat. Wenn im
Chronicon paschale ad a. 6s£ wie in einem Atemzug vouTifua£ttci8i«,5iax£ptaxal
rcoTijpi« die Rede ist, (34) möchte man glauben, daß wie die Disken und Kelche
so auch die hier genannten Fächer aus Metall gemacht waren, und daß es dem-
(25) N.70 (AA. SS. 24.Mali; V, 424): AktoSwbn 6&a&nm wetä äntfimv xst BuiAwrcr.piuiv -mX
Wü.v.-w. (26) C.4,n.2 (Ms. 3. 473). (27) X. 21'iM^. 87, 4ijt>l>. (28) N. 18, 23 (Mg. 140,
441,448). (29) De sacro unguento c.72 (Mg. 155, 241). (30) Mg. 63, 915: F,fc« jisT^atvst
*» -™ &$¥ fiepet x=ri jktdC« fcttfc« tßv frfbv prnä pw&fou e«aflä«; sE U oix &m ÄirfSiov, mntf
"ü'jto uettt %aX6wMttoe. (3t) Vgl. die Wiedergabe der Miniatur eines syrischen Pontifikales
von 1239 bei Brau«, Gewandung 51. (32) Revue XXXI (1883) 509. (33) Mg. 103, 769
(34) Mg. 92, 1001.
deutung darstellten, sowie namentlich bei der Weihe des heiligen Öles am
Gründonnerstag zu gebrauchen. Bereits in der aus der Mitte des 6. Jahrhun-
derts stammenden Vita der heiligen Martha hören wir von einer Prozession, an
der auch Diakone, wie mit Rauchfässern, so auch mit Fächern teilnahmen. (25)
Bei der ölweihe am Gründonnerstag aber kam der Fächer schon um ooo zur
Verwendung, wie die Schrift des Pseudo-Areopagiten De ecclesiastica hier-
archia bezeugt. (26) Es war darum auch kein neuer oder auch nur junger, son-
dern ein schon seit langem bestehender Brauch, wenn im späten 7. Jahrhundert
im syrischen Ritus, wie uns die »Erklärung der Mysterien der Kirche* des Ara-
berbischofs Georg (um 687—72^) belehrt, zwölf fächertragende Diakonen den
Bischof umgaben, wenn er am Gründonnerstag das zu weihende öl feierlich aus
der Sakristei zum Altare brachte und es dann hier konsekrierte.
Von dem praktischen Zweck, den der liturgische Fächer ursprünglich zufolge den Con-
stitutione» apostolicae hatte, ist, wie schon gesagt wurde, in der Folge niemals mehr die
Rede. Wo immer von seiner Verwendung gesprochen wird, tritt er uns überall als ein die
unsichtbaren Cherubim und Seraphim symbolisierendes Sehmuckstück entgegen; so beim
Araberbischof Georg, in der Historia mystica des Patriarchen Germanus, in der Myarix-Tj
ytuwict des Pseudc-Germanus, im pseudo-athanasianischen Sermo De descriptione Deiparae,
in des Pseudo - Sophronius Commentarius liturgicus, (27) in des Theodor von Andida
Commentatio liturgica (28) sowie bei Simeon von Saloniki. (29) Im griechischen Ritus wird
heute bei der Anaphora vom Diakon meist nicht mehr der Fächer, sondern das Tuch, mit
dem bedeckt der Kelch zum Altar gebracht wurde, das sog. xä?,u|j.iia, zum Fächern gebraucht
und zwar auch da, wo ein Fächer vorhanden ist; nicht ganz im Einklang mit der Rubrik
der Clirysostomusliturgie, nach der das Kelchtuch nur beim Fehlen eines Fächers als Ersatz
desselben bei jener Gelegenheit dienen kann. (30) Der Fächer wird heute im griechischen
Ritus meist nur noch bei Prozessionen verwendet, im russisch- und rumänisch-griechischen
sogar bloß mehr bei Pontifikalf Miktionen. Bei den Syrern ist der liturgische Fächer bei der
Feier der Liturgie nicht mehr im Gebrauch, wohl aber noch bei anderen liturgischen Funk-
tionen, wie z. B. den heiligen Weihen, (31) zumal bei der Weihe der Diakone. (32),
III. MATERIAL, FORM UND AüSSATTUNG DES LITURGISCHEN FÄCHERS IN DEN
RITEN DES OSTENS
1. Material des Fächers. Als Material, aus dem man zu Beginn des 5. Jahr-
hunderts den liturgischen F'ächer herstellte, nennen die Apostolischen Konsti-
tutionen dünne Häutchen, Linnen und Pfauenfedern. Daß man sie aus Federn
herstellte, sagt auch der Mönch Job: PuctSoc icxtp&v iteirowjpivo«. (33) Wie
lange sich der Brauch erhalten hat, die Fächer aus Federn, und zwar wegen
ihrer Symbolik wohl mit Vorzug aus Pfauenfedern, anzufertigen, wissen wir
nicht, ebensowenig, seit wann es Fächer aus Metall gegeben hat. Wenn im
Chronicon paschale ad a. 6s£ wie in einem Atemzug vouTifua£ttci8i«,5iax£ptaxal
rcoTijpi« die Rede ist, (34) möchte man glauben, daß wie die Disken und Kelche
so auch die hier genannten Fächer aus Metall gemacht waren, und daß es dem-
(25) N.70 (AA. SS. 24.Mali; V, 424): AktoSwbn 6&a&nm wetä äntfimv xst BuiAwrcr.piuiv -mX
Wü.v.-w. (26) C.4,n.2 (Ms. 3. 473). (27) X. 21'iM^. 87, 4ijt>l>. (28) N. 18, 23 (Mg. 140,
441,448). (29) De sacro unguento c.72 (Mg. 155, 241). (30) Mg. 63, 915: F,fc« jisT^atvst
*» -™ &$¥ fiepet x=ri jktdC« fcttfc« tßv frfbv prnä pw&fou e«aflä«; sE U oix &m ÄirfSiov, mntf
"ü'jto uettt %aX6wMttoe. (3t) Vgl. die Wiedergabe der Miniatur eines syrischen Pontifikales
von 1239 bei Brau«, Gewandung 51. (32) Revue XXXI (1883) 509. (33) Mg. 103, 769
(34) Mg. 92, 1001.