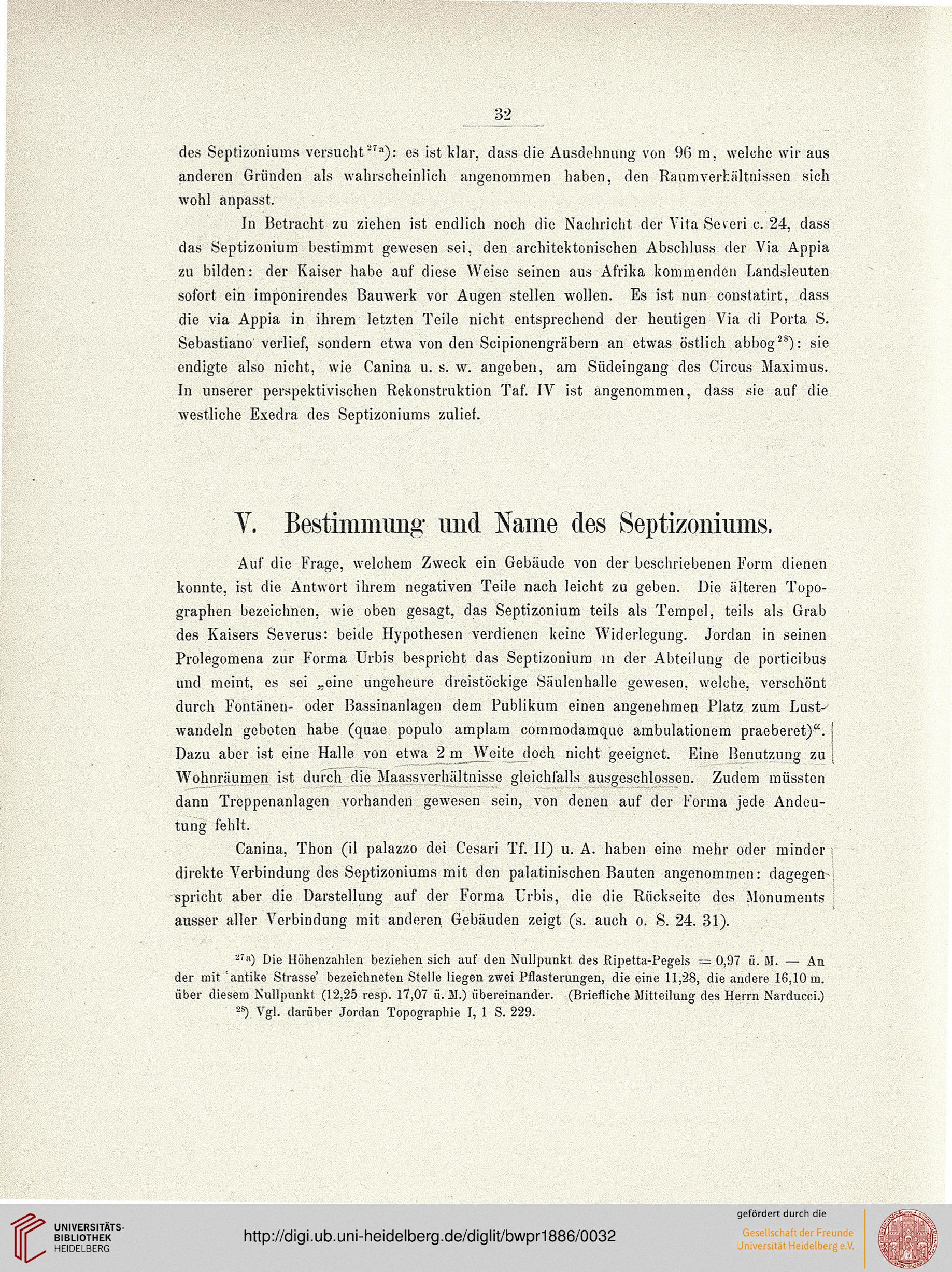32
des Septizoniums versucht"'"): es ist klar, dass die Ausdehnung von 96 m, welche wir aus
anderen Gründen als wahrscheinlich angenommen haben, den Raumverkiiltnissen sich
wohl anpasst.
In Betracht zu ziehen ist endlich noch die Nachricht der Vita Sev.eri c. 24, dass
das Septizonium hestimmt gewesen sei, den architektonischen Abschluss der Via Appia
zu bilden: der Kaiser habe auf diese Weise seinen aus Afrika kommenden Landsleuten
sofort ein iinponirendes Bauwerk vor Augen stellen wollen. Es ist nun constatirt, dass
die via Appia in ihrem letzten Teile nicht entsprechend der heutigen Via di Porta S.
Sebastiano verlief, sondern etwa von den Scipionengriibern an etwas östlich abbog28): sie
endigte also nicht, wie Canina u. s. w. angeben, am Südeingang des Circus Maximus.
In unserer perspektivischen Rekonstruktion Taf. IV ist angenommen, dass sie auf die
westliche Exedra des Septizoniums zuliet.
Y. Bestimmung' und Käme des Septizoniums,
Auf die Frage, welchem Zweck ein Gebäude von der beschriebenen Form dienen
konnte, ist die Antwort ihrem negativen Teile nach leicht zu geben. Die älteren Topo-
graphen bezeichnen, wie oben gesagt, das Septizonium teils als Tempel, teils als Grab
des Kaisers Severus: beide Hypothesen verdienen keine Widerlegung. Jordan in seinen
Prolegomena zur Forma Urbis bespricht das Septizonium in der Abteiluug de portieibus
und meint, es sei „eine ungeheure dreistöckige Säulenhalle gewesen, welche, verschönt
durch Fontänen- oder Bassinanlagen dem Publikum einen angenehmen Platz zum Lust-
wandeln geboten habe (quae populo amplam commodamque ambulationem praeberet)".
Dazu aber ist eine Halle von etwa 2 m Weite doch nicht geeignet. Eine Benutzung zu
Wohnräumen ist durch die Maassverhältnisse gleichfalls ausgeschlossen. Zudem müssten
dann Treppenanlagen vorhanden gewesen sein, von denen auf der Forma jede Andeu-
tung fehlt.
Canina, Thon (il palazzo dei Cesari Tf. II) u. A. haben eine mehr oder minder
direkte Verbindung des Septizoniums mit den palatinischen Bauten angenommen: dagegen-
spricht aber die Darstellung auf der Forma Urbis, die die Rückseite des Monuments
ausser aller Verbindung mit anderen Gebäuden zeigt (s. auch o. S. 24. 31).
-Til) Die Höhenzählen beziehen sich auf den Nullpunkt des Ripetta-Pegels — 0,97 ü. M. — An
der mit 'antike Strasse' bezeichneten Stelle liegen zwei Pflasterungen, die eine 11,28, die andere 16,10 m.
über diesem Nullpunkt (12,25 resp. 17,07 ü. M.) übereinander. (Briefliche Mitteilung des Herrn Narducci.)
2S) Vgl. darüber Jordan Topographie I, 1 S. 229.
des Septizoniums versucht"'"): es ist klar, dass die Ausdehnung von 96 m, welche wir aus
anderen Gründen als wahrscheinlich angenommen haben, den Raumverkiiltnissen sich
wohl anpasst.
In Betracht zu ziehen ist endlich noch die Nachricht der Vita Sev.eri c. 24, dass
das Septizonium hestimmt gewesen sei, den architektonischen Abschluss der Via Appia
zu bilden: der Kaiser habe auf diese Weise seinen aus Afrika kommenden Landsleuten
sofort ein iinponirendes Bauwerk vor Augen stellen wollen. Es ist nun constatirt, dass
die via Appia in ihrem letzten Teile nicht entsprechend der heutigen Via di Porta S.
Sebastiano verlief, sondern etwa von den Scipionengriibern an etwas östlich abbog28): sie
endigte also nicht, wie Canina u. s. w. angeben, am Südeingang des Circus Maximus.
In unserer perspektivischen Rekonstruktion Taf. IV ist angenommen, dass sie auf die
westliche Exedra des Septizoniums zuliet.
Y. Bestimmung' und Käme des Septizoniums,
Auf die Frage, welchem Zweck ein Gebäude von der beschriebenen Form dienen
konnte, ist die Antwort ihrem negativen Teile nach leicht zu geben. Die älteren Topo-
graphen bezeichnen, wie oben gesagt, das Septizonium teils als Tempel, teils als Grab
des Kaisers Severus: beide Hypothesen verdienen keine Widerlegung. Jordan in seinen
Prolegomena zur Forma Urbis bespricht das Septizonium in der Abteiluug de portieibus
und meint, es sei „eine ungeheure dreistöckige Säulenhalle gewesen, welche, verschönt
durch Fontänen- oder Bassinanlagen dem Publikum einen angenehmen Platz zum Lust-
wandeln geboten habe (quae populo amplam commodamque ambulationem praeberet)".
Dazu aber ist eine Halle von etwa 2 m Weite doch nicht geeignet. Eine Benutzung zu
Wohnräumen ist durch die Maassverhältnisse gleichfalls ausgeschlossen. Zudem müssten
dann Treppenanlagen vorhanden gewesen sein, von denen auf der Forma jede Andeu-
tung fehlt.
Canina, Thon (il palazzo dei Cesari Tf. II) u. A. haben eine mehr oder minder
direkte Verbindung des Septizoniums mit den palatinischen Bauten angenommen: dagegen-
spricht aber die Darstellung auf der Forma Urbis, die die Rückseite des Monuments
ausser aller Verbindung mit anderen Gebäuden zeigt (s. auch o. S. 24. 31).
-Til) Die Höhenzählen beziehen sich auf den Nullpunkt des Ripetta-Pegels — 0,97 ü. M. — An
der mit 'antike Strasse' bezeichneten Stelle liegen zwei Pflasterungen, die eine 11,28, die andere 16,10 m.
über diesem Nullpunkt (12,25 resp. 17,07 ü. M.) übereinander. (Briefliche Mitteilung des Herrn Narducci.)
2S) Vgl. darüber Jordan Topographie I, 1 S. 229.