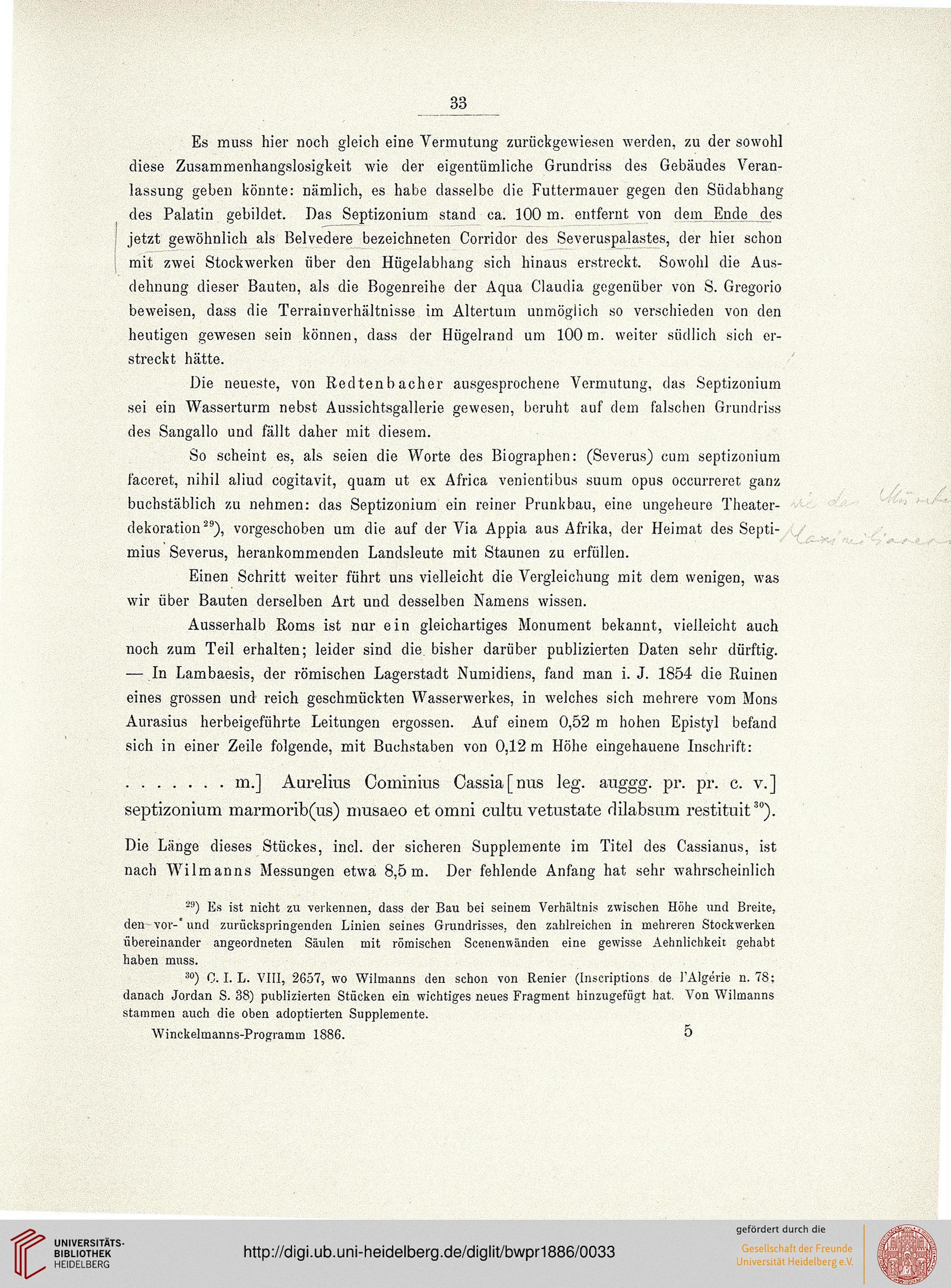33
Es muss hier noch gleich eine Vermutung zurückgewiesen werden, zu der sowohl
diese Zusammenhangslosigkeit wie der eigentümliche Grundriss des Gebäudes Veran-
lassung geben könnte: nämlich, es habe dasselbe die Futtermauer gegen den Südabhang
des Palatin gebildet. Das Septizonium stand ca. 100 m. entfernt von dem Ende des
jetzt gewöhnlich als Belvedere bezeichneten Corridor des Severuspalastes, der hier schon
mit zwei Stockwerken über den Hügelabhang sich hinaus erstreckt. Sowohl die Aus-
dehnung dieser Bauten, als die Bogenreihe der Aqua Claudia gegenüber von S. Gregorio
beweisen, dass die Terrainverhältnisse im Altertum unmöglich so verschieden von den
heutigen gewesen sein können, dass der Hügelrand um 100m. weiter südlich sich er-
streckt hätte.
Die neueste, von Redtenbacher ausgesprochene Vermutung, das Septizonium
sei ein Wasserturm nebst Aussichtsgallerie gewesen, beruht auf dem falschen Grundriss
des Sangallo und fällt daher mit diesem.
So scheint es, als seien die Worte des Biographen: (Severus) cum septizonium
faceret, nihil aliud cogitavit, quam ut ex Africa venientibus suum opus occurreret ganz
buchstäblich zu nehmen: das Septizonium ein reiner Prunkbau, eine ungeheure Theater-
dekoration29), vorgeschoben um die auf der Via Appia aus Afrika, der Heimat des Septi-
mius Severus, herankommenden Landsleute mit Staunen zu erfüllen.
Einen Schritt weiter führt uns vielleicht die Vergleichung mit dem wenigen, was
wir über Bauten derselben Art und desselben Namens wissen.
Ausserhalb Roms ist nur ein gleichartiges Monument bekannt, vielleicht auch
noch zum Teil erhalten; leider sind die. bisher darüber publizierten Daten sehr dürftig.
— In Lambaesis, der römischen Lagerstadt Numidiens, fand man i. J. 1854 die Ruinen
eines grossen und reich geschmückten Wasserwerkes, in welches sich mehrere vom Mons
Aurasius herbeigeführte Leitungen ergossen. Auf einem 0,52 m hohen Epistyl befand
sich in einer Zeile folgende, mit Buchstaben von 0,12 m Höhe eingehauene Inschrift:
.......m.] Aurelius Oominius Cassiafnus leg. auggg. pr. pr. c. v.]
septizonium marmorib(us) nrasaeo et omni cultu vetustate rlilabsum restituit3").
Die Länge dieses Stückes, incl. der sicheren Supplemente im Titel des Cassianus, ist
nach Wilmanns Messungen etwa 8,5m. Der fehlende Anfang hat sehr wahrscheinlich
29) Es ist nicht zu verkennen, dass der Bari bei seinem Verhältnis zwischen Höhe und Breite,
den vor-'und zurückspringenden Linien seines Grundrisses, den zahlreichen in mehreren Stockwerken
übereinander angeordneten Säulen mit römischen Scenenwänden eine gewisse Aehnlichkeit gehabt
haben muss.
30) 0.1. L. VIII, 2657, wo Wilmanns den schon von Renier (Inscriptions de I'Algerie n. 78;
danach Jordan S. 38) publizierten Stücken ein wichtiges neues Fragment hinzugefügt hat. Von Wilmanns
stammen auch die oben adoptierten Supplemente.
Winckelmanns-Programm 1886. p
Es muss hier noch gleich eine Vermutung zurückgewiesen werden, zu der sowohl
diese Zusammenhangslosigkeit wie der eigentümliche Grundriss des Gebäudes Veran-
lassung geben könnte: nämlich, es habe dasselbe die Futtermauer gegen den Südabhang
des Palatin gebildet. Das Septizonium stand ca. 100 m. entfernt von dem Ende des
jetzt gewöhnlich als Belvedere bezeichneten Corridor des Severuspalastes, der hier schon
mit zwei Stockwerken über den Hügelabhang sich hinaus erstreckt. Sowohl die Aus-
dehnung dieser Bauten, als die Bogenreihe der Aqua Claudia gegenüber von S. Gregorio
beweisen, dass die Terrainverhältnisse im Altertum unmöglich so verschieden von den
heutigen gewesen sein können, dass der Hügelrand um 100m. weiter südlich sich er-
streckt hätte.
Die neueste, von Redtenbacher ausgesprochene Vermutung, das Septizonium
sei ein Wasserturm nebst Aussichtsgallerie gewesen, beruht auf dem falschen Grundriss
des Sangallo und fällt daher mit diesem.
So scheint es, als seien die Worte des Biographen: (Severus) cum septizonium
faceret, nihil aliud cogitavit, quam ut ex Africa venientibus suum opus occurreret ganz
buchstäblich zu nehmen: das Septizonium ein reiner Prunkbau, eine ungeheure Theater-
dekoration29), vorgeschoben um die auf der Via Appia aus Afrika, der Heimat des Septi-
mius Severus, herankommenden Landsleute mit Staunen zu erfüllen.
Einen Schritt weiter führt uns vielleicht die Vergleichung mit dem wenigen, was
wir über Bauten derselben Art und desselben Namens wissen.
Ausserhalb Roms ist nur ein gleichartiges Monument bekannt, vielleicht auch
noch zum Teil erhalten; leider sind die. bisher darüber publizierten Daten sehr dürftig.
— In Lambaesis, der römischen Lagerstadt Numidiens, fand man i. J. 1854 die Ruinen
eines grossen und reich geschmückten Wasserwerkes, in welches sich mehrere vom Mons
Aurasius herbeigeführte Leitungen ergossen. Auf einem 0,52 m hohen Epistyl befand
sich in einer Zeile folgende, mit Buchstaben von 0,12 m Höhe eingehauene Inschrift:
.......m.] Aurelius Oominius Cassiafnus leg. auggg. pr. pr. c. v.]
septizonium marmorib(us) nrasaeo et omni cultu vetustate rlilabsum restituit3").
Die Länge dieses Stückes, incl. der sicheren Supplemente im Titel des Cassianus, ist
nach Wilmanns Messungen etwa 8,5m. Der fehlende Anfang hat sehr wahrscheinlich
29) Es ist nicht zu verkennen, dass der Bari bei seinem Verhältnis zwischen Höhe und Breite,
den vor-'und zurückspringenden Linien seines Grundrisses, den zahlreichen in mehreren Stockwerken
übereinander angeordneten Säulen mit römischen Scenenwänden eine gewisse Aehnlichkeit gehabt
haben muss.
30) 0.1. L. VIII, 2657, wo Wilmanns den schon von Renier (Inscriptions de I'Algerie n. 78;
danach Jordan S. 38) publizierten Stücken ein wichtiges neues Fragment hinzugefügt hat. Von Wilmanns
stammen auch die oben adoptierten Supplemente.
Winckelmanns-Programm 1886. p