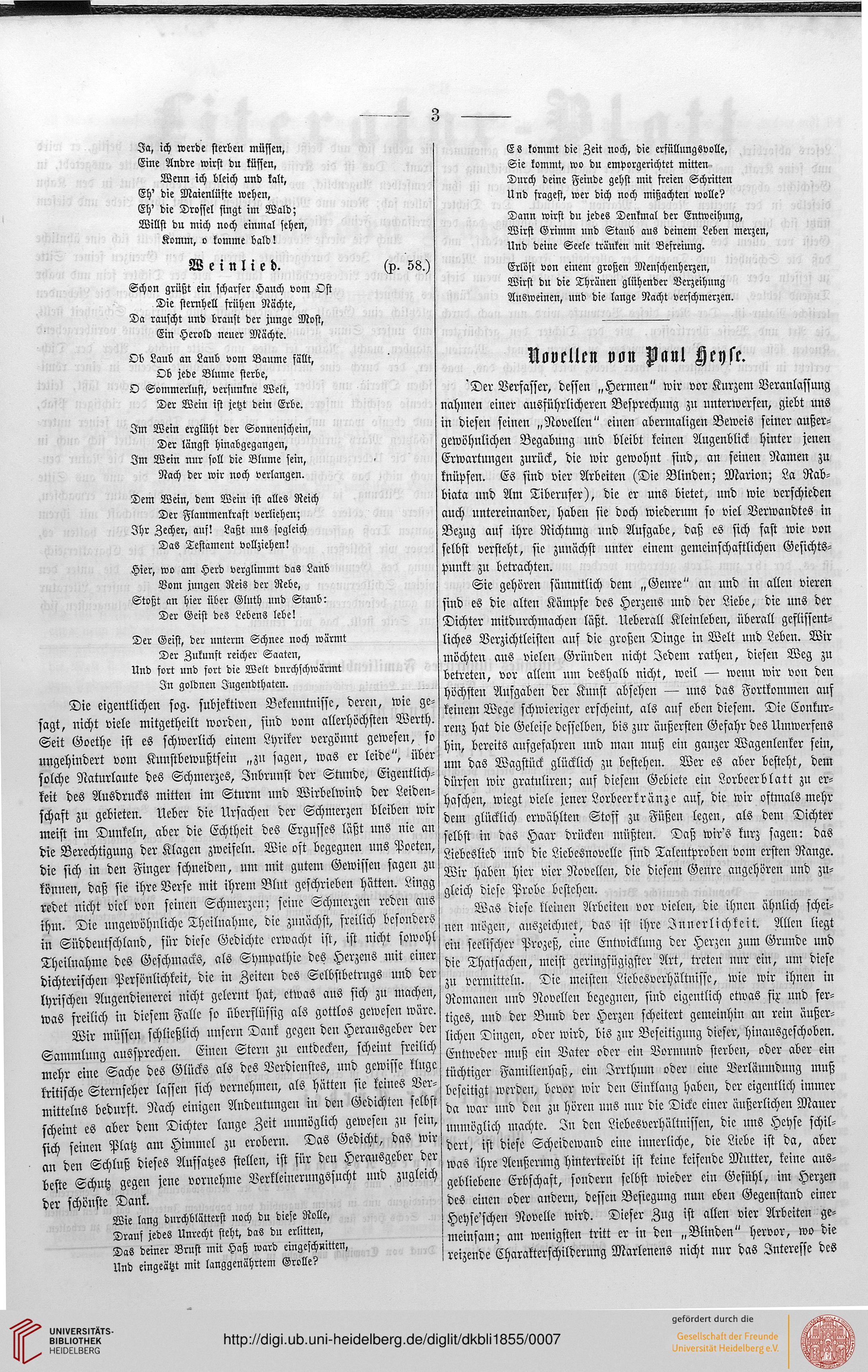3
(p. 58.)
Ja, ich werde sterben müssen,
Eine Andre wirst du küssen,
Wenn ich bleich und kalt,
Eh' die Maienlüfte wehen,
Eh' die Drossel singt im Wald;
Willst du mich noch einmal sehen,
Komm, o komme bald!
W e i n l i e d.
Schon grüßt ein scharfer Hauch vom Ost
Die sternhell frühen Nächte,
Da rauscht und braust der junge Most,
Ein Herold neuer Mächte.
Ob Laub an Laub vom Baume fällt,
Ob jede Blume sterbe,
O Sommerlust, versunkne Welt,
Der Wein ist jetzt dein Erbe.
Im Wein erglüht der Sonnenschein,
Der längst hinabgegangen,
Im Wein nur soll die Blume sein,
Nach der wir noch verlangen.
Dem Wein, dem Wein ist alles Reich
Der Flammenkraft verliehen;
Ihr Zecher, auf! Laßt uns sogleich
Das Testament vollziehen!
Hier, wo am Herd verglimmt das Laub
Vom jungen Reis der Rebe,
Stoßt an hier über Gluth und Staub:
Der Geist des Lebens lebe!
Der Geist, der unterm Schnee noch wärmt
Der Zukunft reicher Saaten,
Und fort und fort die Welt dnrchschwärmt
In goldnen Jugendthaten.
Die eigentlichen sog. subjektiven Bekenntnisse, deren, wie ge-
sagt, nicht viele mitgetheilt worden, sind vom allerhöchsten Werth.
Seit Goethe ist es schwerlich einem Lyriker vergönnt gewesen, so
ungehindert vom Kunstbewußtsein „zu jagen, was er leide", über
solche Naturlaute des Schmerzes, Inbrunst der Stunde, Eigentlich-
keit des Ausdrucks mitten im Sturm und Wirbelwind der Leiden-
schaft zu gebieten. Ueber die Ursachen der Schmerzen bleiben wir
meist im Dunkeln, aber die Echtheit des Ergusses läßt uns nie an
die Berechtigung der Klagen zweifeln. Wie oft begegnen uns Poeten,
die sich in den Finger schneiden, um mit gutem Gewissen sagen zu
können, daß sie ihre Verse mit ihrem Blut geschrieben hätten. Lingg
redet nicht viel von seinen Schmerzen; seine Schmerzen reden aus
ihm. Die ungewöhnliche Theilnahme, die zunächst, freilich besonders
in Süddeutschland, für diese Gedichte erwacht ist, ist nicht sowohl
Theilnahme des Geschmacks, als Sympathie des Herzens mit einer-
dichterischen Persönlichkeit, die in Zeiten des Selbstbetrugs und der
lyrischen Angendienerei nicht gelernt hat, etwas aus sich zu machen,
was freilich in diesem Falle so überflüssig als gottlos gewesen wäre.
Wir müssen schließlich unfern Dank gegen den Herausgeber der
Sammlung aussprechen. Einen Stern zu entdecken, scheint freilich
mehr eine Sache des Glücks als des Verdienstes, und gewisse kluge
kritische Sternseher lassen sich vernehmen, als hätten sie keines Ver-
mitteln- bedurft. Nach einigen Andeutungen in den Gedichten selbst
scheint es aber dem Dichter lange Zeit unmöglich gewesen zu sein,
sich seinen Platz am Himmel zu erobern. Das Gedicht, das wir
an den Schluß dieses Aufsatzes stellen, ist für den Herausgeber der
beste Schutz gegen jene vornehme Verkleinerungssucht und zugleich
der schönste Dank.
Wie lang durchblätterst noch du diese Rolle,
Drauf jedes Unrecht steht, das du erlitten,
Das deiner Brust mit Haß ward eingeschnitten,
Und eingeätzt mit langgenährtem Grolle?
Es kommt die Zeit noch, die erfüllungsvolle,
Sie kommt, wo du emporgerichtet mitten
Durch deine Feinde gehst mit freien Schritten
Und fragest, wer dich noch mißachten wolle?
Dann wirst du jedes Denkmal der Entweihung,
Wirst Grimm und Staub aus deinem Leben merzen,
Und deine Seele tränken mit Befreiung.
Erlöst von einem großen Menschenherzen,
Wirst du die Thränen glühender Verzeihung
Answeinen, und die lange Nacht verschmerzen.
Novellen von Paul Heyse.
'Der Verfasser, dessen „Hermen" wir vor Kurzem Veranlassung
nahmen einer ausführlicheren Besprechung zu unterwerfen, giebt uns
in diesen seinen „Novellen" einen abermaligen Beweis seiner außer-
gewöhnlichen Begabung und bleibt keinen Augenblick hinter jenen
Erwartungen zurück, die wir gewohnt sind, an seinen Namen zu
knüpfen. Es sind vier Arbeiten (Die Blinden; Marion; La Rab-
biata und Am Tiberuser), die er uns bietet, und wie verschieden
auch untereinander, haben sie doch wiederum so viel Verwandtes in
Bezug auf ihre Richtung und Aufgabe, daß es sich fast wie von
selbst versteht, sie zunächst unter einem gemeinschaftlichen Gesichts-
punkt zu bettachten.
Sie gehören sämmtlich dem „Genre" an und in allen vieren
sind es die alten Kämpfe des Herzens und der Liebe, die uns der
Dichter mitdurchmachen läßt. Ueberall Kleinleben, überall geflissent-
liches Verzichtleisten auf die großen Dinge in Welt und Leben. Wir
möchten aus vielen Gründen nicht Jedem rathen, diesen Weg zu
betreten, vor allem um deshalb nicht, weil — wenn wir von den
höchsten Aufgaben der Kunst absehen — uns das Fortkommen auf
keinem Wege schwieriger erscheint, als auf eben diesem. Die Conkur-
renz hat die Geleise desselben, bis zur äußersten Gefahr des Umwerfens
hin, bereits aufgefahren und man muß ein ganzer Wagenlenker sein,
um das Wagstück glücklich zu bestehen. Wer es aber besteht, dem
dürfen wir gratuliren; auf diesem Gebiete ein Lorbeerblatt zu er-
haschen, wiegt viele jener Lorbeerkränze auf, die wir oftmals mehr
dem glücklich erwählten Stoff zu Füßen legen, als dem Dichter
selbst in das Haar drücken müßten. Daß wirs kurz sagen: das
Liebeslied und die Liebesnovclle sind Talentproben vom ersten Range.
Wir haben hier vier Novellen, die diesem Genre angehören und zu-
gleich diese Probe bestehen.
Was diese kleinen Arbeiten vor vielen, die ihnen ähnlich schei-
nen mögen, anszeichnet, das ist ihre Innerlichkeit. Allen liegt
ein seelischer Prozeß, eine Entwicklung der Herzen zum Grunde und
die Thatsachen, meist geringfügigster Art, treten nur ein, um diese
zu vermitteln. Die meisten Liebesverhältnisse, wie wir ihnen in
Romanen und Novellen begegnen, sind eigentlich etwas sip und fer-
tiges, und der Bund der Herzen scheitert gemeinhin an rein äußer-
lichen Dingen, oder wird, bis zur Beseitigung dieser, hinausgeschoben.
Entweder muß ein Vater oder ein Vormund sterben, oder aber ein
tüchtiger Familienhaß, ein Jrrthum oder eine Verläumdung muß
beseitigt werden, bevor wir den Einklang haben, der eigentlich immer
da war und den zu hören uns nur die Dicke einer äußerlichen Mauer-
unmöglich machte. In den Liebesverhältnissen, die uns Heyse schil-
dert, ist diese Scheidewand eine innerliche, die Liebe ist da, aber
was ihre Aeußerung hintertreibt ist keine keifende Mutter, keine aus-
gebliebene Erbschaft, sondern selbst wieder ein Gefühl, im Herzen
des einen oder andern, dessen Besiegung nun eben Gegenstand einer
Heyse'schen Novelle wird. Dieser Zug ist allen vier Arbeiten ge-
meinsam; am wenigsten tritt er in den „Blinden" hervor, wo die
reizende Charakterschilderung Marlenens nicht nur das Interesse des
(p. 58.)
Ja, ich werde sterben müssen,
Eine Andre wirst du küssen,
Wenn ich bleich und kalt,
Eh' die Maienlüfte wehen,
Eh' die Drossel singt im Wald;
Willst du mich noch einmal sehen,
Komm, o komme bald!
W e i n l i e d.
Schon grüßt ein scharfer Hauch vom Ost
Die sternhell frühen Nächte,
Da rauscht und braust der junge Most,
Ein Herold neuer Mächte.
Ob Laub an Laub vom Baume fällt,
Ob jede Blume sterbe,
O Sommerlust, versunkne Welt,
Der Wein ist jetzt dein Erbe.
Im Wein erglüht der Sonnenschein,
Der längst hinabgegangen,
Im Wein nur soll die Blume sein,
Nach der wir noch verlangen.
Dem Wein, dem Wein ist alles Reich
Der Flammenkraft verliehen;
Ihr Zecher, auf! Laßt uns sogleich
Das Testament vollziehen!
Hier, wo am Herd verglimmt das Laub
Vom jungen Reis der Rebe,
Stoßt an hier über Gluth und Staub:
Der Geist des Lebens lebe!
Der Geist, der unterm Schnee noch wärmt
Der Zukunft reicher Saaten,
Und fort und fort die Welt dnrchschwärmt
In goldnen Jugendthaten.
Die eigentlichen sog. subjektiven Bekenntnisse, deren, wie ge-
sagt, nicht viele mitgetheilt worden, sind vom allerhöchsten Werth.
Seit Goethe ist es schwerlich einem Lyriker vergönnt gewesen, so
ungehindert vom Kunstbewußtsein „zu jagen, was er leide", über
solche Naturlaute des Schmerzes, Inbrunst der Stunde, Eigentlich-
keit des Ausdrucks mitten im Sturm und Wirbelwind der Leiden-
schaft zu gebieten. Ueber die Ursachen der Schmerzen bleiben wir
meist im Dunkeln, aber die Echtheit des Ergusses läßt uns nie an
die Berechtigung der Klagen zweifeln. Wie oft begegnen uns Poeten,
die sich in den Finger schneiden, um mit gutem Gewissen sagen zu
können, daß sie ihre Verse mit ihrem Blut geschrieben hätten. Lingg
redet nicht viel von seinen Schmerzen; seine Schmerzen reden aus
ihm. Die ungewöhnliche Theilnahme, die zunächst, freilich besonders
in Süddeutschland, für diese Gedichte erwacht ist, ist nicht sowohl
Theilnahme des Geschmacks, als Sympathie des Herzens mit einer-
dichterischen Persönlichkeit, die in Zeiten des Selbstbetrugs und der
lyrischen Angendienerei nicht gelernt hat, etwas aus sich zu machen,
was freilich in diesem Falle so überflüssig als gottlos gewesen wäre.
Wir müssen schließlich unfern Dank gegen den Herausgeber der
Sammlung aussprechen. Einen Stern zu entdecken, scheint freilich
mehr eine Sache des Glücks als des Verdienstes, und gewisse kluge
kritische Sternseher lassen sich vernehmen, als hätten sie keines Ver-
mitteln- bedurft. Nach einigen Andeutungen in den Gedichten selbst
scheint es aber dem Dichter lange Zeit unmöglich gewesen zu sein,
sich seinen Platz am Himmel zu erobern. Das Gedicht, das wir
an den Schluß dieses Aufsatzes stellen, ist für den Herausgeber der
beste Schutz gegen jene vornehme Verkleinerungssucht und zugleich
der schönste Dank.
Wie lang durchblätterst noch du diese Rolle,
Drauf jedes Unrecht steht, das du erlitten,
Das deiner Brust mit Haß ward eingeschnitten,
Und eingeätzt mit langgenährtem Grolle?
Es kommt die Zeit noch, die erfüllungsvolle,
Sie kommt, wo du emporgerichtet mitten
Durch deine Feinde gehst mit freien Schritten
Und fragest, wer dich noch mißachten wolle?
Dann wirst du jedes Denkmal der Entweihung,
Wirst Grimm und Staub aus deinem Leben merzen,
Und deine Seele tränken mit Befreiung.
Erlöst von einem großen Menschenherzen,
Wirst du die Thränen glühender Verzeihung
Answeinen, und die lange Nacht verschmerzen.
Novellen von Paul Heyse.
'Der Verfasser, dessen „Hermen" wir vor Kurzem Veranlassung
nahmen einer ausführlicheren Besprechung zu unterwerfen, giebt uns
in diesen seinen „Novellen" einen abermaligen Beweis seiner außer-
gewöhnlichen Begabung und bleibt keinen Augenblick hinter jenen
Erwartungen zurück, die wir gewohnt sind, an seinen Namen zu
knüpfen. Es sind vier Arbeiten (Die Blinden; Marion; La Rab-
biata und Am Tiberuser), die er uns bietet, und wie verschieden
auch untereinander, haben sie doch wiederum so viel Verwandtes in
Bezug auf ihre Richtung und Aufgabe, daß es sich fast wie von
selbst versteht, sie zunächst unter einem gemeinschaftlichen Gesichts-
punkt zu bettachten.
Sie gehören sämmtlich dem „Genre" an und in allen vieren
sind es die alten Kämpfe des Herzens und der Liebe, die uns der
Dichter mitdurchmachen läßt. Ueberall Kleinleben, überall geflissent-
liches Verzichtleisten auf die großen Dinge in Welt und Leben. Wir
möchten aus vielen Gründen nicht Jedem rathen, diesen Weg zu
betreten, vor allem um deshalb nicht, weil — wenn wir von den
höchsten Aufgaben der Kunst absehen — uns das Fortkommen auf
keinem Wege schwieriger erscheint, als auf eben diesem. Die Conkur-
renz hat die Geleise desselben, bis zur äußersten Gefahr des Umwerfens
hin, bereits aufgefahren und man muß ein ganzer Wagenlenker sein,
um das Wagstück glücklich zu bestehen. Wer es aber besteht, dem
dürfen wir gratuliren; auf diesem Gebiete ein Lorbeerblatt zu er-
haschen, wiegt viele jener Lorbeerkränze auf, die wir oftmals mehr
dem glücklich erwählten Stoff zu Füßen legen, als dem Dichter
selbst in das Haar drücken müßten. Daß wirs kurz sagen: das
Liebeslied und die Liebesnovclle sind Talentproben vom ersten Range.
Wir haben hier vier Novellen, die diesem Genre angehören und zu-
gleich diese Probe bestehen.
Was diese kleinen Arbeiten vor vielen, die ihnen ähnlich schei-
nen mögen, anszeichnet, das ist ihre Innerlichkeit. Allen liegt
ein seelischer Prozeß, eine Entwicklung der Herzen zum Grunde und
die Thatsachen, meist geringfügigster Art, treten nur ein, um diese
zu vermitteln. Die meisten Liebesverhältnisse, wie wir ihnen in
Romanen und Novellen begegnen, sind eigentlich etwas sip und fer-
tiges, und der Bund der Herzen scheitert gemeinhin an rein äußer-
lichen Dingen, oder wird, bis zur Beseitigung dieser, hinausgeschoben.
Entweder muß ein Vater oder ein Vormund sterben, oder aber ein
tüchtiger Familienhaß, ein Jrrthum oder eine Verläumdung muß
beseitigt werden, bevor wir den Einklang haben, der eigentlich immer
da war und den zu hören uns nur die Dicke einer äußerlichen Mauer-
unmöglich machte. In den Liebesverhältnissen, die uns Heyse schil-
dert, ist diese Scheidewand eine innerliche, die Liebe ist da, aber
was ihre Aeußerung hintertreibt ist keine keifende Mutter, keine aus-
gebliebene Erbschaft, sondern selbst wieder ein Gefühl, im Herzen
des einen oder andern, dessen Besiegung nun eben Gegenstand einer
Heyse'schen Novelle wird. Dieser Zug ist allen vier Arbeiten ge-
meinsam; am wenigsten tritt er in den „Blinden" hervor, wo die
reizende Charakterschilderung Marlenens nicht nur das Interesse des