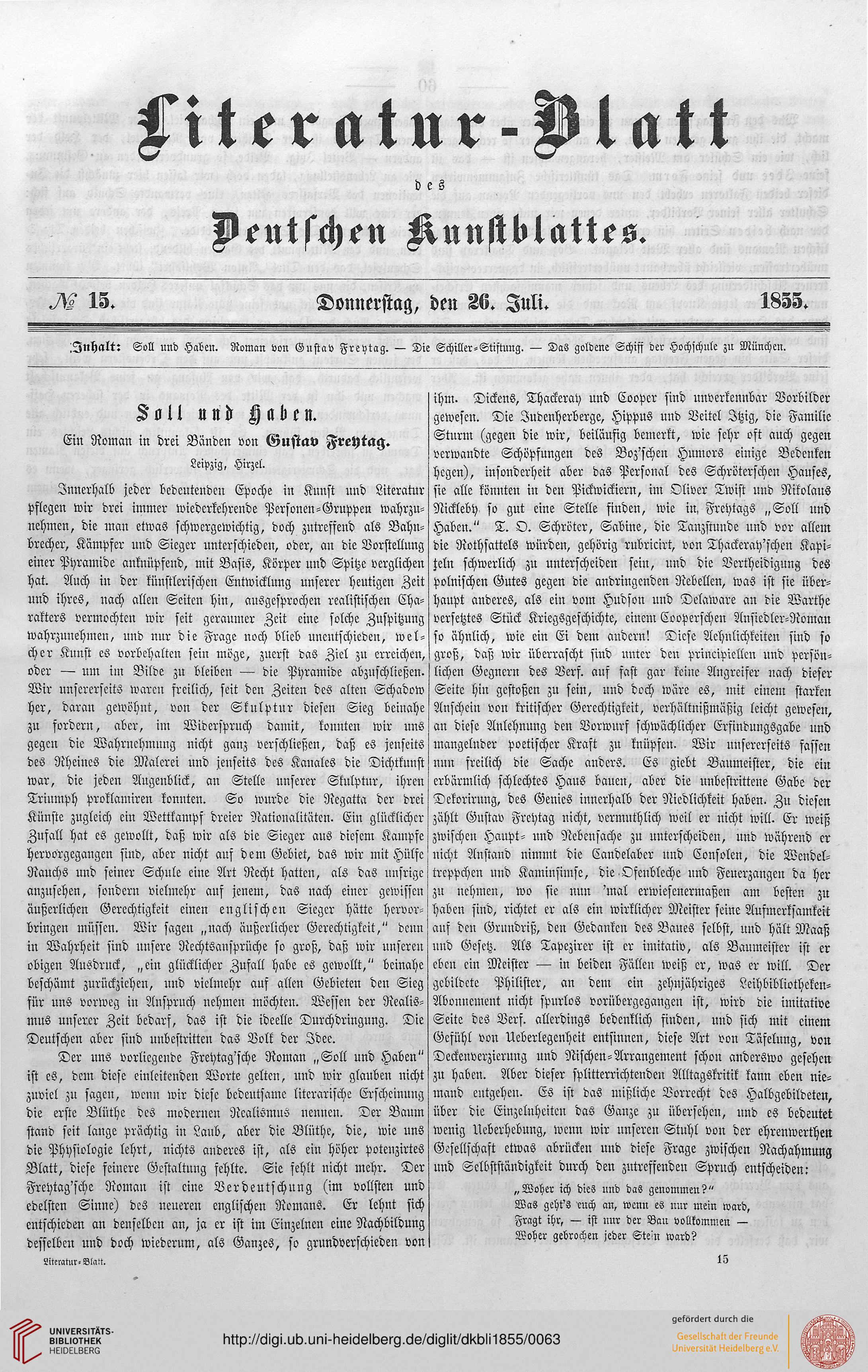Literatur
Dtatt
des
Deutschen Kunstblattes.
J\s 15.
Donnerstag, den 26. Juli.
1833.
^Inhalt: Soll und Haben. Roman von Gustav Freutag. — Die Schiller-Stiftung. — Das goldene Schiss der Hochschule zu München.
Soll und Hoden.
Ein Roman in drei Bänden von Gustav Freytag.
Leipzig, Hirzel.
Innerhalb jeder bedeutenden Epoche in Kunst und Literatur
pflegen wir drei immer wiedcrkehrende Personen-Gruppen wahrzu-
nehmen, die man etwas schwergewichtig, doch zutreffend als Bahn-
brecher, Kämpfer und Sieger unterschieden, oder, an die Vorstellung
einer Pyramide anknüpfend, mit Basis, Körper und Spitze verglichen
hat. Auch in der künstlerischen Entwicklung unserer heutigen Zeit
und ihres, nach allen Seiten hin, ausgesprochen realistischen Cha-
rakters vermochten wir seit geraumer Zeit eine solche Zuspitzung
wahrzunehmen, und nur die Frage noch blieb unentschieden, wel-
cher Kunst es Vorbehalten sein möge, zuerst das Ziel zu erreichen,
oder — um tat Bilde zu bleiben — die Pyramide abzuschließen.
Wir unsererseits waren freilich, seit den Zeiten des alten Schadow
her, daran gewöhnt, von der Skulptur diesen Sieg beinahe
zu fordern, aber, im Widerspruch damit, konnten wir uns
gegen die Wahrnehmung nicht ganz verschließen, daß es jenseits
des Rheines die Malerei und jenseits des Kanales die Dichtkunst
war, die jeden Augenblick, an Stelle unserer Skulptur, ihren
Triumph proklamiren konnten. So wurde die Regatta der drei
Künste zugleich ein Wettkampf dreier Nationalitäten. Ein glücklicher
Zufall hat es gewollt, daß wir als die Sieger aus diesem Kampfe
hervorgegangen sind, aber nicht auf dem Gebiet, das wir mit Hülfe
Rauchs und seiner Schule eine Art Recht hatten, als das unsrige
anzusehen, sondern vielmehr aus jenem, das nach einer gewissen
äußerlichen Gerechtigkeit einen englischen Sieger hätte hervor-
bringen müssen. Wir sagen „nach äußerlicher Gerechtigkeit," denn
in Wahrheit sind unsere Rechtsansprüche so groß, daß wir unseren
obigen Ausdruck, „ein glücklicher Zufall habe es gewollt," beinahe
beschämt zurückziehen, und vielmehr auf allen Gebieten den Sieg
für uns vorweg in Anspruch nehmen möchten. Wessen der Realis-
mus unserer Zeit bedarf, das ist die ideelle Durchdringung. Die
Deutschen aber sind unbestritten das Volk der Idee.
Der uns vorliegende Freytag'sche Roman „Soll und Haben"
ist es, dem diese einleitenden Worte gelten, und wir glauben nicht
zuviel zu sagen, wenn wir diese bedeutsame literarische Erscheinung
die erste Blüthe des modernen Realismus nennen. Der Baum
stand seit lange prächtig in Laub, aber die Blüthe, die, wie uns
die Physiologie lehrt, nichts anderes ist, als ein höher potenzirtes
Blatt, diese feinere Gestaltung fehlte. Sie fehlt nicht mehr. Der
Freytag'sche Roman ist eine Verdeutschung (im vollsten und
edelsten Sinne) des neueren englischen Romans. Er lehnt sich
entschieden an denselben an, ja er ist im Einzelnen eine Nachbildung
desselben und doch wiederum, als Ganzes, so grundverschieden von
Literatur-Blait.
ihm. Dickens, Thackeray und Coopcr sind unverkennbar Vorbilder
gewesen. Die Judenherberge, Hippus und Veitel Itzig, die Familie
Sturm (gegeu die wir, beiläufig bemerkt, wie sehr oft auch gegen
verwandte Schöpfungen des Boz'schen Humors eiuige Bedenken
hegen), insonderheit aber das Personal des Schröterschen Hauses,
sie alle konnten in den Pickwickiern, im Oliver Twist und Nikolaus
Nickleby so gut eine Stelle finden, wie in. Freytags „Soll und
Haben." T. O. Schröter, Sabine, die Tanzstunde und vor allem
die Rothsattels würden, gehörig rubricirt, von Thackeray'schen Kapi-
teln schwerlich zu unterscheiden sein, und die Vertheidigung des
polnischen Gutes gegen die andringenden Rebellen, was ist sie über-
haupt anderes, als ein vom Hudson und Delaware an die Warthe
versetztes Stück Kriegsgeschichte, einem Cooperschen Ansiedler-Roman
so ähnlich, wie ein Ei dem andern! Diese Aehnlichkeiten sind so
groß, daß wir überrascht sind unter den principicllen und persön-
lichen Gegnern des Verf. auf fast gar keilte Angreifer nach dieser
Seite hin gestoßen zu sein, und doch wäre es, mit einem starken
Anschein von kritischer Gerechtigkeit, verhaltnißmäßig leicht gewesen,
an diese Anlehnung den Vorwurf schwächlicher Erfindungsgabe und
mangelnder poetischer Kraft zu knüpfen. Wir unsererseits fassen
nun freilich die Sache anders. Es giebt Baumeister, die ein
erbärmlich schlechtes Haus bauen, aber die unbestrittene Gabe der
Dekorirung, des Genies innerhalb der Niedlichkeit haben. Zu diesen
zählt Gustav Freytag nicht, vermuthlich weil er nicht will. Er weiß
zwischen Haupt- und Nebensache zu unterscheiden, und während er
nicht Anstand nimmt die Candelaber und Consolen, die Wendel-
treppchen und Kaminsimse, die Ofenbleche und Feuerzangen da her-
zu nehmen, wo sie nun 'mal erwiesenermaßen am besten zu
haben sind, richtet er als ein wirklicher Meister seine Aufinerksamkeit
auf den Grundriß, den Gedanken des Baues selbst, und hält Maaß
und Gesetz. Als Tapezirer ist er imitativ, als Baumeister ist er
eben ein Meister — in beiden Fällen weiß er, was er will. Der
gebildete Philister, an dem ein zehnjähriges Leihbibliothcken-
Abonnement nicht spurlos vorübergegangen ist, wird die imitative
Seite des Verf. allerdings bedenklich finden, und sich mit einem
Gefühl von Ueberlegenheit entsinnen, diese Art von Täfelung, von
Deckenverziernng und Nischen-Arrangement schon anderswo gesehen
zu haben. Aber dieser splitterrichtenden Alltagskritik kann eben nie-
tnand entgehen. Es ist das mißliche Vorrecht des Halbgebildeten,
über die Einzelnheiten das Ganze zu übersehen, und es bedeutet
wenig Ueberhebung, wenn wir unseren Stuhl von der ehrenwerthen
Gesellschaft etwas abrücken und diese Frage zwischen Nachahmung
und Selbstständigkeit durch den zutreffenden Spruch entscheiden:
„Woher ich dies und das genommen?"
Was geht's euch an, wenn es nur mein ward,
Fragt ihr, — ist nur der Ban vollkommen —
Woher gebrochen jeder Stein ward?
15
Dtatt
des
Deutschen Kunstblattes.
J\s 15.
Donnerstag, den 26. Juli.
1833.
^Inhalt: Soll und Haben. Roman von Gustav Freutag. — Die Schiller-Stiftung. — Das goldene Schiss der Hochschule zu München.
Soll und Hoden.
Ein Roman in drei Bänden von Gustav Freytag.
Leipzig, Hirzel.
Innerhalb jeder bedeutenden Epoche in Kunst und Literatur
pflegen wir drei immer wiedcrkehrende Personen-Gruppen wahrzu-
nehmen, die man etwas schwergewichtig, doch zutreffend als Bahn-
brecher, Kämpfer und Sieger unterschieden, oder, an die Vorstellung
einer Pyramide anknüpfend, mit Basis, Körper und Spitze verglichen
hat. Auch in der künstlerischen Entwicklung unserer heutigen Zeit
und ihres, nach allen Seiten hin, ausgesprochen realistischen Cha-
rakters vermochten wir seit geraumer Zeit eine solche Zuspitzung
wahrzunehmen, und nur die Frage noch blieb unentschieden, wel-
cher Kunst es Vorbehalten sein möge, zuerst das Ziel zu erreichen,
oder — um tat Bilde zu bleiben — die Pyramide abzuschließen.
Wir unsererseits waren freilich, seit den Zeiten des alten Schadow
her, daran gewöhnt, von der Skulptur diesen Sieg beinahe
zu fordern, aber, im Widerspruch damit, konnten wir uns
gegen die Wahrnehmung nicht ganz verschließen, daß es jenseits
des Rheines die Malerei und jenseits des Kanales die Dichtkunst
war, die jeden Augenblick, an Stelle unserer Skulptur, ihren
Triumph proklamiren konnten. So wurde die Regatta der drei
Künste zugleich ein Wettkampf dreier Nationalitäten. Ein glücklicher
Zufall hat es gewollt, daß wir als die Sieger aus diesem Kampfe
hervorgegangen sind, aber nicht auf dem Gebiet, das wir mit Hülfe
Rauchs und seiner Schule eine Art Recht hatten, als das unsrige
anzusehen, sondern vielmehr aus jenem, das nach einer gewissen
äußerlichen Gerechtigkeit einen englischen Sieger hätte hervor-
bringen müssen. Wir sagen „nach äußerlicher Gerechtigkeit," denn
in Wahrheit sind unsere Rechtsansprüche so groß, daß wir unseren
obigen Ausdruck, „ein glücklicher Zufall habe es gewollt," beinahe
beschämt zurückziehen, und vielmehr auf allen Gebieten den Sieg
für uns vorweg in Anspruch nehmen möchten. Wessen der Realis-
mus unserer Zeit bedarf, das ist die ideelle Durchdringung. Die
Deutschen aber sind unbestritten das Volk der Idee.
Der uns vorliegende Freytag'sche Roman „Soll und Haben"
ist es, dem diese einleitenden Worte gelten, und wir glauben nicht
zuviel zu sagen, wenn wir diese bedeutsame literarische Erscheinung
die erste Blüthe des modernen Realismus nennen. Der Baum
stand seit lange prächtig in Laub, aber die Blüthe, die, wie uns
die Physiologie lehrt, nichts anderes ist, als ein höher potenzirtes
Blatt, diese feinere Gestaltung fehlte. Sie fehlt nicht mehr. Der
Freytag'sche Roman ist eine Verdeutschung (im vollsten und
edelsten Sinne) des neueren englischen Romans. Er lehnt sich
entschieden an denselben an, ja er ist im Einzelnen eine Nachbildung
desselben und doch wiederum, als Ganzes, so grundverschieden von
Literatur-Blait.
ihm. Dickens, Thackeray und Coopcr sind unverkennbar Vorbilder
gewesen. Die Judenherberge, Hippus und Veitel Itzig, die Familie
Sturm (gegeu die wir, beiläufig bemerkt, wie sehr oft auch gegen
verwandte Schöpfungen des Boz'schen Humors eiuige Bedenken
hegen), insonderheit aber das Personal des Schröterschen Hauses,
sie alle konnten in den Pickwickiern, im Oliver Twist und Nikolaus
Nickleby so gut eine Stelle finden, wie in. Freytags „Soll und
Haben." T. O. Schröter, Sabine, die Tanzstunde und vor allem
die Rothsattels würden, gehörig rubricirt, von Thackeray'schen Kapi-
teln schwerlich zu unterscheiden sein, und die Vertheidigung des
polnischen Gutes gegen die andringenden Rebellen, was ist sie über-
haupt anderes, als ein vom Hudson und Delaware an die Warthe
versetztes Stück Kriegsgeschichte, einem Cooperschen Ansiedler-Roman
so ähnlich, wie ein Ei dem andern! Diese Aehnlichkeiten sind so
groß, daß wir überrascht sind unter den principicllen und persön-
lichen Gegnern des Verf. auf fast gar keilte Angreifer nach dieser
Seite hin gestoßen zu sein, und doch wäre es, mit einem starken
Anschein von kritischer Gerechtigkeit, verhaltnißmäßig leicht gewesen,
an diese Anlehnung den Vorwurf schwächlicher Erfindungsgabe und
mangelnder poetischer Kraft zu knüpfen. Wir unsererseits fassen
nun freilich die Sache anders. Es giebt Baumeister, die ein
erbärmlich schlechtes Haus bauen, aber die unbestrittene Gabe der
Dekorirung, des Genies innerhalb der Niedlichkeit haben. Zu diesen
zählt Gustav Freytag nicht, vermuthlich weil er nicht will. Er weiß
zwischen Haupt- und Nebensache zu unterscheiden, und während er
nicht Anstand nimmt die Candelaber und Consolen, die Wendel-
treppchen und Kaminsimse, die Ofenbleche und Feuerzangen da her-
zu nehmen, wo sie nun 'mal erwiesenermaßen am besten zu
haben sind, richtet er als ein wirklicher Meister seine Aufinerksamkeit
auf den Grundriß, den Gedanken des Baues selbst, und hält Maaß
und Gesetz. Als Tapezirer ist er imitativ, als Baumeister ist er
eben ein Meister — in beiden Fällen weiß er, was er will. Der
gebildete Philister, an dem ein zehnjähriges Leihbibliothcken-
Abonnement nicht spurlos vorübergegangen ist, wird die imitative
Seite des Verf. allerdings bedenklich finden, und sich mit einem
Gefühl von Ueberlegenheit entsinnen, diese Art von Täfelung, von
Deckenverziernng und Nischen-Arrangement schon anderswo gesehen
zu haben. Aber dieser splitterrichtenden Alltagskritik kann eben nie-
tnand entgehen. Es ist das mißliche Vorrecht des Halbgebildeten,
über die Einzelnheiten das Ganze zu übersehen, und es bedeutet
wenig Ueberhebung, wenn wir unseren Stuhl von der ehrenwerthen
Gesellschaft etwas abrücken und diese Frage zwischen Nachahmung
und Selbstständigkeit durch den zutreffenden Spruch entscheiden:
„Woher ich dies und das genommen?"
Was geht's euch an, wenn es nur mein ward,
Fragt ihr, — ist nur der Ban vollkommen —
Woher gebrochen jeder Stein ward?
15